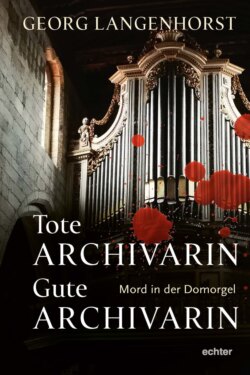Читать книгу Tote Archivarin - Gute Archivarin - Georg Langenhorst - Страница 12
6.
ОглавлениеAls sie die Treppe des Bistumshauses hinabgestiegen waren, hatte sich Kellert rasch von seiner Mitarbeiterin Hannah Mellrich verabschiedet. Sie würden ab morgen genug zu tun bekommen. Im großen Foyer wandelten noch letzte Gäste des Empfangs, einige schwankten sichtlich, mussten mit Hilfe freundlicher Geister nach draußen komplimentiert werden, wo einige Taxis auf ihre Fahrgäste warteten. Sekt und lauer Sommerabend: für manche eine gefährliche Kombination.
Professor Elmar Maria Brandtstätter stand ganz hinten in der Nähe der Bühne, in ein munteres Gespräch mit einigen sicherlich sehr wichtigen Herren vertieft. Was heißt ‚Gespräch‘? Sie lauschten seinen lautstarken Ausführungen. Kellert hatte keine Lust, sich jetzt noch bei ihm persönlich für die Einladung zu bedanken. Auch das würde seine Zeit bekommen. Er begnügte sich mit einem jovialen Winken mit der rechten Hand, das Brandtstätter sofort bemerkte und energisch erwiderte.
„Bernd, da bist du ja“, klang es von links. Beate trat mit erleichterter Miene auf ihn zu, begleitet von Karsten Kaiser, dem Organisten seiner Ortsgemeinde. Den hatte Kellert ganz vergessen. Jetzt begrüßte er beide freundlich, spürte aber gleichzeitig eine große Müdigkeit. „Wirklich nett, dass Sie meiner Frau Gesellschaft geleistet haben“, wandte er sich an Karsten Kaiser. „Kann ich Sie mitnehmen nach Polzingen?“
Der Organist lächelte: „Danke, es war mir eine Ehre. Immer wieder erfreulich, sich mit Ihrer Gattin zu unterhalten.“ Er schenkte Beate ein charmantes Lächeln, das Kellert freilich auch schon wieder zu weit ging. Diese blickte fröhlich, aber unverbindlich zurück. ‚Ah, gut‘, dachte Kellert besänftigt.
„Leider kann ich Ihr freundliches Angebot aber nicht annehmen“, setzte Kaiser fort. „Ich bin ausnahmsweise mit dem eigenen Auto da. Und das will ich hier denn doch nicht stehen lassen. Ich habe extra deswegen keinen Tropfen Alkohol angerührt. Obwohl sie den wunderbaren Silvaner vom Cyriakusberg ausgeschenkt haben. Der wäre eine Versuchung wert gewesen. Aber ich durfte ja der werten Frau Gemahlin Gesellschaft leisten, das war mir Freude genug. Einen schönen Abend wünsche ich noch!“
‚Gott sei Dank!‘, dachte Kellert und er nahm an, dass seine Frau das ähnlich empfand. „Der ist schon nett, der Kaiser. Und er kann gut erzählen. Aber Zuhören ist nicht gerade seine Stärke“, bemerkte Beate, während das Ehepaar zum Domparkplatz schlenderte. Sie hatte sich bei ihrem Mann eingehakt. Dass er diesen Abend nicht ungeteilt genossen hatte, war ihr natürlich klar. „Bei Brandtstätter habe ich Dich entschuldigt, Bernd“, beruhigte sie ihn. Er wusste es: Auf seine Frau war in diesen Dingen Verlass.
„Na, hast Du’s einigermaßen überlebt?“, fragte sie ihn einige Schritte später spielerisch. Ob sie damit das Konzert oder seinen geheimnisvollen Auftritt danach meinte, blieb unklar. Sie schritten über das grobe Kopfsteinpflaster, das man vor einigen Jahren rund um den Dom hatte anlegen lassen. In dieser Form hatte es das in der Geschichte Friedensbergs zuvor zwar nie gegeben, aber es sah irgendwie historisch aus. Und es hielt sowohl Autos als auch die ungeliebten Fahrradfahrer-Horden ab. „Ich schon“, entgegnete er kurz angebunden. „Aber alles andere erzähle ich Dir später.“
Bernd Kellert war selbst passionierter Fahrradfahrer. Gewesen. Er hatte immer ein Auto besessen, aber so selten wie möglich benutzt. Es war für ihn ein schlichter Gebrauchsgegenstand gewesen, der funktionieren musste. Mehr nicht. Seit einem Jahr war alles anders geworden. Nach ‚Corona‘. Nach dieser fürchterlichen Erschütterung von allem, was bis dahin normal war, durch dieses Virus.
Sie hatten ‚Covid 19‘ mittlerweile im Griff. Die Pandemie ließ sich kontrollieren, wenn auch nicht in allen Ländern in gleicher Weise. Man konnte sich impfen lassen, was Bernd Kellert und seine Frau auch sofort getan hatten. Und man konnte die Krankheit behandeln, wenn sie denn doch immer noch ausbrach. Aber ‚Corona‘ hatte seine Spuren im Grundlebensgefühl vieler Menschen hinterlassen. So auch bei Bernd Kellert.
Nachdem die radikalen Einschränkungen des ‚Lock-Down‘ Schritt für Schritt zurückgenommen worden waren, hatte er sich ein neues Auto gekauft. Ein Sportcabrio, neu, nicht billig. Alles andere als ein Vorzeigeobjekt ökologischer Vernunft. Schnittig. Schön, fand er. Darin stimmte ihm seine Frau zu, aber sie war überaus verwundert gewesen. „Du und dieses Auto!?“, hatte sie ungläubig gestaunt, als er es eines Abends vor die Haustür stellte. Er hatte nichts mit ihr abgesprochen. Das war allein seine Entscheidung.
„Ich habe immer vernünftige Autos gehabt“, erklärte er ihr. „Sparsam, unauffällig, langweilig. Jetzt habe ich Lust, etwas völlig Unvernünftiges zu tun. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben doch gesehen, wie schnell alles zu Ende gehen kann.“ Als Berufsanfänger hatte er sich einen gebrauchten Kleinwagen gekauft, lange her. Als junger Familienvater dann einen bezahlbaren Kombi der unteren Mittelklasse, als Vater größerer Kinder nacheinander zwei jeweils etwas größere Kombis der mittleren Mittelklasse, die irgendwie parallel zum Alter der Kinder mitwuchsen. Das war so absehbar. So langweilig. So profillos.
Bernd Kellert hatte sich mit diesem Kauf selbst überrascht, aber genau das gefiel ihm. Seine Frau war sich hingegen immer noch unsicher, was sie davon halten sollte. Aber sie hatte es akzeptiert. Was blieb ihr auch schon anderes übrig? Nun stieg sie in den blaumetallic-farbenen Flitzer, dessen Faltdach Bernd Kellert nicht geschlossen hatte. Der Domparkplatz war überwacht. Na also!
Auch sein Fahrstil hatte sich verändert. Härter fuhr er, schneller, aggressiver. Insgeheim gefiel ihr das. Sie freute sich an der knapp halbstündigen Fahrt auf der gut ausgebauten Bundessstraße im breiten, sattgrün bewachsenen Flusstal, das sich in einer großen Schleife bis nach Polzingen hinzog. Die Dämmerung hatte eingesetzt, aber es war noch so warm, dass man das Verdeck nicht schließen musste. Der Fahrtwind wehte über ihr mit einem Kopftuch zusammengebundene Haar. Das war schon ein angenehmes Gefühl.
Sie beugte sich zu ihrem Mann hinüber und rief durch das zugige Brausen: „Na, war doch mal wieder ganz nett, so ein Abendtermin, oder?“ Wie gut ihr selbst das Konzert und der Empfang getan hatten, ließ sie ungesagt. Vielleicht würde sich dazu später einmal eine Gelegenheit ergeben. Aber das war eigentlich gar nicht nötig. Bernd Kellert kannte seine Frau gut genug, um zu wissen, dass das für sie seit Langem der schönste Abend gewesen war. Dass sie von den beruflichen Kontakten ihres Mannes auf diese Weise profitierte, war eher selten. Umso schöner, dass es sich ab und zu einmal ergab!
Denn noch eine Veränderung hatte sich in Bernd Kellerts Leben eingeschlichen. Im Lock-Down von Corona musste man zuhause bleiben. Zwar war Bernd Kellert als Dienststellenleiter verpflichtet, ein- oder zweimal pro Woche persönlich in seinem Büro aufzutauchen, aber ansonsten arbeitete auch er von daheim aus. Home-Office – das Zauberwort, manche sagten auch ‚Reizwort‘ dieser Monate. Erstaunlicherweise war auch viel weniger zu tun gewesen als sonst. Die Zahl der Gewalttaten, die er aufzuklären hatte, ging radikal zurück. Er hatte lang aufgelaufene Überstunden abfeiern können, zum ersten Mal seit vielen Jahren.
Das hatte er genossen. Fast ein bisschen verschämt. Aber von Woche zu Woche mehr. Vor allem aber gefiel es ihm, dass sein Sozialleben sich radikal reduzierte. Keine sich in den Abend hineinziehenden Dienstbesprechungen mit anschließendem Absacker, keine Konferenzen, bei denen sich ja doch nur immer die gleichen Klugredner spreizten, kein Sport, keine Kollegenabende, keine von Beate organisierten Treffen mit Freunden, keine Kulturevents. Manche fanden das dadurch aufgezwungene Leben furchtbar langweilig. Beate etwa, die aus solchen Erlebnissen ihre Kraft schöpfte. Von einigen Kollegen hörte Bernd Kellert Ähnliches.
Ihm ging es komplett anders. Er hatte die Terminlosigkeit als große Befreiung empfunden. In seinem Beruf hatte er es durchgängig mit Menschen zu tun. Ständig musste er reden und reden. Schweigen zu dürfen, abends nicht mehr rausgehen zu müssen, das war etwas, was ihm guttat. Vielleicht war er schon immer so veranlagt gewesen, hatte sie aber einfach nicht ausleben dürfen, seine ‚soziale Genügsamkeit‘, wie er das vor sich selbst bezeichnete. Mit Bedauern sah er freilich, dass seine Frau unter all den Einschränkungen litt. Aber er konnte doch deswegen nicht so tun, als sei das bei ihm auch so!
Er hatte über die Wochen vier Kilo zugenommen. Vielleicht fünf. Er wusste, dass er dadurch älter aussah. Das sportlich-dynamische Image, das er von sich selbst gehabt hatte, passte irgendwie nicht mehr. ‚Aber du bist halt Mitte fünfzig, alter Junge. Steh dazu!‘, sagte er sich selbstironisch.
Dummerweise brachte diese Entwicklung jedoch eine Veränderung mit sich, die er zuvor bei vielen Kollegen und Freunden beobachtet und im Stillen belächelt hatte. Die Wangen verbreiterten sich, der Hals entwickelte einen kleinen Wulst unter dem Kinn auf dem Weg zur Doppelfalte. ‚Feist‘, hatte er das im Blick auf einige Kollegen leichthin genannt. Das Wort gefiel ihm auf einmal nicht mehr.
Aber immerhin: Es gab ein Gegenmittel. Man ließ sich einen Zweiwochenbart stehen. Gepflegt, sauber ausrasiert, aber gerade so, dass man die Alterserscheinungen der Haut nicht mehr erkennen konnte. Und dieser Bart war natürlich grau. Wenn man wohlwollend hinsah – wie seine Frau Beate –, sagte man ‚silbern‘.
Manche Kollegen, die Kellert nach der Aufhebung der Corona-Einschränkungen wieder traf, mussten erst einmal genauer hinschauen, bevor sie ihn erkannten. ‚Gereift‘, nannte er das vor sich selbst. „Gealtert“, hielt ihm Beate tadelnd vor. Nun gut, das stimmte ja auch. Die Virus-Pandemie hatte etwas beschleunigt, was sich auch unabhängig davon angebahnt hatte. Bernd Kellert – ein Mann von Mitte fünfzig!
Sichtlich gefiel ihm das Steuern des neuen Autos. Mit wenigen Worten informierte er seine Frau über den Fund in der Orgel. So gut das eben bei den Fahrtgeräuschen ging. Gar nicht schlecht: Das zwang ihn dazu, sich kurz zu halten. Aber sie war natürlich schon neugierig, warum man ihren Mann so unerwartet von ihrer Seite gerissen hatte.
„Ein Skelett in der Orgel!?“, staunte sie. „Wenn Du es nicht wärst, der mir das erzählt, würde ich es nicht glauben!“ ‚Ich auch nicht‘, dachte Bernd Kellert. ‚Was für ein gefundenes Fressen für die Sensationspresse! Wenn sie denn davon erfährt. Wir müssen alles tun, dass das erst dann passiert, wenn wir den Fall aufgeklärt haben!‘
Zuhause erwartete sie eine Überraschung. Als alteingesessene Friedensberger hatten sie sich vor einigen Jahren ein altes Knechtshaus in Polzingen gekauft, für ihre Bedürfnisse hergerichtet und sich inzwischen gut dort eingelebt. Beate kümmerte sich um den großen Garten, Bernd Kellert werkelte gern am Haus. Klassische Rollen, aber so waren nun einmal ihre Interessen und Fertigkeiten.
Bernd Kellert hatte hinter dem Haus eine große Terrasse angelegt und eine gemütliche Sitzecke eingerichtet. Von dort brannten ihnen die Lichter von drei Kerzen entgegen. Das kleine Auto, das neben der Einfahrt stand, hatte sie aber bereits vorgewarnt: der himmelblaue Lupo ihrer Tochter Jenny.
Richtig: Jenny saß mit dem Rücken zum Haus, strahlte sie an, auf dem Schoß die Katze Pucki, die zufrieden schnurrte und sich nur zu gern streicheln ließ. Die beiden genossen den lauen Montagabend. „Da seid ihr ja!“, begrüßte sie ihre Eltern. Die waren freilich nur zum Teil überrascht. Denn eine weitere Veränderung hatte Corona mit sich gebracht. Jenny, deren Abitur sich in diesem Jahr bereits zum elften Mal jährte, lebte eigentlich in Friedensberg. Hatte das eine oder andere studiert, nicht unbedingt mit übergroßem Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, wie ihr Vater immer mal wieder spitz anmerkte.
Einen Bachelorabschluss hatte sie erworben. Danach war sie ein Jahr unterwegs gewesen. ‚Work and Travel‘. Wieder zurück, hatte sie ein Masterstudium aufgenommen, das sie gerade abschloss. Sagte sie. Meistens hatte sie in irgendeiner WG gewohnt, war aber mehrfach umgezogen. Das hing auch mit wechselnden Freunden zusammen. Bernd Kellert hatte irgendwann den Überblick verloren und es dann auch aufgegeben. Das war ihr Leben! Das sie inzwischen immerhin komplett selbst finanzierte.
Nun, Corona hatte auch für die Neunundzwanzigjährige einiges verändert. Ihre derzeitige WG hatte weder Garten noch Balkon, außerdem fühlte sie sich dort nicht richtig wohl. „Ich werde langsam zu alt für ein solches Leben!“, hatte sie mehr als einmal gesagt. Dann schmunzelte ihr Vater vielsagend, was nun wiederum ihr nicht gefiel. Als die Vorgabe des Lock-Down kam, hatte sie kurzerhand zuhause angerufen: „Mama, darf ich zu euch kommen?“ Beate, die zufällig das Gespräch entgegengenommen hatte, hatte natürlich sofort zugestimmt.
Klar: Wenn du die Wahl hast zwischen einer engen, muffigen WG ohne Frischluftzugang und einem schönen, nicht zu großen, aber gerade passenden Haus mit eigenem Garten und direktem Zugang zu Wald und Wiesen, fällt die Wahl nicht schwer. Einen festen Freund gab es derzeit auch nicht, der Jenny in Friedensberg gehalten hätte. Wenn es denn schon um einen Rückzug in eine häusliche Umgebung ging, dann sprach alles für das Haus in Polzingen. Auch wenn sie als Kind oder Jugendliche ja nie in diesem Gebäude gewohnt hatte. Ihre Eltern hatten es gekauft, nachdem ihre beiden Kinder die zuvor gemeinsame Wohnung in Friedensberg verlassen hatten. Flügge geworden? Von wegen!
Tobias, der Ältere, lebte schon lange mit seiner Freundin in München. Aber Jenny? Sie hatten sich alle neu aneinander gewöhnen müssen, zu dritt. Und man durfte ja sonst nichts anderes tun, als zu Hause bleiben. Es hatte sich dann jedoch ganz gut eingespielt. „Was für eine geschenkte Zeit!“, gestand Beate Kellert ihrem Mann eines Abends. Und auch ihm gefiel diese neue Konstellation, trotz all der auferlegten Verbote und notwendigen Kompromisse. Es war ja nur für eine Übergangszeit. Dachten sie.
Jenny schien auch sehr zufrieden zu sein. Die Beschränkungen waren ja inzwischen aufgehoben worden. Längst konnte sie sich wieder frei bewegen und sie hielt das auch genauso. Mal war sie in Friedensberg in ihrer WG, mal im Elternhaus. Sie behielt das kurzerhand bezogene Gästezimmer einfach bei. Einen Hausschlüssel besaß sie sowieso. Ihre Eltern wunderten sich über diese neue Form von Anhänglichkeit, es war ihnen aber recht.
„Gesternland“, sagte sie nun unvermittelt mit erwartungsvollem Gesichtsausdruck. Ihre Eltern schauten sie verblüfft an. „Na, für ‚yesterday‘“, setzte Jenny nach. „Ich suche doch schon so lange nach einem geeigneten Wort für eine deutsche Übersetzung!“ Ihre Eltern wussten, dass sie ihre Masterarbeit im Fach ‚Vergleichende Literaturwissenschaft‘ schrieb. ‚Was immer das auch sein mag. Wer immer das braucht‘, dachte Bernd Kellert, ‚und wofür immer das gut sein soll‘. Diese Gedanken behielt er aber für sich.
Ihr Thema war die Frage, ob und gegebenenfalls wie man Songs der Beatles ins Deutsche übersetzen konnte. So dass sie singbar blieben, aber eben auch noch erkennbar in Bezug auf die englischen Originale. Das fand Bernd Kellert nun wiederum durchaus interessant. Denn natürlich, mit den Beatles war er aufgewachsen. „Voll eure Generation“, hatte Jenny gemeint, als sie ihren Eltern das erste Mal von diesem Thema erzählte.
Beate hatte lachend protestiert: „Ey, so alt sind wir nun auch wieder nicht. Das waren schon ‚Oldies‘, als wir diese Songs kennenlernten. Aber natürlich haben wir die rauf und runter gehört, damals. Manche kann ich noch auswendig. Und Papa singt sie manchmal unter der Dusche!“ ‚Was stimmt, das stimmt‘, hatte Kellert gedacht und mitgelacht.
Jenny spielte mit der linken Hand an einer der Kerzen herum, blickte über deren Schein hinaus in die Dunkelheit der lauen Nacht und nahm ihren Gedanken wieder auf: „Ich suche doch schon seit Ewigkeiten nach einer Möglichkeit, wie man ‚yesterday‘ so übersetzen kann, dass man es singen kann. Mein Lieblingssong von den Beatles, das wisst ihr ja. ‚Ge-hestern‘ geht ja wohl gar nicht. Und heute Morgen kam ich auf die Idee. Hört mal zu!“ Sie sang mit ihrer klaren Altstimme: „Im Gesternland / warn mir Sorgen völlig unbekannt / heut haben sie mich völlig in der Hand / oh, ich glaub an das Gesternland.“
„Stark!“, staunte Bernd Kellert. „Selbst gedichtet?“ „Ja, das ist mir halt so eingefallen“, erwiderte seine Tochter geschmeichelt. „Und wie geht’s weiter?“, fragte Beate. „Moment“, überlegte Jenny. Sie wischte die Katze von ihrem Schoß, die sich das maunzend gefallen ließ und gleich zu Bernd Kellert hinüber huschte, der sich zwischenzeitlich in einen der anderen Terrassenstühle niedergelassen hatte. Dann eben den nächsten Schoß.
„Urplötzlich / bin ich nur noch wie mein halbes Ich / dunkle Schatten überfielen mich / das Gesternland kam unmerklich“. „Hmm, ein bisschen bemüht, oder?“, fragte Jennys Vater dieses Mal nach. „Ja, ich weiß. Das ist noch nicht perfekt“, räumte seine Tochter ein. „Aber versuch es mal selbst. Das ist echt sauschwer. Der Zwischengesang ist leichter, finde ich: ‚Warum ging sie fort? / Sie hat keinen Grund genannt / Hab ich sie verletzt? / Ich lebte gern im Gesternla-ha-ha-hand‘“.
„Na, da bist du ja auf dem besten Weg, Jenny“, lobte Beate, die das wirklich gut fand und mitgesummt hatte. Jenny lächelte zufrieden und stimmte nun auch die Schlussverse an: „Im Gesternland / wo ich Liebe noch so einfach fand / baute Liebe sich ein Haus auf Sand / oh, ich glaub an das Gesternland.“ „Tja, darin bin ich auch unterwegs, im Gesternland“, seufzte Bernd Kellert vor sich hin. „Mein aktueller Fall beschäftigt sich mit einem Mord, der zweieinhalb Jahre zurückliegt“, erklärte er seiner Tochter. „Das habe ich auch noch nicht gehabt in meinem langen Berufsleben. Morgen früh geht es weiter. Zurück ins Gesternland!“