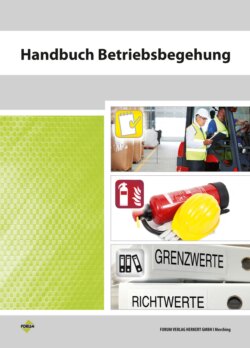Читать книгу Handbuch Betriebsbegehung - Georg Tschacher - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBeleuchtung
Gesetze, Verordnungen, Regeln
§ 3a Abs. 1 ArbStättV, ASR A3.4 „Beleuchtung“
Allgemeine Anforderungen
Arbeitsstätten müssen mit ausreichend Licht versorgt werden, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten sicherzustellen. Heutzutage geht es dabei nicht aus, nur die benötigte Helligkeit mit Tageslicht und künstlicher Beleuchtung in der richtigen Mischung sicherzustellen. Zusätzlich sollte die Kunstbeleuchtung möglichst nahe an das Tageslichtspektrum herankommen. Darauf sollten Sie bei Ihrer Begehung also entsprechend viel Wert legen, denn dies wirkt sich auch besonders günstig auf die Fehlerquote, Stimmung und Produktivität der Beschäftigten aus.
Beleuchtung mit Tageslicht
Anforderungen an die Beleuchtung mit Tageslicht:
• Für Fenster und Dachoberlichter sind Verglasungsmaterialien zu verwenden, die den Farbeindruck möglichst nicht verändern,
• Blendung: Um Blendungen durch Sonneneinstrahlung zu minimieren, sollten Jalousien, Rollos oder Lamellenstores verwendet werden.
Möglichkeiten zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen über Tageslicht:
• Fenster
• Dachoberlichter
• lichtdurchlässige Bauteile
Arbeitsräume sind ausreichend mit Tageslicht beleuchtet, wenn folgende Faktoren erfüllt werden:
• Tageslichtquotient am Arbeitsplatz > 2 %
• Tageslichtquotient am Arbeitsplatz bei Dachoberlichtern > 4 %
• Verhältnis Fenster-, Tür- oder Wandfläche bzw. Oberlichtfläche zur Grundraumfläche mindestens 1:10
Oben genannte Anforderungen gelten auch für Aufenthaltsbereiche in Pausenräumen.
Berechnung des Tageslichtquotienten: D=Ep/Ea × 100%
D Tageslichtquotient
Ep Beleuchtungsstärke im Innenraum
Ea Beleuchtungsstärke im Freien (ohne Verbauung, bei bedecktem Himmel)
Bild 1: Beispiel für die Tageslichtversorgung in Abhängigkeit von der Raumhöhe, der Größe und der Anordnung der Fenster (Quelle: ASR A3.4)
Praxistipp:
Ergibt sich bei der Begehung, dass Ihre Räume nicht die nötigen Anforderungen erfüllen, müssen Sie auch hier im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung andere Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten festlegen.
Künstliche Beleuchtung
Um in den Arbeitsräumen ausreichend Beleuchtung sicherzustellen, reicht Tageslicht in der Regel nicht aus. Darum ist zudem künstliche Beleuchtung nötig. Ob die Lichtverhältnisse genügen, hängt nicht zuletzt von den Bedürfnissen der Beschäftigten ab. Ältere Arbeitnehmer benötigen in der Regel z. B. aufgrund des geringeren Sehvermögens meist mehr Licht als jüngere. Grundlegend gilt:
• Das 0,6-Fache der mittleren Beleuchtungsstärke darf im Bereich des Arbeitsplatzes nicht unterschritten werden.
• Der niedrigste Wert der Beleuchtung darf nicht im Bereich der Hauptsehaufgabe liegen.
Praxistipp:
Achten Sie bei der Begehung darauf, ob das Licht richtig eingesetzt wird. Prüfen Sie also nicht nur, ob ausreichend Licht vorhanden ist, sondern auch, ob es überflüssige Lichtquellen gibt, die reduziert werden können. Es sollte nach Möglichkeit aus umwelt- und kostentechnischen Gründen darauf verzichtet werden, künstliches Licht übermäßig dort einzusetzen, wo es niemandem nutzt.
Orientierende Messung
Wenn Sie bei der Prüfung von Beleuchtungseinrichtungen orientierende Messungen im Betrieb durchführen, verwenden Sie mindestens Beleuchtungsstärkemessgeräte der Klasse C gemäß DIN 5035 Teil 6.
Beachten Sie bei der Durchführung der Messungen folgende Punkte:
• In Räumen, die auch durch Tageslicht beleuchtet werden, sollten Sie die Messung bei natürlicher Dunkelheit durchführen. Ist es nicht möglich, das Tageslicht abzudunkeln, müssen Sie zuerst bei eingeschalteter und danach bei aus geschalteter künstlicher Beleuchtung messen und anschließend aus der Differenz der beiden Messungen die Werte der künstlichen Beleuchtung ermitteln. Beide Messungen sollten bei bedecktem Himmel und unmittelbar nacheinander durchgeführt werden.
• Messen Sie die Beleuchtungsanlagen im Betriebszustand. Dazu müssen Leuchtstofflampen und andere Entladungslampen mindestens 100 Betriebsstunden aufweisen.
• Verteilen Sie die Messpunkte möglichst gleichmäßig.
Bild 2: Beispiel für die Verteilung der Messpunkte für einen Bereich des Arbeitsplatzes (Quelle: ASR A3.4)
Der Mindestwert der Beleuchtungsstärke muss in der Bezugsebene erreicht werden, d. h. dort, wo die Haupttätigkeit ausgeführt wird. Ist die Höhe der Ebene bekannt, in der die Sehaufgabe ausgeführt wird, können Sie die Messung dort durchführen. Wenn Sie die tatsächliche Höhe nicht kennen, sind folgende Höhenwerte anzunehmen:
Tab. 1: Höhe der Bezugsebenen für horizontale Beleuchtungsstärken Eh und vertikale Beleuchtungsstärken Ev
Prüfen auf Mängel
Prüfen Sie bei der Begehung die Beleuchtungsanlagen auf Mängel, z. B.:
• Ausfall von Leuchtmitteln
• Lösen von Leuchtenteilen
• Platzen des Schutzkolbens bei Hochdrucklampen
• Beschädigung von Leuchtenabdeckungen, die die Schutzart beeinträchtigen
• Verringerung der Beleuchtungsstärke (durch Verschmutzung, Alterung etc.)
• Kontakt mit heißen Oberflächen
Praxistipp:
Achten Sie zudem darauf, ob seit Ihrer letzten Begehung andere Rahmenbedingungen vorliegen. Gibt es eventuell geänderte Anforderungen an die Sehaufgabe oder arbeiten nun andere Beschäftigte am Arbeitsplatz, die andere Bedürfnisse haben?
Stellt sich bei der Begehung heraus, dass die in den Tabellen am Ende dieses Kapitels aufgeführten festgesetzten Richtwerte nicht erfüllt werden, müssen Sie durch andere Maßnahmen versuchen, einen gleichwertigen Schutz der Beschäftigten zu gewährleisten. Dies kann z. B. durch folgende Möglichkeiten erreicht werden:
• Einsatz effizienterer Leuchtmittel
• Verkürzung der Wartungsintervalle
• Die minimale Beleuchtungsstärke im Umgebungsbereich darf das 0,5-Fache der mittleren Beleuchtungsstärke des Umgebungsbereichs nicht unterschreiten.
Bild 3: Prinzipskizze zur Aufteilung einer Arbeitsstätte in zu beleuchtende Bereiche (Apl = Bereich des Arbeitsplatzes, TF = Teilfläche, UB = Umgebungsbereich) (Quelle: ASR A3.4)
Der Bereich des Arbeitsplatzes setzt sich zusammen aus:
• Arbeitsflächen
• Bewegungsflächen
• allen dem unmittelbaren Fortgang der Arbeit dienenden Stellflächen
Arbeitsfläche: Fläche in Arbeitshöhe, auf der die Arbeitsaufgabe verrichtet wird
Bewegungsfläche: zusammenhängende, unverstellte Bodenflächen am Arbeitsplatz, die mindestens erforderlich sind, um den Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit wechselnde Arbeitshaltungen und Ausgleichsbewegungen zu ermöglichen
Teilfläche: Fläche mit höheren Sehanforderungen, z. B. lesen, schreiben, messen, kontrollieren, betrachten von Fertigungsprozessen
Umgebungsbereich: räumlicher Bereich, der sich direkt an den Bereich des Arbeitsplatzes anschließt oder durch Raumwände oder Verkehrswege begrenzt wird
Begrenzung von Blendung
Ebenso wie bei der Beleuchtung mit Tageslicht, muss auch die Blendung durch künstliches Licht minimiert werden.
Geeignete Maßnahmen, um die Blendung zu begrenzen sind z. B.:
• Auswahl geeigneter Leuchtmittel
• richtige Auswahl und Anordnung der Leuchten
• Verringerung der Helligkeitsunterschiede zwischen Blendquelle und Umfeld
• Vermeidung von Reflexionen
Farbwiedergabe
Lampen müssen mindestens einen Farbwiedergabeindex nach Tabelle 1 haben.
Sicherheitszeichen und Sicherheitsfarben müssen trotz Beleuchtung durch Lampen als solche erkennbar sein. Bei Lampen mit einem Farbwiedergabeindex Ra < 40 muss dies z. B. durch Hinterleuchtung oder Anstrahlung sichergestellt werden.
Flimmern oder Pulsation
Unfallgefahren durch Flimmern/Pulsation müssen vermieden werden.
Schatten
Durch Schatten wird die räumliche Wahrnehmung verbessert, da Objekte in Form und Oberflächenstruktur leichter erkannt werden.
Es muss darauf geachtet werden, dass Schatten keine Gefahrenquellen überdecken. Dies ist z. B. durch mehrere Leuchten möglich, die aus verschiedenen Richtungen Licht abgeben
Abweichende Anforderungen auf Baustellen
Werte nach folgender Tabelle sind einzuhalten:
Bei ortsfesten Arbeitsplätzen, die Tätigkeiten in Räumen entsprechen, siehe Tabelle „Beleuchtungsanforderungen für Arbeitsräume, Arbeitsplätze und Tätigkeiten“.
Beleuchtungsanforderungen für Arbeitsräume, Arbeitsplätze und Tätigkeiten
Tab. 2: Beleuchtungsanforderungen für Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze und Tätigkeiten (Quelle ASR A3.4)
Beleuchtungsanforderungen für Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze und Tätigkeiten im Freien
Tab. 3: Beleuchtzungsanforderungen für Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze und Tätigkeiten im Freien (Quelle ASR A3.4)
Checkliste Beleuchtung
Verfügen die Arbeitsstätten und Arbeitsplätze über ausreichend Licht? (siehe Mindestanforderungen an die Beleuchtungsstärke)
Wird ein angemessenes Verhältnis von Tageslicht zu künstlicher Beleuchtung erreicht? (siehe Tageslichtquotient)
Ist die Beleuchtung so gestaltet, dass Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Beschäftigten vermieden werden? (gleichmäßige Beleuchtung, Blendung vermeiden etc.)
Wurden die Leuchtmittel auf Mängel geprüft?
Sind die Leuchtmittel sauber und wurde darauf geachtet, dass ggf. ältere Lampen ersetzt werden müssen?
Werden die Leuchtmittel regelmäßig gereinigt und gewartet?
Wurde die Beleuchtung auf die jeweiligen Bedürfnisse der Tätigkeit und der Mitarbeiter angepasst (z. B. ältere Arbeitnehmer)?
Wurde die Lichtfarbe so gewählt, dass es zu keiner Verfälschung der Farben auf Sicherheits- und Gesundheitsschutzzeichen kommt?