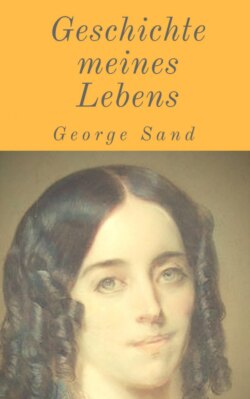Читать книгу Geschichte meines Lebens - George Sand - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel. Von der Geburt und vom freien Willen. — Friedrich August. — Aurora von Königsmark. — Moritz von Sachsen. — Aurora von Sachsen. — Der Graf Horn. — Die Fräulein Verrières und die Schöngeister des achtzehnten Jahrhunderts.— Herr Dupin von Francueil. — Madame Dupin von Chenonceaux. — Der Abbé von St. Pierre.
ОглавлениеDas Blut der Könige war also in meinen Adern mit dem Blute der Armen und Geringen vermischt. Und da, was man Bestimmung zu nennen pflegt, der Charakter des Individuums ist; da der Charakter des Individuums auf seiner Organisation beruht, und die Organisation eines Jeden von uns das Ergebniß der Vermischung oder Gleichheit der Racen ist, und die immer modificirte Fortsetzung einer Folge von Urbildern, die sich an einander anreihen — so habe ich immer daraus geschlossen, daß die natürliche Erblichkeit, die des Körpers und der Seele, eine ziemlich wichtige Verbindung zwischen einem jeden von uns und unseren Ahnen bildet.
Denn wir Alle — Große und Kleine, Plebejer und Patricier — wir Alle haben Ahnen. Ahnen heißt patres, das heißt eine Folge von Vätern, denn dies Wort hat keinen Singular. Es ist lächerlich, daß der Adel diesen Ausdruck zu seinen Gunsten in Beschlag genommen hat — als ob der Handwerker und der Bauer nicht eben so gut eine Reihe von Vätern hinter sich hätte; als ob nur der Besitzer eines Wappens den heiligen Vaternamen führen dürfte; als ob endlich die legitimen Väter in der einen Klasse häufiger als in der andern gefunden würden.
Meine Meinung über den Adel der Geschlechter habe ich im Piccinino ausgesprochen und vielleicht habe ich diesen Roman jener drei Kapitel wegen geschrieben, in welchen meine Ansichten über die Standesvorrechte entwickelt sind. Wie man denselben bis jetzt aufgefaßt hat, ist er ein ungeheures Vorurtheil, weil er die Heiligkeit der Familie, deren Princip allen Menschen theuer und unantastbar sein sollte, zum Besten einer reichen und mächtigen Klasse in Beschlag nimmt. An und für sich ist dieses Princip unveräußerlich und darum finde ich etwas Unvollständiges in dem spanischen Spruche: „Cada uno es hijo de sus obras.“ Zwar ist es ein großer und edler Gedanke, daß Jeder der Sohn seiner Thaten ist, und durch seine Tugenden so viel gilt, als der Patricier durch seinen Rang. Aus dieser Idee ist unsre große Revolution hervorgegangen — aber es ist eine reactionäre Idee — und solche fassen immer nur eine Seite der Frage in's Auge — die Seite, die zu lange vernachlässigt und verkannt war. So ist es zwar sehr richtig, daß Jeder der Sohn seiner Thaten ist — aber es ist ebenso wahr, daß Jeder der Sohn seiner Väter, seiner Ahnen, seiner patres und matres ist. Von Geburt an sind wir mit Trieben begabt, die nichts andres sind, als die Ergebnisse des Blutes, das uns vererbt wurde — und diese Triebe würden uns wie ein schreckliches Verhängniß beherrschen, wenn wir nicht ein gewisses Maß des Willens besäßen, das jedem Einzelnen unter uns von der gerechten Gottheit verliehen wird.
Bei dieser Gelegenheit — und das wird abermals eine Abschweifung sein — möchte ich es aussprechen, daß ich nicht an unsre vollständige Willensfreiheit glaube, und daß diejenigen, welche die fürchterliche Lehre der Prädestination angenommen haben — um consequent zu sein und um Gottes Güte nicht zu beleidigen — die gräßliche Idee der Hölle aufgeben müßten, wie ich sie in meiner Seele und in meinem Gewissen aufgegeben habe. Aber wir sind auch nicht vollständig Sklaven der Nothwendigkeit unserer Triebe. Gott hat uns Allen ein mächtiges Mittel gegeben, sie zu bekämpfen, indem er uns die Vernunft gab, die Erkenntniß, die Fähigkeit, unsre Erfahrungen zu nützen — mit einem Worte, die Fähigkeit, uns zu retten; sei es durch wohlverstandene Liebe für uns selbst, sei es durch Liebe zur absoluten Wahrheit.
Man würde umsonst versuchen, dieser Ansicht die Blödsinnigen, Wahnsinnigen und eine gewisse Art von Mördern entgegenzustellen, die von einer wüthenden Monomanie beherrscht werden und somit in die Reihen der Wahnsinnigen und Blödsinnigen gehören. Jedes Gesetz hat seine Ausnahmen, durch die es bestätigt wird. Jede Ordnung, so vollkommen sie auch sei, ist Unfällen ausgesetzt. Aber ich bin überzeugt, daß diese unheilbringenden Unfälle mit dem Fortschritt der Gesellschaft, mit der bessern Erziehung des Menschengeschlechts verschwinden werden — sowie auch das Verhängnis?, das wir von Geburt an in uns tragen, das Ergebniß einer bessern Vereinigung ererbter Triebe sein, unsre Stärke und die natürliche Stütze unsrer errungenen Urtheilskraft ausmachen wird, anstatt unaufhörliche Kämpfe zwischen unserer Neigung und unsern Grundsätzen zu veranlassen.
Es ist vielleicht ein kühnes Absprechen über Fragen, die Jahrhunderte lang Philosophie und Theologie beschäftigt haben. wenn ich es wage, ein bestimmtes Quantum der Sklaverei und der Freiheit anzunehmen. Die Religionen haben es für unmöglich gehalten, sich fest zu begründen, ohne auf absolute Weise die Freiheit des Willens anzuerkennen oder zu verwerfen.. Ich glaube, die Kirche der Zukunft wird verstehen, daß sie dem Verhängniß Rechnung tragen muß, der Gewalt der Triebe, dem Zuge der Leidenschaften. Die Kirche der Vergangenheit hatte das schon geahnt, da sie ein Fegefeuer annahm, ein Mittelding zwischen ewiger Verdammniß und ewiger Glückseligkeit. Die Theologie der vervollkommneten Menschheit wird zwei Principien anerkennen: Verhängniß und Freiheit. Aber da wir, wie ich hoffe, den Manichäismus überwunden haben, wird sie ein drittes Princip annehmen, welches die Lösung der Antithese enthalten wird: das Princip der Gnade.
Sie braucht dieses Princip nicht zu erfinden, sondern nur zu erhalten, denn es ist das Beste und Schönste, das sie aus ihrem alten Erbe zu erneuern haben wird. Die Gnade ist die göttliche Thätigkeit, die immer befruchtend, immer bereit ist, dem Menschen zu Hülfe zu kommen, welcher sie anruft. Daran glaube ich — und ohne dies würde ich nicht an Gott glauben können.
Auch die alte Theologie hatte diese Lehre entworfen, zum Gebrauch von Menschen, die naiver und unwissender waren als wir, das heißt also, in Folge der unzulänglichen Erkenntnisse jener Zeit. Sie hatte gesagt: Versuchung des Teufels, Willensfreiheit und Hülfe der Gnade, um Satan zu besiegen. So hatte sie drei Begriffe aufgestellt, die nicht mit einander im Gleichgewicht stehen — zwei gegen einen: vollständige Freiheit der Wahl und Hülfe der Allmacht Gottes, um dem Verhängniß, der Versuchung des Teufels zu widerstehen, der auf diese Weise leicht unterworfen werden konnte. Wenn es so wäre, wie sollten wir die menschliche Thorheit erklären, die fortfuhr, ihren Leidenschaften zu fröhnen und sich dem Teufel zu ergeben; trotz der Gewißheit ewiger Flammenqual und obwohl es ihr so leicht war, mit voller Geistesfreiheit und der Unterstützung Gottes den Weg der ewigen Seligkeit einzuschlagen.
Es scheint, als hätte diese Lehre die Menschen nie recht überzeugt. Denn diese Lehre, hervorgegangen aus einer strengen, enthusiastischen, muthigen Gesinnung; kühn bis zum Hochmuth und durchdrungen von leidenschaftlichem Verlangen des Fortschritts, ohne jedoch dem eigentlichen Wesen des Menschen Rechnung zu tragen; diese Lehre, die ebenso ungestüm in ihren Ergebnissen, als tyrannisch in ihren Urtheilssprüchen ist — da sie den Unsinnigen, der sich freiwillig den Dienst des Bösen erwählt hat, dem ewigen Hasse Gottes preisgiebt — diese Lehre hat nie ein Wesen gerettet. Die Heiligen haben den Himmel nur durch die Liebe gewonnen, und, die Furcht hat den Schwachen niemals gehindert, in die katholische Hölle hinabzustürzen. Indem die katholische Kirche die Seele vom Körper, den Geist von der Materie vollständig trennte, mußte sie das Wesen der Versuchung verkennen und konnte behaupten, daß diese ihren Sitz in der Hölle hätte. Aber wenn die Versuchung in uns selbst liegt, wenn Gott gestattet hat, daß es so sei, indem er selbst das Gesetz vorzeichnete, das den Sohn mit der Mutter verbindet, oder die Tochter mit dem Vater, alle Kinder mit dem einen oder mit der andern und zuweilen mit beiden in derselben Weise, zuweilen auch mit dem Großvater, dem Onkel, dem Urgroßvater — denn alle diese Phänomene der Aehnlichkeit, die bald körperlich, bald moralisch, bald beides zugleich ist, können jederzeit in Familien nachgewiesen werden — so ist es gewiß, daß die Versuchung nicht ein zum Voraus verdammtes Element, und daß sie nicht dem Einflusse eines abstracten Princips zuzuschreiben ist, das außer uns stände, um uns zu prüfen und zu quälen.
Jean Jacques Rousseau glaubte, daß wir Alle von Geburt gut und bildsam wären und dadurch verwarf er das Verhängniß. Aber wie vermochte er nun die allgemeine Schlechtigkeit zu erklären, die sich jedes Menschen von der Wiege an bemächtigt, um ihn zu verderben und um ihm die Liebe zum Bösen einzuflößen? Er glaubte doch an den freien Willen! Mir scheint es, als müßte uns der Glaube an die absolute Willensfreiheit des Menschen und der Anblick der schlechten Anwendung, die er davon macht, unvermeidlich zum Zweifel am, Dasein Gottes führen oder zum Glauben an seine Unthätigkeit und Gleichgültigkeit — und so müßten wir zuletzt, in Verzweiflung, zum Glauben an Vorherbestimmung zurückkehren. Das ist so ungefähr die Geschichte der Theologie in den letzten Jahrhunderten.
Wenn wir aber annehmen, daß die Bildsamkeit oder Wildheit unserer Triebe, wie ich oben sagte, ein Erbtheil ist, das wir nicht abweisen können und das abzuleugnen vergebene Mühe wäre, so ist das Ewig-Böse, das Böse als unabweisliches Princip, zerstört; denn der Fortschritt wird durch die Art des Verhängnisses, die ich anerkenne, nicht ausgeschlossen. Es ist ein wandelbares und immer umgewandeltes, oft vortreffliches und erhabenes Verhängniß — denn zuweilen ist unser Erbtheil eine herrliche Begabung, der Gottes Güte nie entgegentritt. — Das Menschengeschlecht ist nun nicht mehr eine Horde vereinzelter Wesen, die ohne Ziel umherirren, sondern eine Vereinigung von Linien, die sich an einander reihen und die nie zerrissen werden, wenn auch einzelne Namen aussterben — ein geringer Unfall, um den nur der Adel sich kümmert. — Die Einflüsse der geistigen Eroberungen der Zeit machen sich immerfort geltend auf den freien Theil der Seele und die göttliche Thätigkeit, welche die Seele dieses Fortschrittes bildet, ist es auch, die den Menschengeist immer auf's Neue belebt, und ihn so nach und nach frei macht von den Banden der Vergangenheit und der Erbsünde seines Geschlechtes.
So verlassen die physischen Uebel nach und nach unser Blut, wie der Geist des Bösen unsre Seele verläßt. So lange unvollkommene Generationen gegen sich selber kämpfen, sollte die Philosophie nachsichtig und die Religion erbarmungsreich sein. Sie haben nicht das Recht, den Menschen für eine That des Irrsinns zu tödten, ihn zu verdammen wegen eines falschen Gesichtspunktes. Und wenn sie für reinere, stärkere Wesen eine neue Lehre vorzuschreiben haben, werden sie nichts mehr mit dem Richter der Finsterniß, dem Henker der Ewigkeit, dem Peiniger Satan zu thun haben. Die Furcht wird keinen Einfluß mehr auf die Menschen üben, — sie hat ihn schon jetzt nicht mehr — die Gnade wird genügen; denn was man Gnade genannt hat, ist die Thätigkeit Gottes, den Menschen durch den Glauben offenbart. Das menschliche Bewußtsein hat sich empört gegen diese fürchterliche Lehre von der Hölle, gegen die Tyrannei eines Glaubens, der weder Verzeihung noch Hoffnung jenseit des Lebens annahm. Es hat seine Fesseln zersprengt und hat die Gesellschaft mit der Kirche, das Grab seiner Väter mit den Altären der Vergangenheit zerstört, es hat sich aufgeschwungen und hat sich für einen Augenblick verirrt — aber fürchtet euch nicht, es wird auch den rechten Weg wiederfinden.
Nun bin ich wieder einmal weit von meinem Gegenstande entfernt und meine Geschichte läuft Gefahr, der von den sieben Schlössern des Königs von Böhmen zu gleichen. Wohlan, was kümmert es Euch, meine guten Leser? Meine Geschichte ist an und für sich sehr uninteressant. Thatsachen spielen darin die kleinste Rolle und Grübeleien füllen sie aus. Niemand hat in seinem Leben weniger gethan und mehr geträumt als ich — konntet Ihr vom Dichter etwas Anderes erwarten?
Hört mich an: mein Leben ist das Eure — denn wer mich liest, ist nicht betheiligt an dem Lärm der Tagesinteressen, er würde sonst mein Buch mit Ueberdruß bei Seite schieben. Ihr seid Träumer wie ich. Also hat Alles, was mich auf meinem Wege aufhält, auch Euch gefesselt. Ihr habt, wie ich gesucht, Euch Rechenschaft zugeben von Euerm Dasein — und Ihr seid zu einigen Schlüssen gekommen. Vergleicht die meinigen mit den eurigen, wägt sie gegen einander und entscheidet, die Wahrheit geht erst aus der Prüfung hervor.
Wir werden also bei jedem Schritte still stehen und jeden Gesichtspunkt in's Auge fassen. Hier ist mir eine Wahrheit klar geworden: nämlich daß der Götzendienst der Familie falsch und gefährlich ist, aber daß Achtung und Einigkeit in der Familie nothwendig sind. Im Alterthum spielte die Familie eine große Rolle — aber dann überschätzte sie ihre Bedeutung; der Adel übertrug sich wie ein Privilegium und die Edelleute des Mittelalters hatten eine so hohe Meinung von ihrer Abstammung, daß sie die ehrwürdigen Familien der Patriarchen verachtet haben würden, wäre ihr Andenken nicht durch die Religion geheiligt. Die Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts erschütterten den Kultus des Adels, die Revolution warf ihn nieder; aber auch das fromme Ideal der Familie wurde in dieser Zerstörung fortgerissen und das Volk, das unter erblichen Bedrückungen gelitten hatte, das Volk, das die Wappen verlachte, begann sich allein für den „Sohn seiner Thaten“ zu halten. Das Volk irrte sich, denn es hat seine Ahnen so gut wie die Könige. Jede Familie hat ihren Adel, ihren Ruhm, ihre Würden: die Arbeit, den Muth, die Tugend oder die Klugheit. Jeder Mensch, der mit irgend welcher natürlichen Auszeichnung begabt ist, verdankt sie einem der Männer, die vor ihm lebten oder einer der Frauen, von denen er abstammt. Jeder Abkömmling irgend welcher Linie hätte also Vorbilder aus der Geschichte seiner Familie zu befolgen, wenn er in die Vergangenheit zurückschauen könnte; auch würde er dort Manches sehen, was er zu vermeiden hätte. Die berühmten Geschlechter geben Beispiel davon — und so wäre es keine üble Lehre für das Kind, wenn es aus dem Munde seiner Amme die alten Traditionen der Familie hörte, die einst den Unterricht des Edelmanns ausmachten.
Ihr Handwerker, die ihr anfangt Alles zu verstehen, ihr Bauern, die ihr anfangt lesen zu lernen, vergeßt doch Eure Todten nicht mehr. Uebertragt das Leben Eurer Väter auf Eure Söhne; macht Euch Titel und Wappen, wenn Ihr wollt, aber macht sie Euch Alle! Die Mauerkelle, die Hacke oder das Gartenmesser sind ebenso schöne Attribute als das Jagdhorn, der Thurm oder die Glocke. Ihr könnt Euch dies Vergnügen machen, wenn es Euch zusagt — Kaufleute und Geldwechsler machen es sich auch.
Aber Ihr seid ernster als diese Leute. — Nun wohl, so möge sich ein Jeder unter Euch bemühen, die guten Thaten und die nützlichen Arbeiten seiner Vorfahren kennen zu lernen und vor Vergessenheit zu bewahren. Und dann handelt danach, daß Eure Nachkommen Euch die nämliche Ehre erweisen. Vergessenheit ist ein geistloses Ungeheuer, das nur zu viele Generationen verschlungen hat. Wie viele Helden bleiben auf ewig unbekannt, weil sie nicht genug hinterließen, ein Grabmal zu errichten! Wie manches Licht ging der Geschichte verloren, weil der Adel die einzige Fackel und die einzige Geschichte der vergangenen Jahrhunderte zu sein begehrte! Entzieht Euch der Vergessenheit, Ihr Alle, die Ihr mehr im Sinne tragt, als die begrenzte Kenntniß der Gegenwart. Schreibt Eure Geschichte, Ihr Alle, die Ihr das Leben verstanden und Euer Herz ergründet habt — aus diesem Grunde schreibe ich auch die meinige, wie das, was ich von meinen Eltern erzählen werde.
Friedrich August, Kurfürst von Sachsen und König von Polen, war der größte Wüstling seiner Zeit. Es ist gerade keine seltne Ehre, etwas von seinem Blute in den Adern zu haben, denn er hatte, wie man behauptet, einige hundert Bastarde. Von der schönen Aurora von Königsmark, der großen, gewandten Kokette, vor welcher Karl XII. zurückwich, so daß sie sich an Furchtbarkeit einer Armee überlegen glauben konnte *), hatte er einen Sohn, der ihn an Adel bei weitem übertraf, obwohl er nie mehr war, als Marschall von Frankreich. Es war Moritz von Sachsen, der Sieger von Fontenay; er war gutmüthig und tapfer wie sein Vater und nicht weniger unsittlich; aber er war geschickter in der Kriegskunst, war glücklicher in seinen Unternehmungen und wurde besser unterstützt.
*) [Diese Anekdote ist ziemlich sonderbar; Voltaire erzählt sie folgendermaßen in seiner Geschichte Karl's XII.: „August zog es vor, die harten Gesetze seines Siegers, als die seiner Unterthanen zu empfangen. Er entschloß sich, den König von Schweden um Frieden zu bitten und wollte einen geheimen Vertrag mit ihm abschließen; aber dieser Schritt mußte dem Senat verborgen bleiben, den er als einen noch unerbittlichern Feind betrachtete. Die Sache war äußerst schwierig und er übertrug sie der Gräfin Königsmark, einer Schwedin, von hoher Geburt, mit welcher er damals ein Verhältniß hatte. Es ist dieselbe, deren Bruder durch seinen unglücklichen Tod bekannt wurde und deren Sohn die französischen Heere mit so viel Erfolg und Ruhm befehligte. Diese in der ganzen Welt durch Geist und Schönheit berühmte Frau war mehr als jeder Minister dazu geeignet, eine Unterhandlung zum Ziele zu führen. Da sie überdies in den Staaten Karl's XII. begütert war und lange an seinem Hofe gelebt hatte, fehlte es ihr nicht an glaubwürdigen Vorwänden diesen Fürsten aufzusuchen. Sie ging also nach Lithauen in das Lager der Schweden und wendete sich zuerst an den Grafen Piper, der ihr leichtsinnigerweise eine Audienz bei seinem Gebieter versprach. Unter den Vollkommenheiten, welche die Gräfin zu einer der liebenswürdigsten Frauen Europa's machten, besaß sie das wunderbare Talent, die Sprachen verschiedener Länder, die sie nie gesehen hatte, mit einer Zartheit zu sprechen. als wenn sie dort geboren wäre. Sie unterhielt sich zuweilen auch damit, französische Verse zu machen — und man würde geglaubt haben, daß ihre Verfasserin in Versailles lebte.
Sie dichtete einige für Karl XII., welche die Geschichte nicht verschweigen darf; nachdem sie alle Götter des Heidenthums eingeführt hatte, die verschiedene Tugenden des Königs priesen, schloß sie mit den Worten.
„Enfin chacun des dieux discourant à sa gloire
Le plaçait par avance au temple de Mémoire:
Mais Vénus et Bacchus n'en dirent pas un mot.“
Auf einen Mann wie der König von Schweden blieben so viel Geist und Liebenswürdigkeit wirkungslos. Er weigerte sich beharrlich, die Gräfin zu sehen, und so ergriff sie endlich das Mittel, ihm bei einem seiner häufigen Spazierritte zu begegnen. Sie traf ihn wirklich eines Tages auf einem sehr schmalen Wege und stieg aus dem Wagen, sobald sie ihn erblickte. Der König grüßte sie, ohne ein Wort zu sagen, drehte sein Pferd um und ritt augenblicklich von dannen, so daß die Gräfin von Königsmark von ihrer Reise nur die Genugthuung mitbrachte, sich für das einzige Wesen zu halten, vor welchem der König von Schweden Furcht empfand.“]
Aurora von Königsmark wurde auf ihre alten Tage Stiftsdame einer protestantischen Abtei — derselben Abtei von Quedlinburg, deren Aebtissin später die Prinzessin Amalie von Preußen war, die Schwester Friedrich's des Großen und die Geliebte des berühmten und unglücklichen Baron Trenk. Die Königsmark starb in dieser Abtei und wurde daselbst beigesetzt. — Und vor einigen Jahren berichteten deutsche Zeitungen, daß man bei Nachgrabungen in den Gräbern der Stiftskirche zu Quedlinburg die einbalsamirten, vollständig erhaltenen Ueberreste der Aebtissin Aurora aufgefunden habe, gehüllt in ein mit Edelsteinen verziertes Brokatkleid und in einen mit Marderpelz gefütterten Mantel von rothem Sammet. Nun habe ich aber auch in meinem Zimmer, auf dem Lande, ein Bild der Dame aus ihrer Jugendzeit, das von einer strahlenden Schönheit der Farben ist. Man sieht sogar, daß sie sich geschminkt hat, um zu dem Bilde zu sitzen. Sie ist sehr brünett, was unsern Erwartungen von einer nordischen Schönheit nicht entspricht. Ihre kohlschwarzen Haare sind am Hinterkopfe mit Rubinnadeln aufgesteckt; ihre glatte, freie Stirn hat nichts Bescheidenes; dicke, harte Flechten fallen auf ihren Busen und sie trägt das mit Edelsteinen bedeckte Brokatkleid und den mit Pelz besetzten Mantel von rothem Sammet, womit sie auch in ihrem Sarge bekleidet ist. Ich gestehe, daß mir diese kühne, lächelnde Schönheit nicht gefällt, und daß mir, seit der Ausgrabung, das Bild sogar einige Furcht einflößt, wenn es mich Abends mit seinen glänzenden Augen anschaut. Es ist mir dann, als ob sie mir sagte: „Mit welchen närrischen Dingen beschwerst Du Dein armes Gehirn, ausgearteter Sprößling meines stolzen Geschlechts? Mit welcher Gleichheitschimäre erfüllst Du Deine Träume? Die Liebe ist nicht, wie Du sie glaubst; die Menschen werden niemals sein, wie Du hoffst. Sie sind dazu geschaffen, durch ihre Könige, durch die Frauen und durch sich selbst betrogen zu werden.“
Neben ihr hängt das Bild ihres Sohnes, Moritz von Sachsen; ein schönes Pastellgemälde von Latour. Er hat einen glänzenden Harnisch, gepudertes Haar und ein schönes, gutes Gesicht, das immer zu sagen scheint: „Vorwärts, mit wirbelnden Trommeln und brennenden Lunten.“ Auch kommt es ihm gewiß nicht darauf an, französisch zu lernen, um seine Aufnahme in die Akademie zu rechtfertigen. Er gleicht seiner Mutter, aber er ist blond, seine Haut ist zart, seine blauen Augen haben mehr Sanftmuth und sein Lächeln ist freimüthiger.
Dennoch hat er durch seine Leidenschaften häufig seinen Ruhm befleckt; unter andern durch das Abenteuer mit Madame Favart, das mit so viel Gemüth und Adel in Favart's Briefen erzählt ist. Eine seiner letzten Neigungen war für Fräulein von Verrières [Ihr wahrer Name war Maria Rinteau und ihre Schwester hieß Genoveva. Der Name Verrières ist angenommen.], eine Opernsängerin, die mit ihrer Schwester ein kleines Gartenhaus bewohnte, das noch jetzt vorhanden ist und im neuen Centrum von Paris, inmitten der Chaussee d'Antin liegt. Fräulein Verrières hatte aus dieser Verbindung eine Tochter, die erst fünfzehn Jahre später als Tochter des Marschalls von Sachsen anerkannt und durch einen Parlamentserlaß berechtigt wurde, seinen Namen zu führen. Zur Sittenschilderung jener Zeit ist diese Geschichte ein schätzbarer Beitrag. Ich lasse hier folgen, was ich darüber in einem alten juristischen Werke gefunden habe.
„Das Fräulein Maria Aurora, natürliche Tochter des Grafen Moritz von Sachsen, General-Feldmarschall der französischen Heere, ist getauft worden unter dem Namen der Tochter von Johann Baptist de la Rivière, Bürger von Paris und von Maria Rinteau, seiner Frau. Da das Fräulein Aurora im Begriff steht, sich zu verheirathen, wurde der Herr von Montglas durch ein Urtheil des Châtelet vom 3. Mai 1766 zu ihrem Vormunde ernannt. Die Veröffentlichung des Aufgebots verursachte Schwierigkeiten, da das Fräulein Aurora nicht gestatten wollte, als Tochter des Herrn la Rivière bezeichnet zu werden und noch weniger als Tochter unbekannter Eltern. Das Fräulein Aurora reichte eine Beschwerdeschrift beim Gerichtshofe ein, um gegen den Ausspruch des Châtelet zu appelliren. Herr Thétion, welcher bei dem Gerichtshofe für das Fräulein Aurora plaidirte, brachte den vollständigen Beweis bei, sowohl durch Aussage des Herrn Gervais, der ihre Mutter entbunden hatte, als durch Aussage der Personen, welche Taufzeugen gewesen waren u.s.w., daß sie die natürliche Tochter des Grafen von Sachsen sei, und daß dieser sie immer als solche anerkannt habe. Für den ersten Vormund, der die Sache den Gerichten übertragen hatte, gab Herr Massonnet am 4. Juni 1766, auf Antrag des Staatsanwalts, Herrn Joly de Fleury ein Urtheil ab, das den Ausspruch des Châtelet vom 3. Mai für nichtig erklärte; ferner ernannte er Herrn Giraud, Gerichtsprocurator, zum Vormunde des Fräulein Aurora und erklärte sie „im Besitz des Standes einer natürlichen Tochter von Moritz, Grafen von Sachsen; erkannte und bestätigte sie im genannten Besitz und befahl zugleichen, das Taufzeugniß umzuändern, das eingetragen ist in die Kirchenbücher der Gemeinde von St. Gervais und St. Protais zu Paris, unter dem Datum des 19. Oct. 1748, welches Taufzeugniß besagt: daß Maria Aurora u.s.w. über die Taufe gehalten ist an diesem Tage, durch Anton Alexander Colbert, Marquis von Sourdis und durch Genoveva Rinteau, als Pathen und Pathin, und an die Stelle der Namen von Johann Baptist de la Rivière, Bürger von Paris und von Maria Rinteau, seiner Frau, nach den Worten: Maria Aurora, eingeschaltet werden soll: natürliche Tochter des Grafen Moritz von Sachsen, General-Feldmarschall der französischen Armee, und der Maria Rinteau; und zwar durch den Gerichtsvollzieher unseres genannten Gerichtshofes, den Ueberbringer gegenwärtigen Urtheilspruches ec. — [Auszug aus der „Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle“ von J. B. Denisart, Procurator des Châtelet von Paris, III Theil pag. 704.]
Ein anderer unleugbarer Beweis, den meine Großmutter der öffentlichen Meinung gegenüber geltend machen konnte, war ihre erwiesene Aehnlichkeit mit dem Marschall von Sachsen, und die Art des Schutzes, den ihr die Dauphine, Tochter des Königs August, Nichte des Marschalls und Mutter Karl's X. und Ludwig's XVIII. gewährte. Diese Prinzessin brachte meine Großmutter nach St. Cyr und übernahm die Sorge für ihre Erziehung und Verheirathung, indem sie ihr auf das Strengste verbot, mit ihrer Mutter zu verkehren.
Aurora von Sachsen verließ St. Cyr im Alter von fünfzehn Jahren, um mit dem Grafen Horn, einem Bastard Ludwig's XV. und Statthalter des Königs in Echlestadt, verheirathet zu werden. [Anton von Horn, Ritter des Ludwigskreuzes und königlicher Statthalter der Provinz Schlestadt.] Sie sah ihn zuerst am Vorabend ihrer Hochzeit und fürchtete sich sehr vor ihm, denn sie glaubte ein Bild des seligen Königs, dem er in erschreckender Weise glich, vor sich zu sehen. Er war zwar größer und schöner, aber er sah hart und unverschämt aus. Am Abend der Hochzeitfeier, der mein Großonkel, der Abbé von Beaumont — Sohn des Herzogs von Bouillon und des Fräulein von Verrières — beiwohnte, erschien ein treuer Kammerdiener, um den Abbé, der fast noch ein Kind war, zu bitten: Alles aufzubieten, um die junge Gräfin Horn von ihrem Gatten fern zu halten. Der Arzt des Grafen von Horn wurde zu Rath gezogen und der Graf selbst erkannte seine Pflicht.
Maria Aurora von Sachsen war also nur dem Namen nach die Gattin ihres ersten Mannes. Sie sahen sich nur bei den königlichen Festen, die ihnen im Elsaß bereitet wurden: da gab es Truppen, unter den Waffen. Kanonendonner, Schlüssel der Städte, auf goldnem Teller dargereicht. Reden der Magistratspersonen, Illuminationen, große Bälle im Stadthause und ähnliche Dinge. Es schien, als wollte die Welt durch allen Aufwand der Eitelkeit das arme kleine Mädchen trösten, einem Manne zu gehören, den sie nicht liebte, nicht kannte, und, den sie fliehen mußte, wie den Tod.
Meine Großmutter hat mir oft erzählt, welchen Eindruck ihr, nach der Stille des Klosters, die Pracht dieser Empfangsfeierlichkeiten machte. Sie saß in einem großen vergoldeten Wagen, der von vier weißen Pferden gezogen wurde. Ihr Gemahl saß zu Pferde und trug ein prächtig besetztes Kleid. Aber die arme Aurora fürchtete sich vor dem Kanonendonner, wie vor der Stimme ihres Gatten. Nur eins machte ihr Freude — man überreichte ihr, mit königlicher Bewilligung, eine Begnadigung der Gefangenen zur Unterzeichnung. Sogleich wurden einige zwanzig Staats-Gefangene entlassen und kamen ihr zu danken. Sie weinte vor Freude — und vielleicht belohnte sie die Vorsehung für dies Gefühl, als sie später nach dem 9. Thermidor das Gefängniß verließ.
Wenige Wochen, nachdem sie im Elsaß angekommen war, verschwand ihr Gatte inmitten einer Ballnacht. Die Frau Statthalterin tanzte fröhlich weiter. Gegen drei Uhr Morgens wurde sie heimlich benachrichtigt, daß ihr Gatte sie ersuchen ließe, einen Augenblick zu ihm zu kommen. Sie folgte der Aufforderung — aber an der Thür des Grafen blieb sie unschlüssig stehen, weil ihr einfiel, wie dringend ihr junger Bruder, der Abbé, ihr eingeschärft hatte, dies Gemach niemals allein zu betreten. Sie faßte Muth, als sie beim Oeffnen der Thüre Licht und Menschen erblickte. Derselbe Diener, der am Hochzeitstage gesprochen hatte, hielt in diesem Augenblicke den Grafen Horn, der auf einem Bette lag, in den Armen. Ein Arzt stand daneben. „Der Herr Graf hat der Frau Gräfin nichts mehr zu sagen,“ rief der Diener, sobald er meine Großmutter erblickte; „führt die gnädige Frau fort, so schnell als möglich.“ Sie sah nur noch eine große, weiße Hand, die über den Bettrand hinunterhing und die man schnell hinauflegte, um dem Leichnam eine schickliche Stellung zu geben. Der Graf Horn war soeben im Duell durch einen Degenstoß getödtet.
Meine Großmutter erfuhr die nähern Umstände nie und hatte gegen ihren Gatten keine Pflicht mehr zu erfüllen, als die, ihn äußerlich zu betrauern. Lebend oder todt hatte er ihr nie etwas anderes als Entsetzen eingeflößt.
Wenn ich nicht irre, lebte die Dauphine noch zu dieser Zeit und sie schickte Maria Aurora in's Kloster zurück. Gewiß ist, daß die junge Wittwe bald die Freiheit erlangte ihre Mutter zu sehen, die sie immer geliebt hatte, und daß sie diese Freiheit mit Eifer benutzte. [Die Dauphine starb 1767, meine Großmutter war also neunzehn Jahr alt, als sie mit ihr zusammen leben konnte.]
Die Fräulein von Verrières lebten noch immer mit einander im Wohlstande; sie machten sogar ein ziemlich großes Haus, waren noch schön und doch alt genug, um von uneigennützigen Huldigungen umgeben zu sein. Diejenige, welche meine Urgroßmutter war, soll die klügste und liebenswürdigste gewesen sein. Die andere war eine Schönheit; ich weiß nicht, von welcher vornehmen Persönlichkeit sie ihren Unterhalt empfing, aber ich habe gehört, daß man sie la belle et la bête zu nennen pflegte.
Die Schwestern lebten angenehm und mit einer Sorglosigkeit, die den freien Sitten jener Zeit entsprach. Sie „dienten den Musen“, wie man damals sagte; in ihrem Hause wurde Komödie gespielt, Herr von la Harpe spielte dort selbst in seinen ungedruckten Stücken. Aurora gab die Rolle der Melanie mit großem Erfolg. Literatur und Musik waren die einzige Beschäftigung dieses Kreises. Aurora war von engelhafter Schönheit; ihr Verstand war ausgezeichnet; durch die Gründlichkeit ihrer Bildung stand sie den aufgeklärtesten Geistern ihres Zeitalters gleich. Ihre Fähigkeiten wurden durch den Umgang, die Unterhaltung und die Umgebung ihrer Mutter noch entwickelt und ausgebildet. Ueberdies hatte sie eine prächtige Stimme, ich habe nie eine bessere Musikerin gekannt. Man gab auch komische Opern bei ihrer Mutter; sie machte Colette im devin du village, Azémia in den Sauvages und alle Hauptrollen in den Stücken Gretry's und Sedaine's. In ihrem Alter habe ich sie hundert Mal die Melodien alter italienischer Meister singen hören, die sie zu ihrer Hauptnahrung erkoren hatte, wie Leo, Porpora, Pergolesi, Hassa u.s.w. Ihre Hände waren gelähmt, sie begleitete sich mit zwei oder drei Fingern auf einem alten, kreischenden Klaviere; ihre Stimme zitterte, war aber immer richtig und umfangreich, und Schule und Vortrag verlieren sich nie. Sie las alle Partitionen vom Blatte und ich habe niemals besser singen oder begleiten gehört. Sie hatte jene großartige Manier, jene breite Einfachheit, jenen reinen Geschmack, jene Klarheit der Betonung, die man nicht mehr hat, die man heut zu Tage nicht einmal kennt. In meiner Kindheit ließ sie mich mit ihr ein kleines italienisches Duett, von ich weiß nicht welchem Meister, singen:
Non mi dir, bel idol mio,
Non mi dir ch' io son ingrato.
Sie übernahm die Tenorpartie und zuweilen — obwohl sie etwa fünfundsechszig Jahr alt war — erhob sie ihre Stimme zu einer solchen Macht des Ausdrucks und zu solchem Liebreiz, daß ich eines Tages stecken blieb und in Thränen ausbrach. Aber ich werde auf diese ersten musikalischen Eindrücke, die theuersten Erinnerungen meines Lebens, zurückkommen. Für jetzt wende ich mich zu der Jugendgeschichte meiner lieben Großmutter zurück.
Unter den berühmten Männern, die das Haus ihrer Mutter besuchten, wurde sie besonders mit Büffon bekannt und fand in seiner Unterhaltung einen Zauber, der sich in ihrer Erinnerung unverwischt erhielt. Ihr Leben war in dieser Zeit ebenso heiter und sanft als glänzend. Allen flößte sie Liebe oder Freundschaft ein. Ich besitze eine Menge Liebesbriefe mit süßlichen Versen, welche die Schöngeister der Zeit an sie richteten; einen unter andern von La Harpe mit folgenden Versen:
Des Césars à vos pieds je mets toute la cour *).
Recevez ce cadeau que l'amitié présente,
Mais n'en dites rien à l'amour ...
Je crains trop qu'il ne me démente.
*) [Er schickte ihr seine Uebersetzung der zwölf Cäsaren des Sueton.]
Dies ist eine Probe von der Galanterie der Zeit. Aber Aurora wandelte durch diese Welt voll Verführungen, durch diese zahllosen Huldigungen, ohne für etwas anderes, als die Uebung der Künste und die Bildung ihres Geistes Sinn zu haben. Sie hatte nie eine andere Leidenschaft, als die der Mutterliebe und erfuhr niemals, was ein Abenteuer ist. Und doch war sie eine zärtliche, großmüthige Natur und von einer außerordentlichen Gefühlstiefe. Ihre Tugend war nicht auf Frömmigkeit gegründet; sie kannte keine andere Religiosität als die des achtzehnten Jahrhunderts: den Deismus Rousseau's und Voltaire's. Aber sie war eine entschlossene, hellsehende Seele und schwärmte besonders für ein gewisses Ideal des Stolzes und der Selbstachtung. Koketterie war ihr fremd; sie war zu reich begabt, um ihrer zu bedürfen; auch waren solche Herausforderungen unverträglich mit ihren Gewohnheiten und ihren Ansichten von Frauenwürde. So schritt sie durch eine sehr leichtfertige Zeit und eine sehr verdorbene Gesellschaft, ohne ihre Schwingen im geringsten zu beflecken. Durch ein eigenthümliches Geschick dazu verurtheilt die Liebe in der Ehe nicht kennen zu lernen, löste sie die große Aufgabe, in Frieden zu leben und jedem Uebelwollen und jeder Verleumdung zu entgehen.
Ich glaube, daß sie etwa fünfundzwanzig Jahr alt war, als sie ihre Mutter verlor. Frl. Verrières starb eines Abendes, als sie im Begriff war sich niederzulegen. Sie war nicht im mindesten unwohl, beklagte sich nur, kalte Füße zu haben, setzte sich an's Feuer und während die Kammerfrau ihre Pantoffeln wärmte, hauchte sie den Geist aus, ohne ein Wort zu sagen, ohne nur einen Seufzer auszustoßen. Die Kammerfrau zog ihr die Pantoffeln wieder an, fragte, ob sie sich nun erwärmt fühlte und da sie keine Antwort erhielt, blickte sie ihr in's Gesicht und sah nun, daß der letzte Schlummer ihre Augen geschlossen hatte. Ich glaube, daß in jener Zeit für gewisse Naturen, die sich mit ihren sittlichen Begriffen vollständig in Harmonie fühlten, Alles leicht war, selbst der Tod.
Aurora zog sich abermals in ein Kloster zurück; das war so Sitte, wenn man als junges Mädchen oder junge Wittwe keine Verwandten besaß, die als Führer durch die Welt dienen konnten. Man richtete sich friedlich ein, sogar mit einer gewissen Eleganz; man empfing Besuche, man ging Morgens, ja sogar Abends aus mit einer passenden Ehrenwächterin. Das Ganze war eine Art Vorsicht gegen die Verleumdung, eine Sache des Anstandes und des Geschmacks.
Aber für meine Großmutter, deren Neigungen ernst und deren Gewohnheiten geregelt waren, wurde diese Zurückgezogenheit nützlich und schätzbar. Sie las ungeheuer viel und häufte Bände voll Auszüge und Citate auf, die ich noch besitze, und die mir Zeugniß geben von der ernsten Richtung ihres Geistes und dem guten Gebrauch ihrer Zeit. Ihre Mutter hatte ihr nichts hinterlassen, als einige Kleidungsstücke, einige Familienportraits, unter andern das der Aurora von Königsmark, das sonderbarer Weise durch den Marschall von Sachsen bei ihr einquartirt war, viele Madrigals und ungedruckte poetische Werke ihrer literarischen Freunde (die sehr verdienten ungedruckt zu sein), endlich das Siegel des Marschalls und seine Tabacksdose, die ich noch besitze und die von sehr hübscher Arbeit sind.
Ihre Gläubiger waren vielleicht immer bereit gewesen über ihr Haus, ihre Bücher und alle die Luxusgegenstände herzufallen, deren sie als hübsche Frau bedurfte; aber die Dame hatte, bis zu der heitern und sorglosen Stunde ihres Todes, zu sehr auf die gute Erziehung dieser Herrn gerechnet, um sich deshalb zu beunruhigen. Die Gläubiger jener Zeit waren in der That sehr gebildete Leute. Meine Großmutter hatte von ihrer Seite nicht die geringste Unannehmlichkeit zu ertragen; aber sie sah sich auf einen kleinen Jahrgehalt von der Dauphine angewiesen, und auch dieser blieb eines schönen Tages aus. Bei dieser Gelegenheit schrieb sie an Voltaire und dieser antwortete ihr in einem liebenswürdigen Briefe, dessen sie sich bei der Herzogin von Choiseul bediente.
[Hier ist der Brief meiner Großmutter und die Antwort. An Herrn von Voltaire 24. August 1768.
„An den Sänger von Fontenoy wendet sich die Tochter des Marschalls von Sachsen, um ihr tägliches Brod zu erlangen. Ich bin anerkannt; nach dem Tode meines Vaters hat die Kronprinzessin für meine Erziehung gesorgt; später hat mich diese Fürstin aus Saint-Cyr zurückgerufen, um mich mit dem Grafen Horn, Ritter des Ludwigskreuzes und Hauptmann im Regimente Royal-Baviere zu vermählen. Für meine Aussteuer hatte sie die Statthalterschaft von Schlestadt erwirkt. Kurz nach unserer Ankunft daselbst starb mein Mann plötzlich, inmitten der Feste, die uns gegeben wurden, und seitdem hat mir der Tod alle meine Beschützer geraubt: den Kronprinzen und die Kronprinzessin.
Fontenoy, Raucoux, Laufeld sind vergessen und ich bin verlassen. Aber ich habe geglaubt, daß der, welcher die Siege des Vaters verewigt hat, auch an den Leiden der Tochter Theil nehmen würde. Ihm kommt es zu, sich der Kinder des Helden anzunehmen, und meine Stütze zu sein, wie er die der Tochter des großen Corneille ist. Durch die Beredtsamkeit, mit der Sie die Sache der Unglücklichen zu führen pflegen, werden Sie in allen Herzen einen Schrei des Mitleids erwecken und Sie werden sich dadurch ebensoviel Rechte an meine Dankbarkeit erwerben, wie Sie deren schon an meine Achtung haben und an meine Bewunderung für Ihre erhabnen Talente.«
Antwort: 2. Sept. 1768 im Schlosse von Ferney,
„Madame. Bald werde ich Ihren Vater, den Helden wiedersehen und ich werde ihm voller Unwillen erzählen, in welchen Verhältnissen sich seine Tochter befindet. Ich habe die Ehre gehabt, viel mit ihm zusammen zu sein und er hatte die Gnade, sich mir gewogen zu zeigen. Es gehört zu den Leiden, die mich in meinem Alter niederbeugen, zu sehen, daß die Tochter von Frankreichs Helden in Frankreich nicht glücklich ist. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich mich der Herzogin von Choiseul vorstellen. Mein Name würde mir alle Thüren öffnen und die Herzogin von Choiseul, deren Seele gerecht, edel und wohlthätig ist. würde eine solche Gelegenheit, das Gute zu thun, nicht vorübergehen lassen. Dies ist der beste Rath, den ich Ihnen geben kann, und sobald Sie sprechen, bin ich des Erfolges gewiß, Sie haben mir ohne Zweifel zu viel Ehre erzeigt, gnädige Frau, als Sie dachten, daß ein sterbender, verfolgter, in Zurückgezogenheit lebender Greis, glücklich genug sein könnte, der Tochter des Marschall von Sachsen zu dienen. Aber Sie haben mir Gerechtigkeit erzeigt, als Sie nicht an dem lebhaften Interesse zweifelten, das ich der Tochter eines so großen Mannes schenken muß.
Ich habe die Ehre zu sein hochachtungsvoll, Ihr ganz ergebener und gehorsamer Diener
Voltaire, königl. Kammerherr.]
Sie scheint indessen nichts damit erreicht zu haben, denn im Alter von etwa dreißig Jahren entschloß sich Aurora meinen Großvater, Dupin von Francueil zu heirathen, der damals zweiundsechszig Jahr alt war.
Dupin von Francueil, derselbe, den J.J. Rousseau in seinen Memoiren und Frau von Epinay in ihrem Briefwechsel nur Francueil zu nennen pflegen, war der vollendet liebenswürdige Mann des vergangenen Jahrhunderts. Er war nicht von hohem Adel, denn er war der Sohn des General-Pächters Dupin und dieser hatte den Degen mit dem Finanzsache vertauscht. Er selbst war General-Einnehmer, zur Zeit als er meine Großmutter heirathete. Seine Familie war gut und alt, und besaß vier Folianten voll Geschlechtsregister, die durch heraldische Formeln bewiesen und mit hübschen colorirten Vignetten verziert waren. Trotz alledem zögerte meine Großmutter lange, ehe sie diese Verbindung schloß, nicht wegen Dupin's vorgerücktem Alter, sondern weil er von ihrer Umgebung nicht als ebenbürtig mit dem Fräulein von Sachsen und der Gräfin von Horn angesehen wurde. Endlich wich dies Vorurtheil den Vermögensrücksichten, denn Dupin war zu dieser Zeit sehr reich. Auf meine Großmutter mochte indessen die Verlockung des Reichthums weniger gewirkt haben, als die unausgesetzte Aufmerksamkeit, die Feinheit, der Geist und der liebenswürdige Charakter ihres alten Anbeters, sowie der Widerwille, sich im schönsten Lebensalter dem Klosterzwange zu fügen. Nach zwei oder drei Jahren der Zögerung, in denen kein Tag verging, ohne daß Dupin im Sprachzimmer erschienen wäre, um mit meiner Großmutter zu frühstücken und zu plaudern, krönte sie seine Liebe und wurde sein Weib. [Es scheint, als wären ihnen von irgend einer Seite — von welcher, weiß ich nicht — Schwierigkeiten in den Weg gelegt, denn sie ließen sich in England in der Gesandtschaftskapelle trauen und ließen nachher ihre Heirath in Paris bestätigen.]
Sie hat mir oft von dieser lange erwogenen Heirath und von diesem Großvater erzählt, den ich nie gekannt habe. Sie sagte mir, daß sie während der zehn Jahre, die sie miteinander verlebten, ihn und ihren Sohn als die theuersten Güter ihres Lebens betrachtet hätte; und obwohl sie sich nie des Ausdrucks Liebe, in Bezug aus ihn, oder irgend einen andern Mann, bediente, lächelte sie, wenn sie mich äußern hörte, daß ich es für unmöglich hielte einen Greis zu lieben. „Ein Greis liebt besser als ein junger Mann — sagte sie — und es ist unmöglich eine innige Liebe nicht zu erwiedern. Ich nannte ihn meinen alten Mann und meinen Papa, wie er es wünschte und er nannte mich immer, selbst in Gesellschaft, seine Tochter. Und dann“ — fügte sie hinzu, „war man wohl jemals alt in jener Zeit? Die Revolution hat erst das Alter in die Welt gebracht. Dein Großvater, mein Kind, war schön, elegant, fein, heiter, liebenswürdig, herzlich und von immer gleicher Laune bis zur Stunde seines Todes. In seiner Jugend war er zu liebenswürdig, um ein ruhiges Leben zu führen und ich wäre damals vielleicht nicht so glücklich mit ihm geworden, weil man ihn mir zu viel streitig gemacht haben würde. Ich bin überzeugt, daß ich sein bestes Lebensalter genossen habe und niemals ist eine junge Frau durch einen jungen Mann glücklicher geworden, als ich es war. Wir verließen uns keinen Augenblick, und nie habe ich in seiner Gesellschaft einen Augenblick der Langenweile gekannt. In seinem Geiste war eine Fundgrube von Ideen, Kenntnissen und Talenten, die sich nie für mich erschöpfte. Er hatte die Gabe sich immer in einer Weise zu beschäftigen, die für ihn selbst, wie für Andere angenehm war. Im Lauf des Tages musicirten wir miteinander. Er war ein vortrefflicher Violinspieler und machte auch seine Geigen selbst, denn er war ebensowohl Instrumentenmacher, als Architekt, Uhrmacher, Drechsler, Maler, Schlosser, Tapezierer, Koch, Dichter, Componist und Tischler; er konnte auch wunderschön sticken — ich weiß überhaupt nichts, was er nicht verstanden hätte. Das Unglück war nur, daß er bei der Uebung dieser Talente, bei den mannigfaltigen Versuchen, die er anstellte, sein Vermögen durchbrachte; aber ich sah nur die Lichtseite und so richteten wir uns auf die liebenswürdigste Weise zu Grunde. Wenn wir Abends nicht in Gesellschaft waren, saß Dupin neben mir und zeichnete, während ich Goldfäden auszupfte; oder wir lasen uns eins um's andere etwas vor, oder liebenswürdige Freunde umgaben uns und erweckten seinen feinen, fruchtbaren Geist durch anmuthiges Geplauder. Meine Freundinnen waren viel glänzender verheirathet als ich und doch wurden sie nicht müde zu versichern, daß sie mich um meinen alten Mann beneideten.“
„Man wußte aber auch zu leben und zu sterben in jener Zeit,“ sagte sie ein anderes Mal; „und man hatte keine lästigen Gebrechen. Wer das Podagra hatte, ging trotzdem rüstig einher, ohne Gesichter zu schneiden und verbarg sein Leiden aus gutem Ton. Man war auch nicht durch Geschäfte eingenommen — was die Häuslichkeit verdirbt und den Geist schwerfällig macht. Man wußte sich zu Grunde zu richten, ohne etwas davon merken zu lassen, wie großartige Spieler, die verlieren, ohne Besorgniß oder Wunsch. Halbtodt hätte man sich noch zu einer Jagdpartie tragen lassen, und man fand, daß es besser wäre, auf dem Ball oder im Theater zu sterben, als auf dem Krankenbette zwischen vier Kerzen und von häßlichen schwarzen Männern umgeben. Man war philosophisch; man suchte nicht den Schein der Sittenstrenge, aber man besaß sie oft, ohne damit zu prunken; wenn man tugendhaft war, so war's aus Neigung und nicht um für pedantisch und prüde zu gelten. Man genoß das Leben und wenn der Augenblick gekommen war, es zu verlassen, suchte man nicht, es Andern zu verleiden. Das letzte Lebewohl meines alten Gatten war die Aufforderung, ihn so lange als möglich zu überleben und mir das Dasein angenehm zu machen. Und gewiß wird man am lebhaftesten bedauert, wenn man sich so großmüthig beweist.“
Diese Philosophie des Reichthums, der Unabhängigkeit, der Toleranz und Leutseligkeit war gewiß angenehm und verführerisch; aber leider brauchte man fünf bis sechsmalhunderttausend Livres Renten, um sie durchzuführen, und ich begreife nicht, wie sie den Armen und Unterdrückten genützt haben könnte.
Darum scheiterte sie vor den Sühnopfern der Revolution und die Glücklichen der Vergangenheit erhielten sich nur die Kunst, das Schaffot mit Anmuth zu besteigen. Ich gebe zu, daß dies viel ist; aber diese letzte Tapferkeit wurde ihnen erleichtert durch den tiefen Ekel vor einem Leben, das ihnen keinen Genuß mehr versprach und durch das Entsetzen vor einem gesellschaftlichen Zustande, in welchem sie — dem Princip nach wenigstens — die Rechte Aller an Wohlstand und Freude anerkennen mußten.
Aber ehe ich weiter gehe, will ich von einer Berühmtheit der Dupin'schen Familie erzählen; einer wahren, rechtmäßigen Berühmtheit, auf deren Ehre und intellectuelle Erbschaft jedoch weder mein Großvater noch ich Anspruch zu machen haben. Diese Berühmtheit ist Madame Dupin von Chenonceaux, die nicht zu meinen Blutsverwandten gehört, da sie die zweite Frau des General-Pächters Dupin, die Stiefmutter Dupin's von Francueil war. Aber dies ist kein Grund von ihr nicht zu sprechen; und ich sehe mich um so mehr dazu veranlaßt, da diese bedeutende Frau, — trotz des Rufes, den sie sich durch Geist und Liebenswürdigkeit erwarb, und trotz der Lobsprüche, die ihre Zeitgenossen ihr spenden — in der Republik der Wissenschaften nie den Platz eingenommen hat, den sie verdiente.
Sie war ein Fräulein von Fontaines und galt, wie J.J. Rousseau erzählt, für eine Tochter Samuel Bernard's. Sie brachte ihrem Mann eine bedeutende Mitgift zu — ich weiß zwar nicht, ob das Gut Chenonceaux ihm oder ihr gehörte — aber so viel ist gewiß, daß Beider Vermögen zusammen ein ungeheures war. In Paris hatten sie das Hotel Lambert zum Absteigequartier und konnten sich also rühmen, eins um's andere die beiden schönsten Aufenthaltsorte der Welt zu bewohnen.
Es ist bekannt, daß Jean Jacques Rousseau der Sekretair des General-Pächters Dupin wurde, und mit ihm Chenonceaux bewohnte; daß er sich in Madame Dupin verliebte, die schön war, wie ein Engel, und daß er unvorsichtiger Weise eine Erklärung wagte, die keinen Erfolg hatte. Dessenungeachtet blieb er in freundschaftlichen Beziehungen zu ihr und ihrem Stiefsohne, Francueil.
Madame Dupin beschäftigte sich mit Literatur und Philosophie, aber sie prunkte nicht damit und nannte sich nicht bei den Werken, die ihr Mann herausgab, obwohl ich gewiß bin, daß der größte Theil und die besten Gedanken derselben ihr angehörten. Zu diesen Werken gehört eine umfassende Kritik des „Esprit des lois“, ein gutes, wenig gekanntes und wenig gewürdigtes Buch, das zwar der Form nach dem Werke Montesquieu's untergeordnet ist, sich aber, dem Inhalte nach, in mancher Hinsicht darüber erhebt. Weil es aber freisinnigere Ideen in die Welt einführte, ging es unbemerkt neben dem glänzenden Talente Montesquieu's zu Grunde, der allen Richtungen und allen politischen Bestrebungen des Augenblicks genügte.[Das Werk wurde wenig verbreitet. Frau von Pompadour, die Montesquieu beschützte, veranlaßte Dupin, sein Werk, das schon publicirt war, zurückzunehmen. Aber ich habe das Glück ein Exemplar davon zu besitzen, und ohne Vorurtheil oder Familien-Eitelkeit darf ich sagen, daß es ein sehr gutes Buch ist, dessen gründliche Kritik alle Widersprüche des „Esprit des lois“ enthüllt, und das dann und wann die erhabensten Bemerkungen über die Gesetzgebungen und das sittliche Leben der Völker enthält.]
Während Jean Jacques Rousseau bei ihnen lebte, beschäftigte sich Herr und Madame Dupin mit einem Werke über die Verdienste der Frauen. Rousseau half ihnen dabei, indem er Notizen sammelte und eine große Menge Materialien aufhäufte, die noch als Manuscript im Schlosse von Chenonceaux existiren. Dupin's Tod unterbrach die Arbeit und aus Bescheidenheit unterließ seine Frau die Veröffentlichung. Eine kurze, von ihr selbst geschriebene Zusammenstellung ihrer Ansichten, der sie den bescheidenen Titel „Versuche“ gegeben hat, verdiente indessen der Verborgenheit entzogen zu werden — wäre es auch nur, um als Beitrag zur Geschichte der Philosophie des vergangenen Jahrhunderts zu dienen. Diese liebenswürdige Frau gehörte in die Reihen der guten und schönen Seelen ihrer Zeit und es ist vielleicht zu beklagen, daß sie ihr Leben nicht dazu verwendet hat, das Licht, das sie in ihrem Herzen trug, zu nähren und zu verbreiten.
Was ihr inmitten der Philosophen jener Zeit ein eigenthümliches Gepräge giebt, ist, daß sie den meisten unter ihnen vorangeeilt ist. Sie ist nicht Rousseau's Jüngerin; sie hat nicht sein Talent; aber er hat nicht die Kraft und den Schwung ihrer Seele. Sie geht von einer kühnern, tiefern Lehre aus, die für das Menschengeschlecht schon alt, für das achtzehnte Jahrhundert aber scheinbar neu war. Sie ist die Freundin, die Schülerin oder die Lehrerin eines Greises, der als Schwärmer galt, der ein unvollständiges Genie war, weil ihm das Talent der Gestaltung fehlte und den ich doch vom Geiste Gottes mehr erfüllt glaube, als Voltaire, Helvetius, Diderot und Rousseau sogar —; ich meine den Abbé von St. Pierre, den man in der Gesellschaft den „berühmten“ Abbé von St. Pierre zu nennen pflegte, eine ironische Bezeichnung, die ihm heut zu Tage geschenkt wird, weil er fast gänzlich unbekannt oder vergessen ist.
Es giebt einen Genius, der immer unglücklich ist, weil ihm die Fähigkeit des Ausdrucks mangelt; wenn er nicht einen Plato findet, der ihn der Welt verständlich macht, leuchtet er nur wie ein schwacher Blitzstrahl durch die Nacht der Zeiten und er trägt das Geheimniß seines Geistes mit in's Grab — „das Unerkannte seiner Betrachtungen“ — wie Geoffroy Saint-Hilaire, ein Mitglied dieses großen Geschlechts berühmter Stummer oder Stammler, zu sagen pflegte.
Diese Unfähigkeit, sich mitzutheilen, erscheint wie ein Verhängniß, während Männern von geringer Tragweite der Gedanken und kaltem Gefühle oft die klarste, glücklichste Gestaltungsgabe verliehen ist. Ich kann es wohl begreifen, daß Madame Dupin die Utopien des Abbé von St. Pierre den Lehrsätzen Montesquieu's vorgezogen hat, die von englischem Geist erfüllt sind. Der große Rousseau hatte nicht so viel moralischen Muth oder so viel Geistesfreiheit, als diese großherzige Frau. Als sie ihm auftrug den „Entwurf des ewigen Friedens“ und die „Polysynodie“ des Abbé von St. Pierre zu resümiren, that er es, mit aller Schönheit der Form, die ihm zu Gebote stand; aber er erklärte, daß er es für nöthig gehalten hätte, die kühnsten Vorschläge des Verfassers zu übergehen, und verweist Alle, die den Muth haben, sich damit zu beschäftigen, auf den Urtext.
Ich muß gestehen, daß mir der Spott, womit J. J. Rousseau die Utopien des Abbé von St. Pierre behandelt, und die Rücksichten, die er auf die Machthaber der Zeit zu nehmen vorgiebt, nicht gefallen. Ueberdies ist seine Verstellung entweder zu fein oder zu ungeschickt; seine Ironie ist entweder nicht deutlich genug und verliert dadurch an Kraft, oder sie ist zu wenig verhüllt und büßt dadurch an Wirksamkeit und Vorsicht ein. Es ist keine Einheit, keine Sicherheit in den Urtheilen Rousseau's über den Philosophen von Chenonceaux. Je nachdem er durch Schicksale, Lebensüberdruß und Verfolgungen mehr oder weniger niedergedrückt ist, stellt er ihn als großen Mann oder als armseligen Menschen dar. Aus gewissen Stellen der Bekenntnisse scheint sogar hervorzugehen, daß er sich schämt, den Abbé von St. Pierre jemals bewundert zu haben, Aber der Mangel an, Talent kann noch nicht zum armseligen Menschen machen. Das Genie strömt aus der Seele, es liegt nicht in der Form. Uebrigens trifft der Hauptvorwurf, den Rousseau, wie alle Kritiker der Zeit, dem Abbé von St. Pierre gemacht hat, das Unpraktische seiner Theorien und den Glauben an die Möglichkeit seiner gesellschaftlichen Reform. Und doch scheint es, als hätte dieser Träumer klarer gesehen, als alle seine Zeitgenossen, und als hätte er den revolutionären, constitutionellen, St.-Simonistischen Ideen — und selbst denen, die man heut zu Tage rein menschliche nennt — weit näher gestanden als sein Zeitgenosse Montesquieu und dessen Nachfolger: Rousseau, Diderot, Voltaire, Helvetius u.s.w.
Von allen diesen ist in dem umfangreichen Gehirne des Abbé von St. Pierre etwas zu finden, und in dem Chaos seiner Gedanken sind alle die Ideen aufgehäuft und durcheinander geworfen, wovon eine später genügte das Leben eines bedeutenden Mannes auszufüllen. Jedenfalls geht St. Simon von ihm aus; Madame Dupin, seine Schülerin, sowie Herr Dupin in seiner Kritik des Esprit des loi sind entschieden Emancipatoren des Weibes. Die Regierungs-Versuche, die seit hundert Jahren gemacht sind, die bedeutendsten Thaten der europäischen Diplomatie und die Trugbilder fürstlicher Unterhandlungen, die man Bündnisse zu nennen pflegt, haben den Verfassungstheorien des Abbé von St. Pierre einen — freilich trügerischen — Anschein der Weisheit und Sittlichkeit entlehnt, und die Lehre vom ewigen Frieden ist in alle neuern philosophischen Schulen übergegangen.
Es würde also heut zu Tage sehr lächerlich sein, den Abbé von St. Pierre lächerlich zu finden und ohne Ehrfurcht von dem zu sprechen, der selbst von seinen Feinden der „Biedermann“ genannt wurde. Und hätte er der Nachwelt nur diesen Namen zu hinterlassen, so besäße er mehr darin, als in dem Ruhme, einer der großen Männer seiner Zeit zu sein.
Madame Dupin von Chenonceaux liebte diesen Biedermann auf das Herzlichste; sie theilte seine Ideen, verschönte sein Alter durch zarte Aufmerksamkeit und empfing in Chenonceaux seinen letzten Seufzer. In dem Zimmer, worin er Gott seine edle Seele zurückgab, habe ich ein Bild von ihm gesehen, das kurz vor seinem Tode gemalt ist. Sein schönes Gesicht, das zugleich streng und sanft ist, hat eine gewisse Aehnlichkeit der Form mit den Zügen Franz Arago's; aber der Ausdruck ist anders — auch liegen die Schatten des Todes schon über diesem großen, schwarzen Auge, das durch Leiden eingesunken ist, und über diesen bleichen Wangen, die das Alter gefurcht hat. [Ich habe mir hier einen Irrthum zu schulden kommen lassen, auf den mich mein Vetter Herr v. Villeneuve, Erbe von Chenonceaux, aufmerksam macht. Der Abbé von St. Pierre ist in Paris gestorben, kurze Zeit nachdem er eine schwere Krankheit in Chenonceaux glücklich überstanden hatte. (Anmerkung von 1850.)]
Madame Dupin hat in Chenonceaux einige Schriften zurückgelassen, die sehr kurz, aber voll klarer Gedanken und edler Gefühle sind. Es sind größtentheils abgerissene Betrachtungen, die jedoch in sehr logischer Verbindung mit einander stehen. Eine kleine, nur wenige Seiten lange Abhandlung „über das Glück“ halten wir für ein Meisterstück; und um den Grundgedanken verständlich zu machen, wird es genügen, wenn wir die ersten Worte wiederholen: „Alle Menschen haben gleiche Rechte an das Glück“ — oder wörtlich: „Alle Menschen haben gleiche Rechte an die Freude.“ Das Wort Freude darf hier nicht mißverstanden, nicht als der Ausdruck eines Begriffs aus der Zeit der Regentschaft gehalten werden. Sein eigentlicher Sinn ist: materielles Glück, Genuß des Lebens, Wohlbefinden, — Vertheilung der Güter, wie man jetzt sagen würde. Der Titel des Ganzen, der keusche, ernste Sinn, der sich darin ausspricht, lassen keinen Zweifel über den Inhalt dieser Gleichheitsformel, die ganz im Sinne unserer Zeit gebraucht ist, und dem Satze entspricht: „Einem Jeden nach seinen Bedürfnissen.“ Diese Idee scheint mir der Neuzeit angehörig zu sein — so neu, daß sie für das vorsichtige Gehirn unserer meisten Denker und Politiker noch immer zu kühn ist, und daß der berühmte Historiker, Louis Blanc, eines gewissen Muthes bedurft hat, um diese Meinung auszusprechen und zu entwickeln.[Ich schreibe dies im Juli 1847. Wer weiß, ob nicht vor dem Erscheinen dieser Memoiren eine allgemeine gesellschaftliche Umwälzung die Zahl der muthigen Denker um ein Bedeutendes vermehrt haben wird.]
Madame Dupin, die schöne, liebenswürdige, einfache, starke und ruhige Frau starb in Chenonceaux in ziemlich vorgerücktem Alter. Die Form ihrer Schriften ist ebenso klar wie ihre Seele, ebenso zart, so heiter, so glücklich, wie die Züge ihres Gesichts. Diese Form ist ihr ganz eigen und ihre elegante Correctheit thut ihrer Eigenthümlichkeit keinen Abbruch. Sie schreibt in der Sprache ihrer Zeit, aber sie hat die Wendungen Montaigne's, die Lebendigkeit Bayle's, und man sieht wohl, daß sich die schöne Dame nicht gescheut hat, die alten Meister aus dem Staube vorzusuchen. Sie ahmt sie nicht nach, aber sie hat sie sich zu eigen gemacht — wie ein guter Magen, der sich mit guten Nahrungsmitteln nährt.
Zu ihrem Lobe muß noch gesagt werden, daß unter allen Freunden, die J. J. Rousseau in seinem leidensvollen Alter aufgab oder beargwöhnte, sie vielleicht die einzige Persönlichkeit ist, welcher er Gerechtigkeit widerfahren läßt und deren Wohlthaten er ohne Bitterkeit gesteht. Sie war selbst gütig gegen Therese Levasseur und ihre elende Familie; sie war gütig gegen Alle und wahrhaft geachtet, denn die revolutionären Stürme, die in das königliche Schloß Chenonceaux eindrangen, verschonten das weiße Haar der alten Dame. Alle Gewaltmaßregeln beschränkten sich auf die Wegnahme einiger historischen Gemälde, die Madame Dupin den Anforderungen des Augenblicks gutwillig opferte. Jetzt ruht sie unter einem einfachen, geschmackvollen Grabstein im Park von Chenonceaux, unter dunklen, schattigen Bäumen. Möchten die Reisenden, wenn sie einen Zweig dieser Cypressen pflücken, um der tugendhaften Schönheit zu huldigen, die Jean Jacques geliebt hat, nicht vergessen, daß sie noch andere Ansprüche an unsre Verehrung hat; sie hat das Alter des biedersten Mannes jener Zeit erleichtert; sie war seine Schülerin; sie hat ihrem Gatten die Theorie der Achtung ihres Geschlechtes eingeflößt, was von dem sanften und bescheidenen Uebergewicht ihres Geistes Zeugniß giebt —. Sie hat noch mehr gethan: sie, die Reiche, die Schöne, die Mächtige, hat begriffen, daß alle Menschen gleiche Ansprüche haben an das Glück, darum laßt uns die Frau verehren, die schön war, wie die Geliebte eines Königs; tugendhaft wie eine Matrone; aufgeklärt wie ein wahrer Philosoph und gütig wie ein Engel.
Eine edle Freundschaft, die verleumdet wurde, wie Alles in der Welt, was natürlich und gut ist, verband Francueil mit seiner Stiefmutter, und dies mußte ihm jedenfalls einen Anspruch mehr an die Liebe und Zuneigung meiner Großmutter geben. Der Verkehr mit einer Stiefmutter, wie die erste Mad. Dupin, und der mit einer Gattin, wie die zweite Mad. Dupin war, müssen über die Jugend und das Alter eines Mannes den Wiederschein eines reinen Lichtes gießen. Was die Männer Gutes oder Böses in der innersten Tiefe ihrer Seele haben, verdanken sie mehr den Frauen als den Männern und in dieser Beziehung könnte man zu ihnen sprechen: „sage mir, wen Du liebst, so werde ich Dir sagen, wer Du bist.“ In der Gesellschaft kann ein Mann die Verachtung der Frauen leichter tragen, als die der Männer. — Aber vor Gott, vor den Urtheilen der Gerechtigkeit, die Alles siebt und Alles weiß, würde ihnen die Verachtung der Frauen weit verderblicher sein. Hier wäre vielleicht der Vorwand zu einer Abschweifung gegeben; ich könnte einige vortreffliche Aussprüche meines Ur-Großvaters Dupin einschalten „über die Gleichstellung des Mannes und des Weibes in den Absichten Gottes und der Ordnung der Natur“ — aber ich werde seiner Zeit ausführlicher in der Geschichte meines Lebens darauf zurückkommen.