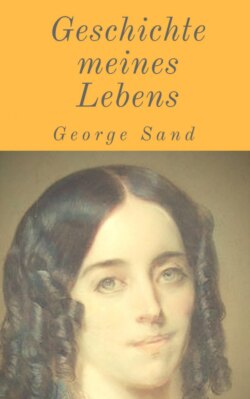Читать книгу Geschichte meines Lebens - George Sand - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Kapitel. Eine Anekdote »on J. J. Rousseau. — Mein Vater Moritz Dupin. — Mein Lehrer Deschartres. — Der Kopf des Pfarrers. — Der Liberalimus vor der Revolution. — Die Haussuchung. — Aufopferung Deschartres' und meines Vaters. — Nerina. —
ОглавлениеDa ich von Jean Jacques Rousseau und meinem Großvater erzählt habe, will ich hier eine Anekdote einschalten, die ich in den Papieren meiner Großmutter Maria Aurora Dupin gefunden habe.
„Ich habe ihn nur ein einziges Mal gesehen, (sie spricht von Jean Jacques) und das werde ich nie vergessen. Er lebte damals schon in jener scheuen Zurückgezogenheit, mit jenem Menschenhaß belastet, der in so grausamer Weise von seinen trägen oder leichtsinnigen Freunden verspottet wurde.
Seit meiner Verheirathung hatte ich Francueil gebeten ihn mir vorzustellen — aber das war nicht leicht. Er ging mehrere Mal zu ihm, ohne vorgelassen zu werden. Eines Tages traf er ihn, wie er die Sperlinge vor seinem Fenster mit Brod fütterte. Er war so traurig, daß er, als sie fortflogen, zu Francueil sagte: „Wissen Sie, was sie jetzt thun? sie setzen sich oben auf's Dach, um Uebles von mir auszuschreien und um zu verkündigen, daß mein Brod nichts taugt.“ —
Ehe ich Rousseau sah, hatte ich in einem Zuge seine neue Heloise gelesen und bei den letzten Seiten fühlte ich mich so zerrüttet, daß ich lautschluchzend weinte. Francueil neckte mich sanft deswegen, ich wollte auch in seine Scherze einstimmen — aber den ganzen Tag, vom Abend bis zum Morgen konnte ich nur weinen. Sobald ich an Juliens Tod dachte, flossen meine Thränen von Neuem; ich wurde ganz krank und häßlich davon.
Während dieser Zeit ging Francueil, der immer fein und liebenswürdig war, zu Rousseau, um ihn zu holen; wie er es anfing, weiß ich nicht, aber er zog ihn fort und brachte ihn mit, ohne mich von seinem Vorhaben zu benachrichtigen.
Jean Jacques hatte sich nur ungern dazu verstanden; er hatte sich weder nach meiner Persönlichkeit noch nach meinem Alter erkundigt und mochte glauben, daß es sich nur darum handle, die Neugier einer Frau zu befriedigen, wozu er sich gewiß nicht willig hergab.
Da ich von nichts benachrichtigt war, so beeilte ich mich nicht sehr mit meiner Toilette. Meine Freundin Mme. d'Esparbés de Lussan war gerade bei mir, eine der liebenswürdigsten und hübschesten Frauen der Welt, obwohl sie etwas schielte und etwas schief war. Sie verhöhnte mich, weil ich mir seit einiger Zeit in den Kopf gesetzt hatte, die Knochenlehre zu studiren; und als sie mir einige Bänder aus einem Schubfache reichen wollte, stieß sie lachend ein lautes Geschrei aus, denn das großes häßliche Skelett einer Hand hing daran.
Francueil war schon zwei oder drei Mal gekommen, um zu fragen, ob ich fertig wäre. Er machte ein Gesicht, wie der Marquis behauptete — ich pflegte Frau von Lussan so zu nennen, und sie nannte mich ihren lieben Baron —. Aber ich bemerkte kein Gesicht an meinem Manne, und hörte nicht auf mich zu putzen. Ich ahnte ja nicht, daß der göttliche Bär in meinem Salon war. Er war mit einer halb blöden, halb grimmigen Miene hineingetreten, hatte sich in einen Winkel gesetzt und kein Verlangen gezeigt, als das, recht bald zu essen, um wieder fortgehen zu können.
Endlich war mein Anzug fertig, und mit rothen geschwollenen Augen ging ich in den Salon hinunter. Ich bemerke einen kleinen, dicken Mann, der ziemlich schlecht gekleidet und sehr verdrießlich ist, sich schwerfällig erhebt und undeutliche Worte murmelt. Ich sehe ihn an und errathe die Wahrheit. Ich schreie, ich will sprechen — aber ich breche in Thränen aus; Jean Jacques ist durch diesen Empfang überrascht und will mir danken — aber er bricht ebenfalls in Thränen aus und Francueil, der uns durch einen Scherz erheitern will, fängt schließlich auch an zu weinen. Wir waren nicht im Stande uns etwas zu sagen; Rousseau drückte mir die Hand, aber er richtete nicht ein einziges Wort an mich.
Wir gingen zu Tisch, um der Rührung ein Ende zu machen, aber ich konnte nichts essen; Francueil hatte keinen Witz und Rousseau stahl sich fort, sobald wir vom Tische aufgestanden waren, ohne ein Wort zu sprechen. Vielleicht war er unzufrieden, sich auf's Neue bewiesen zu sehen, wie sehr er irrte, wenn er sich für den verfolgtesten, gehaßtesten und verleumdetsten aller Menschen hielt.“
Ich hoffe, daß meine Leser mit dieser kleinen Geschichte und mit der Art, wie sie erzählt ist, nicht unzufrieden sein werden. Für eine Frau, die in St. Cyr erzogen war, wo man nicht orthographisch schreiben lernte, ist der Styl nicht übel. Es ist freilich wahr, daß man in St. Cyr statt der Grammatik den Racine auswendig lernte und seine Meisterwerke aufführte. Es ist schade, daß meine Großmutter nicht mehr von ihren Erinnerungen niedergeschrieben hat; was ich besitze, beschränkt sich auf wenige Blätter. Die meiste Zeit ihres Lebens hat sie darauf verwendet, Briefe zu schreiben — die, wie ich wohl sagen darf, denen der Frau von Sévigné gleich stehen — oder zur Nahrung ihres Geistes eine Menge von Auszügen aus ihren Lieblingsbüchern abzuschreiben.
Doch ich kehre zu ihrer Geschichte zurück.
Neun Monate nach ihrer Verheirathung mit Dupin gebar sie einen Sohn, der ihr einziges Kind blieb und in der Taufe, zur Erinnerung an den Marschall von Sachsen, den Namen Moritz erhielt. Sie wollte ihr Kind selbst nähren, was freilich etwas excentrisch war; aber sie gehörte einmal zu denen, die den „Emile“ mit Andacht gelesen hatten und ein gutes Beispiel zu geben wünschten. Ueberdies war ihr mütterliches Gefühl sehr stark entwickelt; es war bei ihr fast eine Leidenschaft, die einzige, die sie jemals kannte.
Aber die Natur widersetzte sich ihrem Begehren. Sie hatte keine Nahrung für ihr Kind. Nachdem sie einige Tage die furchtbarsten Schmerzen ertragen hatte, sah sie ein, daß sie ihm nur ihr Blut geben konnte und verzichtete auf ihren Wunsch, aber es war ihr ein großer Schmerz und sie betrachtete dies wie ein düstres Prognostikon.
Als General-Einnehmer des Herzogthums d'Albret verlebte Dupin einen Theil des Jahres, mit seiner Frau und seinem Sohn, in Chateauroux. Sie bewohnten das alte Schloß, das jetzt als Präfecturlocal benutzt wird, dessen malerische Gebäude den Lauf der Indre beherrschen und die ausgedehnten Wiesen, die sie bewässert. Dupin, der seit dem Tode seines Vaters den Namen Francueil nicht mehr führte, gründete Tuchfabriken in Chateauroux und brachte durch seine Freigebigkeit viel Geld in die Gegend. Er war verschwenderisch, sinnlich und machte einen fürstlichen Aufwand. In seinem Gefolge waren eine Menge Musikanten, Köche, Schmarotzer, Lakaien, Pferde und Hunde. Er spendete Allen mit vollen Händen, für das Vergnügen wie aus Wohlthätigkeit; er wollte glücklich sein, aber auch Alles, was ihn umgab, glücklich machen. Das war eine andere Lebensweise, als die der Finanzmänner und Industriellen unserer Zeit; diese zersplittern das Vermögen nicht in Vergnügungen, oder aus Liebe zur Kunst, oder in den unvorsichtigen Freigebigkeiten einer veralteten aristokratischen Empfindungsweise. Sie folgen den vorsichtigen Grundsätzen ihrer Zeit, wie mein Großvater die leichtfertige Routine seines Zeitalters befolgte. Man möge indessen unsere Zeit nicht mehr als die frühere loben; die Menschen wissen noch immer nicht, was sie thun und was sie thun sollten.
Mein Großvater starb zehn Jahre nach seiner Heirath und ließ eine große Unordnung in seinen Privatangelegenheiten, wie in seinen Geschäften mit dem Staate zurück. Meine Großmutter bewies ihren Verstand, indem sie sich an kluge Rathgeber wendete und Alles mit großer Thätigkeit betrieb. Sie liquidirte gleich, und nachdem sie Alles bezahlt hatte, sowohl den Privatgläubigern wie dem Staate, sah sie sich zu Grunde gerichtet, das heißt im Besitze von 75,000 Livres Renten. [Hier ist eine Notiz, die mir mein Vetter René von Villeneuve gegeben hat. „Das Hôtel Lambert war theils durch unsere Familie, theils durch die liebenswürdige und schöne Prinzessin von Rohan-Chadot, die intime Freundin der Frau von Dupin Chenonceaux, bewohnt. Es war ein wahrer Palast. Herr von Chenonceaux, der Sohn des Herrn Dupin, der undankbare Zögling J. J. Rousseau's, der seit Kurzem mit Fräulein von Rochechouart verheirathet war, verspielte einst in einer Nacht 700,000 Francs. Am folgenden Tage mußte diese Ehrenschuld bezahlt werden. Das Hôtel Lambert wurde verpfändet, andere Güter wurden verkauft. Von allen Kostbarkeiten, von allen berühmten Gemälden ist mir nur ein einziges, sehr schönes Bild von Lessueur geblieben: es stellt drei Musen vor, wovon eine die Baßgeige spielt. Er hat es zwei Mal gemalt, das andere Bild ist im Museum. Herr von Chenoneceaux, unser Großonkel, und unser Großvater Francueil haben zusammen sieben bis acht Millionen durchgebracht. Mein Vater, der mit der Schwester Deines Vaters verheirathet war, war zugleich der Neffe der Frau Dupin von Chenonceaux und ihr einziger Erbe. Daher kommt es, daß ich seit 49 Jahren im Besitze von,Chenonceaux bin.“ Ich werde später erzählen, mit welcher frommen Sorgfalt und mit welchem Verständniß der Kunst Herr und Frau von Villeneuve das Schloß erhalten und wieder eingerichtet haben, das zu den Meisterwerken der Renaissance gehört.]
Die Revolution sollte ihre Mittel bald noch mehr beschränken, und in diesen zweiten Schicksalsschlag wußte sie sich nicht sogleich zu finden. Aber bei dem ersten nahm sie sich muthig zusammen, und obwohl ich nicht begreife, wie man mit 75,000 Livres Renten sich nicht für ungeheuer reich halten kann, muß ich ihr nachsagen, daß sie diese „Armuth“ mit großer Kraft und Ergebung hinnahm. Sie folgte hierbei einem Princip der Ehre und Würde, das tief in ihrer Natur lag, während sie in den Confiscationen der Revolution nie etwas Anderes sah, als Raub und Diebstahl.
Nachdem sie Chateauroux verlassen hatte, bewohnte sie eine kleine Wohnung in der Rue du Roi de Sicile, in welcher aber noch ziemlich viel Raum sein mußte, wenn ich nach der Menge und dem Umfange der Meubles urtheile, die jetzt mein Haus enthält. Die Erziehung ihres Sohnes vertraute sie einem jungen Manne, den ich alt gekannt habe, und der auch mein Lehrer gewesen ist. Diese Persönlichkeit, die zugleich ernst und komisch ist, nimmt einen zu großen Platz in der Geschichte unserer Familie und in unsern Erinnerungen ein, um ihrer nicht besonders zu gedenken.
Er hieß Francis Deschartres, und da er als Lehrer im Colleg des Cardinal Lemoine das Bäffchen getragen hatte, erschien er bei meiner Großmutter mit der Kleidung und dem Titel eines Abbé. Aber in der Revolution, die sich mit allen Titeln zu schaffen machte, verwandelte sich der Abbé Deschartres vorsichtigerweise in den Bürger Deschartres. Unter dem Kaiserreich wurde er Herr Deschartres, Maire des Dorfes Nohant; unter der Restauration hätte er gern seinen alten Titel wieder hervorgesucht, denn in seiner Vorliebe für die Formen der Vergangenheit war er sich gleichgeblieben. Aber er war niemals ordinirt und konnte sich überdies nicht mehr von einem Beinamen befreien, den ich ihm wegen seiner Rechthaberei und seiner wichtigen Miene gegeben hatte; er wurde nie mehr anders genannt, als der große Mann.
Er war ein hübscher Bursche gewesen, und war es noch, als ihn meine Großmutter zu sich berief: er war wohlgekleidet, wohlrasirt, hatte ein lebhaftes Auge, pralle Waden und überhaupt einen vortrefflichen Hauslehrer-Anstand. Aber ich bin überzeugt, daß ihn auch in seiner besten Zeit Niemand ansehen konnte ohne zu lachen, weil das Wort Pedant in jeder Linie seines Gesichts und in jeder Bewegung seines Körpers auf das Deutlichste ausgedrückt war.
Zu seiner Vervollständigung hätte gehört, daß er unwissend, unmäßig und feig gewesen wäre; aber er war im Gegentheil sehr gelehrt, sehr mäßig und tapfer fast bis zur Tollkühnheit. Er hatte alle großen Eigenschaften der Seele, verbunden mit einer unausstehlichen Gemüthsart und einer Selbstzufriedenheit, die bis zum Wahnsinn ging. Er hatte die entschiedensten Meinungen, die eckigsten Manieren, die arroganteste Ausdrucksweise. Aber wie war er aufopferungsfähig und diensteifrig, wie groß und edel war seine Seele! Guter großer Mann, ich habe Dir alle Deine Quälereien verziehen, verzeihe auch mir in jenem Leben alle tollen Streiche, die ich Dir gespielt habe, alle Possen, mit denen ich mich für Deine niederdrückende Tyrannei zu rächen suchte! ich habe wenig von Dir gelernt, aber ich verdanke Dir etwas, was mir schon oft von Nutzen gewesen ist — nämlich die Fähigkeit, trotz der Regungen meines Unabhängigkeits-Gefühles, die unerträglichsten Charaktere und die impertinentesten Meinungen lange ertragen zu können.
Als ihm meine Großmutter die Erziehung ihres Sohnes vertraute, ahnte sie gewiß nicht, daß sie in dem Tyrann den Retter und besten Freund ihres Lebens gefunden hatte.
In seinen Freistunden pflegte Deschartres Vorlesungen über Physik, Chemie, Medicin und Chirurgie zu hören. Er war ein eifriger Schüler Desault's und erlangte unter der Leitung dieses bedeutenden Mannes eine große Geschicklichkeit in chirurgischen Operationen. Später, als er Pächter meiner Großmutter und Maire des Dorfes war, wurden seine Kenntnisse der ganzen Umgegend sehr nützlich, um so mehr, da er sie nur aus Barmherzigkeit, ohne irgend welchen Lohn zu begehren, in Anwendung brachte. Er war so gutherzig, daß ihn weder Finsterniß noch Unwetter, weder Hitze noch Kälte, noch ungelegne Zeit verhindern konnten die verlangte Hülfe zu gewähren, wenn er auch noch so weit und durch noch so schlechte Wege zu wandern hatte. Seine Aufopferung und seine Uneigennützigkeit waren in der That bewunderungswürdig; aber er mußte nun einmal in allen Augen ebenso lächerlich als groß sein, und so trieb er es so weit, daß er seine Patienten schlug, wenn sie ihn nach überstandener Krankheit bezahlen wollten. In Betreff der Geschenke nahm er ebensowenig Vernunft an, und ich habe mehr als zehn Mal gesehen, daß er einen armen Teufel die Treppe hinunter warf, indem er ihn mit den Enten, Putern oder Hasen, die er ihm gebracht hatte, tüchtig durchprügelte. Die armen, mißhandelten Leute gingen dann mit schwerem Herzen fort und klagten: „daß der gute, liebe Herr so bösartig wäre“ — ein Anderer betheuerte im höchsten Zorn: „das ist ein Kerl, den ich todtschlüge, wenn er mir nicht das Leben gerettet hätte.“ Und Deschartres stand oben an der Treppe und schrie mit Stentorstimme: „was, Du Canaille, Du Dummkopf, Du Tölpel, Du Taugenichts! ich habe Dir Gutes gethan und nun willst Du mir nicht dankbar bleiben? Du willst mich ablohnen? Wenn Du nicht machst, daß Du fortkommst, so schlage ich Dich, daß Du vierzehn Tage im Bette liegen sollst — dann wirst Du mich wohl wieder rufen lassen.“
Darum war der arme große Mann trotz seiner Wohlthaten ebenso gehaßt wie geachtet, und seine Heftigkeit zog ihm manches böse Zusammentreffen zu, von dem er nicht gern erzählte. Die Bauern in Berry sind geduldig bis zu einen, gewissen Grade, und man thut sehr wohl, diese Grenze nicht zu überschreiten.
Aber ich greife immer wieder dem Laufe der Begebenheiten in meiner Erzählung vor, und bitte deswegen um Verzeihung. Wenn ich jetzt in Bezug auf die anatomischen Studien des Abbé Deschartres einen Vorfall berichte, der gerade nicht zu den heitern gehört, lasse ich mir wieder einen Anachronismus von einigen Jahren zu schulden kommen; aber meine Erinnerungen drängen sich oft in etwas verworrener Weise zu und verlassen mich dann wieder, so daß ich fürchten müßte, ganz und gar zu vergessen, was ich auf den folgenden Tag verschöbe.
Obwohl der Abbé Deschartres unter der Schreckensherrschaft meinen Vater und die Interessen meiner Großmutter aus das Sorgfältigste überwachte, wurde er durch seine Vorliebe immer noch von Zeit zu Zeit in Spitäler und Sectionssäle geführt. Es gab damals zwar genug blutige Schauspiele im wirklichen Leben, aber die Liebe zur Wissenschaft hinderte den Abbé philosophische Betrachtungen über die Leichen anzustellen, die von der Guillotine zur Anatomie geschickt wurden. Eines Tages jedoch hatte er eine kleine Gemüthsbewegung, die ihn sehr in seinen Beobachtungen störte. Einer der Eleven, der die Sachen leicht nahm, hatte mit den Worten: „sie sind frisch abgeschnitten“, mehrere Köpfe auf den Secirtisch gelegt. Ein gräßlicher Kessel war bereit, sie aufzunehmen, um sie durch Kochen zum Skelettiren vorzubereiten. Deschartres nahm die Köpfe, einen nach dem andern, und that sie hinein. „Hier ist der Kopf eines Geistlichen“, sagte der junge Mann, indem er ihm den letztern reichte; „er trägt die Tonsur“. Deschartres sieht ihn an und erkennt das Gesicht eines Freundes, den er seit vierzehn Tagen nicht gesehen hatte und von dem er nicht wußte, daß er gefangen war. Er hat mir diesen schrecklichen Vorfall selbst erzählt. „Ich sagte kein Wort, indem ich diesen armen Kopf mit den weißen Haaren betrachtete; das Antlitz war noch ruhig und schön und schien mir zuzulächeln. Ich wartete, bis der Eleve sich abwendete, um einen Kuß auf diese Stirn zu drücken, dann legte ich das Haupt in den Kessel zu den andern. Ich habe es dann für mich skelettirt und habe es lange besessen; aber es kam eine Zeit, wo diese Reliquie zu gefährlich wurde und da habe ich sie in einer Ecke des Gartens begraben. Dieser Zufall erschütterte mich übrigens so sehr, daß ich lange Zeit unfähig war, mich mit der Wissenschaft zu beschäftigen.“
Doch laßt uns schnell zu lustigern Geschichten übergehen.
Mein Vater lernte sehr schlecht; aber Deschartres wagte nicht, ihn zu züchtigen, denn obgleich er ein eifriger Anhänger der alten Methode, der Ruthe und des Stockes war, so machte ihm doch die übergroße Liebe meiner Großmutter für ihren Sohn alle durchgreifenden Mittel unmöglich. Er versuchte nun durch Eifer und Beharrlichkeit das Prügelsystem zu ersetzen, das seiner Meinung nach der mächtigste Hebel des Verstandes gewesen wäre. Er theilte mit seinem Zögling allen Unterricht, den er nicht selbst geben konnte, wie deutsche Sprache, Musik, und machte sich zu seinem Repetitor in Abwesenheit der Lehrer. Er ging in der Aufopferung so weit, daß er Fechtstunde nahm, um die Ausfälle mit ihm einzuüben. Mein Vater, der zu jener Zeit von schwacher Gesundheit und etwas träge war, pflegte auf dem Fechtboden aus seiner Erschlaffung aufzuwachen, aber wenn sich Deschartres hineinmischte, der arme Deschartres, der die Gabe hatte, die interessantesten Dinge langweilig zu machen, fing das Kind wieder an zu gähnen und schlief fast stehend ein.
„Herr Abbé,“ sagte er ihm eines Tages mit kindlicher Unbefangenheit, „wird es mir mehr Vergnügen machen, wenn ich mich ernsthaft schlage?“ — „Ich glaube nicht, mein Freund,“ antwortete Deschartres, aber er irrte sich; mein Vater hatte früh kriegerische Neigungen und selbst eine Leidenschaft für den Kampf. Nie fühlte er sich so wohl, so ruhig und so sanft bewegt, als wenn er mit der Cavalerie zum Angriff eilte.
Aber dieser tapfre Mann war ein schwächliches, entsetzlich verzogenes Kind, das buchstäblich in Baumwolle aufgezogen wurde; und als er beim raschen Wachsen etwas leidend war, gestattete man ihm, sich seiner Indolenz insoweit hinzugeben, daß er den Bedienten klingelte, um ihm einen Bleistift oder eine Feder aufzunehmen. Er änderte sich gänzlich, Gott sei Dank! und als Frankreich an seine Grenzen eilte, war er immer einer der Ersten, die mit fortgerissen wurden und seine rasche Umwandlung war ein Wunder mehr unter den Tausenden.
Als die Revolution zu drohen begann, sah meine Großmutter, wie alle aufgeklärten Aristokraten ihrer Zeit, ihr Herannahen ohne Furcht. Sie war zu sehr mit Voltaire's und Rousseau's Geist genährt, um die Mißbräuche des Hofes nicht zu hassen und sie gehörte sogar zu den glühendsten Gegnern der Coterie der Königin. Unter ihren Papieren habe ich Mappen voll Verse, Madrigals und beißende Satyren gegen Maria Antoinette und ihre Günstlinge gefunden. Die vornehme Welt schrieb diese Pasquille ab und verbreitete sie. Die feinern sind von der Hand meiner Großmutter geschrieben und vielleicht sind sie ihr Machwerk, denn es gehörte zum guten Ton, einige Epigramme gegen die Skandalosa des höchsten Kreises zu schleudern und es war die geistige Opposition jener Zeit, die sich in diese ganz französischen Formen hüllte. Es waren zum Theil sehr gewagte und sehr sonderbare Dinge; über die Geburt des Dauphin, über die Verschwendungen und Galanterien der „Deutschen“ legte man dem Volke unerhörte Lieder in den Mund, die in der Sprache der Hallen verfaßt waren; man ging so weit, Mutter und Kind mit der Peitsche und dem Schandpfahl zu bedrohen. Und man glaube nicht etwa, daß diese Lieder aus dem Volke hervorgingen; sie stiegen aus dem Salon in die Straßen hinab. Ich habe Gedichte verbrannt, deren Anhalt so obscön war, daß ich nicht gewagt haben würde, sie bis zu Ende zu lesen und die, von Abbés geschrieben, die ich in meiner Jugend gekannt habe, und aus dem Kopfe vornehmer Edelleute hervorgegangen, mir keinen Zweifel über den tiefen Haß und die wahnsinnige Entrüstung der Aristokratie jener Zeit gelassen haben. Ich glaube, daß selbst, wenn das Volk sich nicht geregt hätte, die Familie Ludwig's XVI. das gleiche Schicksal gehabt haben würde, ohne zum Ruhm des Märtyrerthums zu gelangen.
Uebrigens bedaure ich sehr, daß ich mich in meinem zwanzigsten Jahre durch einen Anfall von Prüderie dazu bringen ließ, die meisten dieser Manuscripte zu verbrennen. Da sie von einem so keuschen, so erhabenen Wesen, wie meine Großmutter herrührten, verletzten sie meine Augen; und doch hätte ich mir sagen müssen, daß es historische Dokumente waren, die vielleicht einen bedeutenden Werth besaßen. Mehrere waren vielleicht einzig in ihrer Art oder doch höchst selten. Die, welche ich behalten habe, sind bekannt und schon in mehreren Werken angeführt.
Ich glaube, daß meine Großmutter eine bedeutende Verehrung für Necker und Mirabeau fühlte; aber ich verliere die Spur ihrer politischen Meinungen mit dem Augenblicke, wo die Revolution für sie selbst ein niederschmetterndes Ereigniß und ein persönliches Unglück wird.
Unter allen ihren Standesgenossen war sie vielleicht am wenigsten darauf gefaßt, von den Folgen dieser großen Katastrophe getroffen zu werden. Wie hätte sie auch ihr Bewußtsein daraus hinweisen sollen, daß sie, als Theil des Ganzen verdient haben könnte, der allgemeinen Buße mit unterworfen zu werden. So weit es sich mit ihrer Stellung vertrug, hatte sie den Glauben der allgemeinen Gleichheit angenommen. Sie hatte das Verständniß aller freisinnigen Ideen ihrer Zeit. Sie war einverstanden mit Rousseau's „Gesellschaftsvertrag“, sie haßte den Aberglauben wie Voltaire; sie konnte sich selbst für großherzige Schwärmereien erwärmen; das Wort Republik enthielt nichts Schreckliches für sie. Von Natur war sie liebevoll, hülfreich, leutselig und sie sah ihres Gleichen auch in jedem niedrigen und unglücklichen Menschen. Wenn die Revolution ohne Gewaltthaten und Irrthümer fortgeschritten wäre, würde sie ihr, ohne Bedauern und ohne Furcht, bis an's Ende gefolgt sein; denn sie war eine große Seele und hatte ihr Leben lang die Wahrheit gesucht und geliebt.
Aber um die unvermeidlichen Kämpfe, die mit solcher Ungeheuern Umwälzung verbunden sind, freudig hinzunehmen, müssen wir mehr als rein, mehr als gerecht sein; wir müssen das Reich Gottes mit Begeisterung, mit Heldenmuth, mit Fanatismus sogar anstreben. „Der Eifer für sein Haus muß uns verzehren“, wenn wir die Einwirkungen und den Anblick der schrecklichen Einzelnheiten der Krisis ertragen sollen. Jeder von uns ist fähig, sich zu einer Amputation zu entschließen, wenn es sich um die Erhaltung des Lebens handelt, aber wenige sind im Stande, unter Folterqualen zu lächeln.
In meinen Augen ist die Revolution eine der thätigen Phasen des christlichen Lebens; eines Lebens, das zu gewissen Stunden stürmisch, blutig, schrecklich, voll Convulsionen, Wahnsinn und Verzweiflung ist. Es ist der heftige Kampf der Gleichheitslehre, die Jesus verkündigt hat — der Lehre, die bald wie eine strahlende Kerze, bald wie eine glühende Fackel von Hand zu Hand geht, bis in unsre Tage; um zu streiten gegen die alte heidnische Welt, die nicht zerstört ist, und noch lange nicht zerstört sein wird, trotz der Sendung des Heilandes und anderer göttlicher Missionen — trotz so vieler Scheiterhaufen, so vieler Schaffotte und so vieler Märtyrer. Aber die Geschichte der Menschheit besteht aus so vielen unvorhergesehenen, sonderbaren, geheimnißvollen Ereignissen; die Pfade der Wahrheit verzweigen sich mit so manchem wunderbaren, unerforschten Wege; die Dunkelheit breitet sich so oft und so dicht über diese ewige Pilgerschaft aus; der Sturm zerstört so hartnäckig die Wegweiser der Straßen, von der Inschrift, die in den Sand gezeichnet ist, bis zu den Pyramiden; so mancher unheimliche Schein erschreckt die bleichen Reisenden und führt sie in die Irre, daß wir uns nicht wundern dürfen, wenn wir noch keine wahrhafte und bestätigte Geschichte erlangt haben und noch immer in einem Labyrinth von Zweifeln irren. Die Ereignisse von gestern sind so dunkel für uns, als die Epopöen der fabelhaften Zeiten und man beginnt erst heute durch ernste Forschungen etwas Licht in dies Chaos zu tragen.
Wie dürften wir also über diesen Schwindel erstaunen, der sich aller Geister bemächtigte, als Frankreich in die unlösbaren Wirren des Jahres 93 verfiel? Wie hätte die Leidenschaft sich dem Kampfe entziehen, wie die Unparteilichkeit die Urtheile sprechen sollen, als überall Wiedervergeltung geübt wurde, als ein Jeder, der That oder der Absicht nach, eins um's andere zum Opfer und zum Henker wurde und zwischen der erlittenen und geübten Bedrückung weder Zeit zur Ueberlegung noch zur freien Prüfung war? Die Leidenschaft des Einen wurde durch die des Andern gerichtet und das Menschengeschlecht rief, wie zur Zeit der Hussiten: „Jetzt sind die Tage der Trauer, des Eifers und der Wuth.“
Welcher Glaube wäre also erforderlich gewesen, um sich freudig zu entschließen, mit Recht oder Unrecht zum Märtyrer dieses Fortschrittsprincipes zu werden? — und mit Unrecht zum Opfer zu werden, durch einen jener Fehlgriffe, welche zur Zeit des Sturmes unvermeidlich sind, das war am schwersten zu ertragen! denn dem Glauben fehlte das nöthige Licht und die Atmosphäre des Lebens war zu sehr getrübt, als daß sich die Sonne dem Bewußtsein des Einzelnen gezeigt hätte. Und doch wurden alle Klassen der Gesellschaft durch diese revolutionäre Sonne erleuchtet bis zur Zeit der Nationalversammlung. Maria Antoinette, das bedeutendste Haupt der Contre-Revolution von 92, war in ihrem Innern und für ihren persönlichen Nutzen ebenso revolutionär, wie es heutzutage Isabella auf dem spanischen Thron ist, wie es Victoria von England sein würde, wenn sie zwischen dem Absolutismus und ihrer persönlichen Freiheit zu wählen hätte. Die Freiheit wurde von Allen gerufen, von Allen mit Leidenschaft, mit Wuth begehrt und die Könige verlangten sie ebenso gut für sich selbst, wie das Volk.
Aber dann kamen die, welche sie für Alle begehrten, und welche durch den Zusammenstoß der Leidenschaften verhindert wurden, sie irgend Einem zu geben.
Sie versuchten es — und Gott möge ihnen die Mittel verzeihen, zu deren Anwendung sie sich getrieben sahen. Wir, für die sie gearbeitet haben, besitzen nicht das Recht, sie von der Höhe unserer unfruchtbaren Unthätigkeit zu verurtheilen. [Geschrieben 1847.]
Uebrigens müssen wir bekennen, daß es in diesem blutigen Heldengedichte, in welchem jede Partei die Ehre und das Verdienst des Märtyrerthums für sich in Anspruch nimmt, auf beiden Seiten Märtyrer gegeben hat. Die Einen haben für die Vergangenheit gelitten, die Andern für die Sache der Zukunft. Noch Andere, die auf der Grenze beider Parteien standen, haben gelitten, ohne zu begreifen, aus welchem Grunde sie gezüchtigt wurden. Hätte die Reaction gesiegt, so wären sie durch die Männer der Vergangenheit verfolgt, wie sie durch die der Zukunft verfolgt wurden.
In dieser sonderbaren Lage befand sich die edle, reine Frau, deren Geschichte ich hier mittheile. Es war ihr gar nicht eingefallen zu emigriren. Sie fuhr ruhig fort, ihren Sohn zu erziehen und versenkte sich in diese heilige Aufgabe.
Sie hatte sich sogar darein ergeben, ihre Hülfsmittel durch die allgemeine Krisis verringert zu sehen und mit den Ueberresten von dem, was sie „die Trümmer ihres Vermögens“ nannte, hatte sie für etwa 300,000 Franks das Gut Nohant bei Chateauroux gekauft, weil ihre Verbindungen und Gewohnheiten sie im Berry fesselten.
Sie war gerade im Begriff, sich in diese friedliche Provinz zurückzuziehen, in welcher sich die Leidenschaften der Zeit noch nicht fühlbar machten, als sie durch ein unvorhergesehenes Ereigniß hart getroffen wurde.
Sie bewohnte damals das Haus eines Rentzahlmeisters Amonin, dessen Wohnung, wie die aller wohlhabenden Leute jener Zeit, mehrere Verstecke enthielt. Herr Amonin schlug ihr vor, hinter einem Fach des Getäfels eine Menge Silberzeug und Kleinodien zu verwahren, die theils ihr, theils ihm gehörten. Außerdem verbarg auch ein Herr von Villiers seine Adelsbriefe an demselben Orte.
Aber diese „Verstecke“, die auf geschickte Weise in der Dicke der Mauern angebracht waren, konnten den Untersuchungen nicht entgehen, welche oft von denselben Arbeitern geleitet wurden, die sie eingerichtet hatten und sie nun zuerst verriethen. Am 5. Frimaire des zweiten Jahres der Republik (26. Novbr. 1793) wurde — auf Grund eines Erlasses, der das Verbergen solcher, dem Verkehr entzogener Kostbarkeiten untersagte — bei Herrn Amonin eine Haussuchung gehalten.
[Der Inhalt dieses Decrets, dessen Zweck war, durch Schrecken das Vertrauen wiederherzustellen, ist folgender:
»Art. I. Alles Gold und Silber, es mag gemünzt oder ungemünzt sein, alle Diamanten, Kostbarkeiten, Gold- und Silbertressen, und alle wertlwollen Geräthe oder Sachen, die man in der Erde vergraben, oder in Kellern, im Innern der Mauern, unter dem Dache, unter den Fußböden, in den Kaminwänden oder Röhren oder an andern Orten versteckt gefunden hat oder finden wird, sollen zum Besten der Republik weggenommen und confiscirt werden.
Art. II. Jeder Angeber, der zur Entdeckung solcher Gegenstände führt, erhält den zwanzigsten Theil des Werthes in Assignaten.
Art. VI. Das Gold und Silber, das Silberzeug, die Schmuckgegenstände u.s.f. werden sogleich mit einem Inventarium dem Comité der Stadtinspectoren überliefert und dieses sendet alles Gold sofort an die National-Schatzkammer, und alles Silberzeug in die Münze.
Schmucksachen, Meubles und andere Gegenstände werden unter Aufsicht desselben Comités meistbittend verkauft und der Ertrag wird der National Schatzkammer überwiesen, die dem Convent Rechenschaft abzulegen hat (23. Brumaire, Jahr II d. R.).“]
Ein geschickter Tischler besichtigte die Lambris, Alles wurde entdeckt; meine Großmutter wurde eingezogen und in das Kloster des Anglais rue des Fossés St. Victor gebracht, das zum Arrestlocale eingerichtet war. [In demselben Kloster hatte sie einen Theil ihrer freiwilligen Zurückgezogenheit vor ihrer zweiten Verheirathung zugebracht.] In ihrer Wohnung wurden Siegel angelegt und diese, sowie die confiscirten Gegenstände der Obhut des Bürgers und Corporals Leblanc anvertraut. Dem jungen Moritz (meinem Vater) wurde erlaubt, in seinen Zimmern zu bleiben, die einen besondern Eingang hatten und die Deschartres mit ihm bewohnte.
Der junge Dupin, der damals kaum fünfzehn Jahre alt war, wurde durch diese Trennung wie von einem Keulenschlage getroffen; da auch sein Geist mit Voltaire und Rousseau genährt war, konnte er auf solche Vorfälle nicht vorbereitet sein. Man suchte ihm die Gefahr der Verhältnisse zu verbergen und der wackre Deschartres verschwieg seine Besorgnisse, obwohl er fühlte, daß Madame Dupin verloren wäre, wenn ihm ein Unternehmen nicht gelang, zu dem er sich ohne Zögern entschloß und das er mit ebenso viel Glück als Muth vollbrachte.
Er wußte, daß sich unter den aufgefundenen Gegenständen einige sehr verdächtigende befanden, die bei der ersten Prüfung übersehen waren. Es waren Papiere, Akten, Briefe, welche bezeugten, daß sich meine Großmutter an einer freiwilligen Anleihe zu Gunsten des emigrirten Grafen von Artois, der später als Karl X. zur Regierung kam, betheiligt hatte. Ich weiß nicht, welche Gründe oder Einflüsse sie zu dieser Handlung bestimmt hatten; vielleicht war es der Anfang einer Reaction gegen die revolutionären Ideen, mit denen sie, bis zur Einnahme der Bastille energisch Schritt gehalten hatte. Vielleicht war sie auch durch exaltirte Rathschläge, oder durch eine geheime Regung ihres Familienstolzes dazu veranlaßt. Denn, trotz des Querbalkens der Bastarde, war sie die Cousine Ludwig's XVI. und seiner Brüder und mochte glauben, diesen Prinzen ein Almosen schuldig zu sein, obwohl sie von ihnen, nach dem Tode der Kronprinzessin, im Elende gelassen war. Ich bin überzeugt, daß sie keinen andern Beweggrund hatte, und daß sie die Summe von 75,000 Livres, die in ihren Verhältnissen ein bedeutendes Opfer war, nicht wie so viele Andere, als ein Kapital betrachtete, das ihr in der Zukunft Gunst und Lohn eintragen sollte. Sie sah im Gegentheil schon in jener Zeit die Sache der Prinzen als eine verlorne an und fühlte weder für den arglistigen Charakter Monsieurs (Ludwig XVIII.), noch für das schamlose, sittenlose Leben des nachmaligen Königs Karl X. Achtung oder Zuneigung. Sie hat mir, als Napoleon fiel, von dieser jämmerlichen Familie erzählt und ich erinnere mich ihrer Aeußerungen auf das Genaueste; aber ich will den Ereignissen nicht vorgreifen und bemerke hier nur, daß es ihr nie in den Sinn kam, aus der Restauration irgend einen Vortheil zu ziehen, indem sie ihr Geld von den Bourbonen zurückverlangt — oder für einen Dienst, der sie beinahe auf's Schaffot brachte — irgend welche Entschädigung begehrt hätte.
Mochten nun die Papiere in einem besondern Verstecke, das man nicht untersucht hat, verborgen gewesen sein, oder mochten sie, mit denen des Herrn von Villiers vermischt, bei der ersten Durchsicht der Aufmerksamkeit des Commissärs entgangen sein, gewiß ist, daß sie in dem Protokoll der Haussuchung nicht verzeichnet waren und Deschartres hatte nun die Aufgabe, sie der zweiten Prüfung, die bei der Abnahme der Siegel stattfinden mußte, zu entziehen. Und Deschartres zögerte nicht, obwohl er Freiheit und Leben dabei wagte.
Doch um die Verhältnisse und die Größe dieses Entschlusses in's rechte Licht zu stellen, wird es zweckmäßig sein, daß ich das Protokoll der Haussuchung einschalte. Es trägt ein ganz besonderes Gepräge und ich werde seine Ausdrucksweise auf das Getreueste wiedergeben:
„Die vereinigten revolutionären Comités der Sectionen von Bon-Conseil und Bondy.
„Am heutigen Tage, den 5. Frimaire des II. Jahres der einen, untheilbaren Republik, wir, Jean-François Posset und François Mary, Commissarien des revolutionären Comités der Section von Bon-Conseil, haben uns nach dem revolutionären Comité der Section von Bondy begeben, um die Mitglieder der besagten Comités aufzufordern, sich mit uns in die Wohnung des Bürgers Amonin, Rentzahlmeister, wohnhaft rue Nicolas Nr.12 zu begeben; und hierauf sind die Bürger Christophe und Gérôme, Mitglieder der Section Bondy und item der Bürger Filoy mit uns gegangen und wir haben uns in genannte Wohnung begeben, wo wir hineingegangen sind, und sind in die zweite Etage hinaufgestiegen, und sind in ein Zimmer eingetreten und von da in ein Toilettezimmer, wo drei Schritte hinunterzusteigen sind, begleitet von der Bürgerin Amonin, weil ihr Mann nicht anwesend war; und wir haben sie befragt: ob nichts bei ihr verborgen wäre und sie hat erklärt nichts davon zu wissen. Und darauf ist die genannte Amonin ohnmächtig geworden und hat die Besinnung verloren. Nachher haben wir die Nachsuchungen fortgesetzt, und haben den Bürger Villiers, der sich in dem genannten Hause befand und wohnhaft ist: rue Montmartre Nr. 21, Section Brutus, aufgefordert, bei unsern Nachsuchungen Zeuge zu sein, was er gethan hat, sowie der Bürger Gondois, item aus demselben Hause. Und dann sind wir zum Oeffnen übergegangen, durch die Talente des Bürgers Tatey, wohnhaft rue du faubourg St. Martin Nr. 90, und außerdem in Gegenwart des Bürgers Froc, Portier besagten Hauses, alle anwesend bei Oeffnung des Getäfels, das zu einem Schranke führt, der Thür zur Rechten gegenüber. Und darauf haben wir eine Oeffnung gemacht, um zu sehen, was sich im besagten Getäfel befindet und sowie die Oeffnung gemacht war, immer im Beisein der Genannten, haben wir eine Menge Silberzeug, mehrere Kasten und Papiere entdeckt und darauf haben wir ein Verzeichniß davon gemacht, im Beisein der oben Genannten: 1) ein Degen mit Stahl-Verzierungen; 2) eine Stutzbüchse; 3) ein Kasten von Saffian, enthaltend Löffel, Zuckerschaufeln, Senflöffel mit Vergoldung und Wappen u. s. w. ...
Nun folgt ein Verzeichniß, in welchem alle mit Wappen verzierten Gegenstände besonders bemerkt sind, da dies, wie Jedermann weiß, zu den Hauptvergehen gehörte.
Und darauf ist der Bürger Amonin gekommen und wir haben ihm befohlen, bei uns zu bleiben, um bei der Fortsetzung des Protokolles Zeuge zu sein.
Und darauf haben wir mehrere Briefe gelesen, die an den Bürger Villiers, Beamten der National-Versammlung adressirt waren; besagter Villiers, der in Abwesenheit des Bürgers Amonin als gegenwärtig genannt wurde, hat uns erklärt, daß diese Briefe ihm gehören, sowie auch der Briefwechsel, den wir in das weiße Buch gewickelt gefunden haben, und der besagte Bürger Amonin hat uns erklärt, er wisse nicht, daß dies hier liege und hatte keine Kenntniß davon, was der Bürger Villiers bestätigt hat. Darauf haben wir den Bürger Amonin aufgefordert, uns zu erklären, seit wann das besagte Silberzeug und Schmucksachen da versteckt wären und hat erklärt: sie wären da gewesen zur Zeit, als der ehemalige König nach Varennes entfloh.
Haben ihn gefragt, ob besagtes Silberzeug und Schmuck ihm gehörten; hat geantwortet, daß ein Theil ihm gehörte und der andere Theil der Bürgerin Dupin, welche unter ihm in der ersten Etage wohnte.
Darauf haben wir die Bürgerin Dupin vorgefordert, zu dem Behufe, uns ein Verzeichniß des Silberzeugs zu geben, das sie bei dem Bürger Amonin versteckt hätte, was die Bürgerin gleich gethan hat. Und darauf sind wir zur Prüfung der Briefe und ihres Inhaltes übergegangen, immer im Beisein des Bürgers Villiers, unter welchen Briefen wir bei der Durchsicht die Abschrift von Adelsbriefen und Wappen gefunden haben, welche wir versiegelt haben mit einem Petschaft in Form eines gegitterten Herzens und einem Petschaft, welches der Uhrschlüssel eines genannten Commissärs bildet; das Ganze eingeschlagen in ein Blatt weißes Papier, damit besagte Briefe geprüft werden durch den Wohlfahrtsausschuß und durch ihn befohlen werden kann, was damit vorzunehmen. Und darauf haben wir uns aller besagten Silbersachen und Schmucksachen, wie aus dem Protokoll hervorgeht, bemächtigt, damit nach den Worten des Gesetzes geschehen kann, was zukommt, und haben geschlossen das gegenwärtige Protokoll den 6. Frimaire um zwei Uhr.“
Es geht daraus hervor, daß diese Nachsuchungen größtentheils bei Nacht und gleichsam wie ein Ueberfall vorgenommen wurden, denn dieses Protokoll ist am 5. begonnen und am 6. um zwei Uhr Morgens geschlossen. Die Commissarien beschließen darauf sogleich Herrn von Villiers festzunehmen, dessen Vergehen ihnen wahrscheinlich als das bedeutendste erschien; sie verfügen jedoch nichts über meine Großmutter und ihren Mitschuldigen, Amonin, versiegeln aber die Koffer, Kasten und Schachteln mit Schmuck und Silbersachen: „um, im Lauf des Tages der National-Versammlung übergeben zu werden und unterdessen in der Verwahrung und unter Verantwortung des Bürgers und Corporals Leblanc zu bleiben, um durch ihn auf das erste Verlangen ganz und wohlbehalten abgeliefert zu werden und er hat erklärt nicht schreiben zu können.“
Es scheint, als wären die Hausgenossen durch dies Ereigniß nur wenig beunruhigt. Sie glaubten wahrscheinlich, daß die Gefahr bereits vorüber wäre und erwarteten die confiscirten Gegenstände wiederzubekommen (aus den Randbemerkungen, mit welchen Deschartres das Protokoll versehen hat, geht hervor, daß ein großer Theil der Sachen unbeschädigt zurückgegeben wurde), außerdem war meiner Großmutter das Vergehen der„Vergrabung“ nicht bewiesen. Sie hatte die gefundenen Gegenstände Herrn Amonin geliehen oder anvertraut, und dieser hatte für nöthig erachtet, sie zu verbergen: dies war ihr Vertheidigungssystem und man glaubte damals nicht, daß die Verhältnisse eine Wendung nehmen könnten, die jede Vertheidigung unmöglich machte. So hatte man auch die Unvorsichtigkeit, jene gefährlichen Papiere, von denen ich oben gesprochen habe, in einem Möbel des zweiten Entresol zu lassen.
Am 13. Frimaire, also sieben Tage nach der ersten Haussuchung bei Amonin fand daselbst eine zweite statt und zwar dieses Mal in der Wohnung meiner Großmutter, gegen welche ein Verhaftsbefehl erlassen war. Ein neues, kürzeres und weniger blumenreiches Protokoll wurde aufgenommen.
„Am 3. Frimaire des II. Jahres der einen, untheilbaren französischen Republik, wir, Mitglieder des Ueberwachungs-Comités der Section Bondy, kraft des Gesetzes und eines Beschlusses des genannten Comités, datirt vom 11. Frimaire und befehlend, daß bei Maria Aurora, verwittwete Dupin versiegelt werden und die genannte Bürgerin in Haft gebracht werden soll. Zu diesem Ende haben wir uns in ihre Wohnung, rue St. Nicolas 12 begeben; sind in die erste Etage gegangen in die Thüre zur Linken. Dort angekommen haben wir der Genannten unsern Auftrag mitgetheilt und haben an die Fenster und Thüre besagter Wohnung die Siegel gelegt, wie auch an die Thüre, welche nach der Treppe führt, zehn an der Zahl; welche Siegel wir unter Aufsicht des Karl Froc, Portier des genannten Hauses, gelassen haben, der sie nach geschehener Vorlesung besichtigt und erkannt hat.“
„Und darauf haben wir uns in die gegenüberliegende Thüre auf genanntem Flur begeben, welche bewohnt wird durch den Bürger Moritz Franz Dupin, Sohn der genannten Wittwe und durch den Bürger und Lehrer Deschartres. Nach geschehener Prüfung der Papiere genannter Bürger haben wir nichts gefunden, was den Interessen der Republik zuwider wäre, u.s.w.“
Meine Großmutter war nun also gefangen und Deschartres war mit ihrer Rettung beauftragt; denn im Begriff in's Kloster abgeführt zu werden, hatte sie einen Augenblick gefunden, ihm zu sagen: wo sich die verderblichen Papiere befänden, deren Vernichtung sie versäumt hatte. Sie besaß außerdem eine Unmasse von Briefen, welche ihren Verkehr mit Emigranten bezeugten; ein Verkehr, der gewiß sehr unschuldig war, der ihr aber als Staatsverbrechen und Verrath der Republik angerechnet werden konnte.
In dem letzten Protokolle, das ich angeführt habe — und Gott mag wissen, mit welcher Verachtung und welchem Puristen-Zorne Deschartres diese Akten betrachtete, die in so schlechter Sprache verfaßt waren — in diesem Protokoll, dessen zahlreiche Fehler ihm Gänsehaut verursachten, ist nichts von einem kleinen Entresol gesagt, der sich über der ersten Etage befand und zu der Wohnung meiner Großmutter gehörte. Man erreichte denselben durch eine geheime Treppe, die sich in einem Ankleidezimmer befand.
Aus diesem Entresol, dessen Fenster und Thüren versiegelt waren, mußten die Papiere geholt werden. Um dahin zu gelangen, mußte man also drei Siegel lösen: das erste an der Thüre des ersten Stocks, die auf die Haupttreppe führte; das zweite an der Thüre des Ankleidezimmers, durch welche man die geheime Treppe erreichte, und das,dritte oben, am Eingang zum Entresol. Die Loge des Bürger Portiers, der ein wüthender Republikaner war, lag gerade unter den Zimmern meiner Großmutter; und der Corporal Leblanc, der unbestechliche Bürger, dem die Bewachung der Siegel im zweiten Stocke anvertraut war, schlief auf einem Feldbette neben Herrn Amonin's Zimmer, das heißt gerade über dem Entresol. Er war bis an die Zähne bewaffnet und hatte Befehl auf einen Jeden zu feuern, der es wagen würde, sich in die eine oder andere Wohnung einzuschleichen. Und der Bürger Froc, der trotz seines Portierberufes einen sehr leisen Schlaf hatte, brauchte nur an der Schnur einer Klingel zu ziehen, die sich unter den Fenstern des Corporals befand, um diesen bei dem geringsten Alarm herbeizurufen.
Für einen Menschen, der sich in der Kunst Thüren zu öffnen und lautlos einherzuschleichen, nicht die hohe Fertigkeit erworben hat, welche sich die Herrn Diebe durch lange Studien verschaffen, war das Unternehmen ein tollkühnes zu nennen. Aber der wahre Opfermuth schafft Wunder! Deschartres versah sich mit allem Nöthigen und wartete, bis alle Hausgenossen zur Ruhe gegangen waren. Erst um zwei Uhr ist Alles still. Deschartres steht auf, kleidet sich geräuschlos an und füllt seine Taschen mit den Instrumenten, deren er bedarf und die er sich nicht ohne Gefahr verschafft hat. Er löst das erste Siegel, dann das zweite, endlich das dritte; er hat den Entresol erreicht und nun handelt es sich darum, ein Pult von eingelegter Arbeit, das meine Großmutter als Schatulle benutzte, zu erbrechen, und neunundzwanzig Mappen voll Papiere durchzusehen, da meine Großmutter nicht zu bezeichnen wußte, in welcher Mappe die verdächtigenden Briefe wären.
Deschartres läßt sich nicht entmuthigen; er beginnt zu prüfen, auszusuchen und zu verbrennen. Es schlägt drei Uhr und noch regt sich nichts ... aber doch! — die Dielen im Salon der ersten Etage knarren unter leichten Schritten. Vielleicht ist es Nérina, die Lieblingshündin der Gefangenen, die neben Deschartres' Bette schläft und ihm gefolgt sein kann. Er hat nämlich auf alle Gefahr hin die Thüren hinter sich offen lassen müssen, denn der Portier besitzt die Schlüssel und Deschartres hat mit Hülfe eines Dietrichs geöffnet.
Wenn man so aufmerksam horcht, daß das Herz laut schlägt und das Blut in den Ohren braust, kommt ein Augenblick, wo alles Hören vergeht. Der arme Deschartres stand unbeweglich, versteinert da — denn wenn ihn der Alp nicht drückt, so kommt es die Treppe herauf und das ist nicht Nérina, das sind menschliche Schritte. Und es kommt vorsichtig naher ... Deschartres hatte sich mit einer Pistole bewaffnet, er spannt den Hahn und nähert sich der Treppenthüre ... aber er läßt den erhobenen Arm wieder sinken, denn es ist Moritz, sein geliebter Schüler, der ihm gefolgt ist.
Der Knabe hat den Plan, der ihm verborgen bleiben sollte, errathen, erspäht; und kommt, um zu helfen. Deschartres, erschreckt, ihn diese fürchterliche Gefahr theilen zu sehen, will sprechen, ihn zurückweisen, aber Moritz legt ihm die Hand auf den Mund. Deschartres begreift, daß ein Laut, ein Wort sie beide verderben kann — und überdies beweist ihm die Haltung des Knaben, daß er nicht weichen wird.
So begeben sich denn beide im tiefsten Schweigen an die Arbeit; mit der Durchsicht der Papiere wird so schnell als möglich fortgefahren und das Schädliche wird verbrannt; aber wie... es schlägt vier Uhr ... das Schließen der Thüren und Wiederherstellen der Siegel erfordert wenigstens eine Stunde die Hälfte der Arbeit ist kaum vollendet und um fünf Uhr ist der Bürger Leblanc unfehlbar erwacht.
Da hilft kein Zaudern; durch Zeichen giebt Moritz seinem Freunde zu verstehen, daß sie die folgende Nacht zurückkehren müssen. Ueberdies beginnt die unglückliche Nérina, die er in seinem Zimmer eingesperrt hat, zu jammern und zu heulen, weil sie sich allein sieht. Man schließt also Alles, läßt im Innern die zerrissenen Siegel, und begnügt sich damit, das der Eingangsthüre an der großen Treppe wiederherzustellen. Mein Vater hält das Licht und reicht das Siegellack, und Deschartres, der sich einen Abdruck der Siegel verschafft hat, löst seine Aufgabe mit der Eile und Gewandtheit eines Mannes. der die schwierigsten chirurgischen Operationen vollbracht hat. Dann kehren sie in ihre Gemächer zurück und legen sich wieder nieder. Sie können nun zwar ruhig sein über sich selbst, aber der Erfolg ihres Unternehmens ist noch immer nicht gesichert; denn man kann im Laufe des Tages kommen, um die Siegel abzunehmen, in den Zimmern ist Alles in Verwirrung geblieben und die gefährlichsten Papiere haben noch nicht entdeckt und vernichtet werden können.
Glücklicherweise ging der entsetzliche, erwartungsvolle Tag ohne Katastrophe vorüber. Mein Vater trug Nérina zu einem Freunde, Deschartres kaufte ein Paar Eggenschuhe für seinen Zögling, ölte die Thüren ihrer Wohnung, ordnete seine Instrumente und versuchte nicht des Knaben heldenmüthigen Entschluß wankend zu machen. „Ich wußte,“ sagte Deschartres, als er mir diese Geschichte fünfundzwanzig Jahre später erzählte, „ich wußte wohl, daß mir Madame Dupin im Fall des Mißlingens nie vergeben haben würde, ihren Sohn in solche Gefahr gestürzt zu haben; aber hatte ich das Recht einen guten Sohn zu hindern, wenn er sein Leben für die Mutter aufs Spiel setzen wollte? Das wäre jedem gesunden Erziehungsgrundsatze zuwider gewesen — und Erzieher war ich doch vor allen Dingen.“
In der folgenden Nacht hatten sie mehr Zeit zu ihren Arbeiten, die Wächter gingen früher zu Bett, so daß sie eine Stunde eher beginnen konnten. Die Papiere wurden gefunden und verbrannt, die Asche wurde in eine Schachtel gethan und mitgenommen, um im Laufe des Tages gänzlich fortgeschafft zu werden. Nachdem alle Mappen durchgesehen und gesichtet waren, wurden noch einige Schmucksachen und Petschafte mit Wappen zerbrochen, sie rissen sogar von den Umschlägen der Prachtbände die Wappen ab. Endlich, nachdem ihre Aufgabe vollendet war, wurden die Siegel wieder angelegt: die Abdrücke vortrefflich hergestellt; die Papierstreifen schienen unverletzt, die Thüren wurden ohne Geräusch geschlossen; nachdem die beiden Gefährten ihre edle That mit dem Geheimniß und den angstvollen Schauern vollführt hatten, welche die Ausübung des Verbrechens begleiten, konnten sie sich noch zur rechten Stunde in ihre Gemächer zurückziehen. Und hier fielen sie sich in die Arme und weinten zusammen ohne zu sprechen, denn sie hofften meine Großmutter gerettet zu haben. Aber noch lange mußten sie in qualvoller Sorge leben; ihre Haft verlängerte sich bis nach der Katastrophe des 9. Thermidor und bis zu jener Zeit wurden die revolutionären Gerichte täglich argwöhnischer und schrecklicher.
Am 16. Nivose, das heißt etwa einen Monat später wurde meine Großmutter aus dem Gefängniß in ihre Wohnung geführt; Bürger Philidor, der Commissär, der sie bewachte, war ein sehr humaner Mann, der sich mehr und mehr zu ihren Gunsten gestimmt fühlte. Das Protokoll, das unter seinen Augen aufgenommen und von ihm unterzeichnet ist, bestätigt, daß die Siegel unverletzt gefunden wurden; und da der Bürger-Portier keinesfalls Nachsicht geübt haben würde, muß angenommen werden, daß keine Spur das Eindringen verrieth.
Im Vorübergehen will ich bemerken, was ich nicht vergessen möchte, daß der brave Deschartres mir diese Geschichte nie erzählte, als wenn ich mit Fragen auf ihn eindrang; und auch dann erzählte er sie schlecht und die Einzelheiten habe ich nur durch meine Großmutter erfahren. Dennoch habe ich nie einen Erzähler gekannt, der weitschweifiger, peinlicher, pedantischer, eitler auf sein Thun in den größten Kleinigkeiten und mehr geneigt gewesen wäre, sich selbst reden zu hören, als dieser gute Mann. Er ermangelte nie, Abends eine Reihenfolge von Anekdoten und merkwürdigen Ereignissen aus seinem Leben zu erzählen, die ich nachgerade so gut kannte, daß ich ihn zurecht wies, wenn er sich nur um ein Wort irrte. Er gehörte zu denen, die nicht wissen, was sie groß macht, und wenn es darauf ankam, das Heldenmüthige seines Charakters zu beweisen, war dieser Mann, der in kleinlichen Dingen die lächerlichsten Ansprüche machte, naiv wie ein Kind und demüthig wie ein echter Christ.
Meine Großmutter hatte das Gefängniß nur verlassen, um dem Abnehmen der Siegel und der Prüfung ihrer Papiere beizuwohnen. Obwohl diese Haussuchung neun Stunden lang dauerte, fand sich natürlich nichts, was den Interessen der Republik zuwider gewesen wäre, und da sie diese Zeit mit ihrem Sohne Zusammensein konnte, war es für meine Großmutter ein glücklicher Tag. Die Zärtlichkeit der beiden rührte die Commissarien sehr, besonders den Bürger Philidor, der, wenn ich nicht irre, ein ehemaliger Perrückenmacher, ein eifriger Patriot und jedenfalls ein sehr rechtlicher Mann war. Er faßte eine besondere Vorliebe für meinen Vater, und that alles Mögliche, um das Urtheil meiner Großmutter zu beschleunigen, weil er hoffte, daß sie freigesprochen werden sollte; seine Bemühungen wurden jedoch erst zur Zeit der Reaction mit Erfolg gekrönt.
Am Abend des 16. Nivose führte Philidor seine Gefangene ins Kloster des Anglaises zurück und sie blieb daselbst bis zum 4. Fructidor (22. August 1794). Eine Zeit lang durfte mein Vater seine Mutter täglich einige Augenblicke im Sprechzimmer sehen. Er pflegte diesen glückseligen Moment im Kreuzgange in einer eisigen Kälte zu erwarten — und Gott sei geklagt, wie kalt es in diesem Kreuzgange ist, den auch ich drei Jahre lang in allen Richtungen durchschritten habe, denn ich bin in demselben Kloster erzogen. Mein Vater mußte oft stundenlang warten, weil besonders in der ersten Zeit die Sprechstunden täglich geändert wurden, entweder nach Belieben der Wächter oder auf Befehl der revolutionären Regierung, die einen zu häufigen und zu leichten Verkehr der Gefangenen mit ihren Angehörigen fürchten mochte. Zu andern Zeiten würde sich der zarte, schwächliche Knabe eine Brustentzündung zugezogen haben, aber heftige Gemüthsbewegungen schaffen uns eine andere Gesundheit, eine andere Organisation — er bekam nicht einmal den Schnupfen, und verlernte rasch sich immer zu beachten, und seiner Mutter, wie er sonst gethan hatte, das geringste kleine Leiden, die geringste Widerwärtigkeit zu klagen. Er wurde plötzlich zu dem, was er hinfort bleiben sollte und das verzogene Kind verschwand, um sich nie wieder zu zeigen. Wenn er seine arme Mutter bleich und erschreckt an das Gitter treten sah, weil er so lange auf sie gewartet hatte; wenn er bemerkte, daß sie im Begriff war in Thränen auszubrechen, so oft sie seine kalten Hände berührte; und wenn sie ihn bat, lieber nicht mehr zu kommen, als sich diesen Leiden auszusetzen, schämte er sich der Weichlichkeit, in die er sich hatte einwiegen lassen; er machte sich zum Vorwurf, die Entwicklung dieser übermäßigen Sorgfalt gefördert zu haben — und da er nun aus Erfahrung wußte, was es heißt für seine Lieben zu zittern und zu bangen, leugnete er das lange Warten, versicherte die Kälte nicht zu empfinden und brachte es endlich durch die Kraft seines Willens so weit, daß ihn der Frost in Wahrheit nicht mehr quälte.
Seine Studien waren natürlich unterbrochen; von Musik-, Tanz- und Fecht-Stunde war nicht mehr die Rede. Der gute Deschartres sogar, der so sehr zu unterrichten liebte, hatte jetzt ebensowenig Sinn für die Stunden, als der Schüler. Aber die Erziehung der Verhältnisse ersetzte die frühere vollkommen und diese ganze Zeit war für den Knaben nicht verloren, denn sie entwickelte das Gemüth und das Bewußtsein des Mannes.