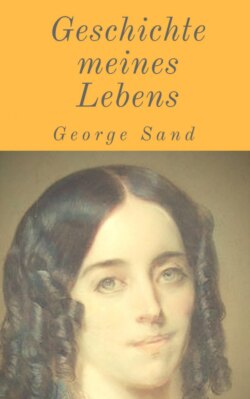Читать книгу Geschichte meines Lebens - George Sand - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Kapitel. Nach der Schreckenszeit. — Ende der Gefangenschaft und des Exils. — Unglücklicher Einfall Deschartres. — Nohant. — Die terroristischen Bürger. — Geistiger Zustand der wohlhabenden Klassen. — Musikalische Leidenschaft, — Paris unter dem Direktorium.
ОглавлениеAm 4. Fructidor (August 94) wurde meine Großmutter endlich wieder mit ihrem Sohne vereinigt. Das schreckliche Trauerspiel der Revolution verschwand für einen Moment aus ihren Augen. Sie gaben sich Beide ungetheilt dem Glücke des Wiedersehens hin; die zärtliche Mutter sowohl als der vortreffliche Sohn vergaßen Alles, was sie gelitten, verloren und erfahren hatten. Alles, was noch bevorstehen konnte, und betrachteten diesen Tag als den schönsten ihres Lebens.
Getrieben von dem Verlangen, ihren Sohn in Passy zu umarmen, wartete meine Großmutter nicht auf die Scheine, durch welche ihr die Erlaubniß gegeben werden mußte, die Barrieren von Paris zu überschreiten. Um nun aber am Thore von Maillot nicht aufzufallen, verkleidete sie sich als Bäuerin, bestieg, um die Seine zu überfahren, ein Schiff am Quai der Invaliden, und wollte sich dann zu Fuße nach Passy begeben. Dies war für sie eine große Aufgabe, denn sie hatte nie weitere Fußtouren gemacht und war, vielleicht aus Mangel an Uebung, vielleicht aus organischer Schwäche, vollständig ermüdet, wenn sie eine Gartenallee durchschritten hatte. Und doch war sie schlank, gut gewachsen, vollkommen gesund und von einer frischen, ruhigen Schönheit, die allen Anschein der Kraft besaß.
Doch jetzt eilte sie vorwärts, ohne sich selbst zu beachten, und ging so rasch, daß Deschartres, dessen Kleidung der ihrigen entsprach, kaum zu folgen vermochte. Aber bei der Ueberfahrt hätte ihnen beinahe ein unbedeutender Umstand neues Unglück zugezogen. Das Schiff war mit Menschen aus den niedern Ständen besetzt, welche die weiße Haut und die zarten Hände meiner Großmutter bemerkten. Ein wackrer Freiwilliger der Republik stellte laut seine Betrachtungen darüber an. „Seht mal das kleine, hübsche Frauchen,“ sagte er, „das hat gewiß nicht oft gearbeitet.“ Deschartres, der immer mißtrauisch und ungeschickt in seinem Benehmen war, antwortete mit einem: „Was geht's Dich an!“ das sehr übel aufgenommen wurde. In demselben Augenblicke ergriff eine der Frauen, die im Schiffe waren, ein blaues Packet, das aus Deschartres Tasche guckte, hob es in die Höhe und rief: „Es sind flüchtende Aristokraten! wenn es Leute wären wie wir, würden sie kein Siegellack verbrennen.“ Und eine andere, die mit der Taschendurchsuchung des unglücklichen Pädagogen fortfuhr, entdeckte eine Flasche Eau de Cologne, welche den beiden Flüchtlingen einen Hagel bedrohlicher Spöttereien zuzog.
Der gute Deschartres, der trotz der Rauhheit seines Wesens, die zarteste Aufmerksamkeit besaß, war diesmal für die Verhältnisse zu zart und aufmerksam gewesen. Er hatte geglaubt, etwas Außerordentliches zu thun, indem er sich heimlich für meine Großmutter mit den kleinen Luxusartikeln versah, die sie in Passy nicht gefunden haben würde oder nicht herbeischaffen konnte, ohne Verdacht zu erregen.
Als er nun sah, daß diese Sorgsamkeit verderblich zu werden drohte, verwünschte er seinen Einfall. Aber immer unfähig, sich zu fügen, sprang er auf, ballte die Fäuste, erhob die Stimme und drohte: Jeden, der seine, Gevatterin“ beleidige, in den Fluß zu werfen. Die Männer lachten nur über seine Prahlereien, aber der Schiffer sagte mit bestimmtem Tone: wir werden die Geschichte beim Aussteigen untersuchen. Worauf die Frauen Bravo schrieen und die verkappten Aristokraten heftig bedrohten.
Die revolutionäre Regierung milderte freilich die Strenge ihrer Maßregeln von einem Tage zum andern, aber das Volk gab seine Macht nicht auf, und war immer bereit, sich selbst Recht zu verschaffen.
In diesem gefahrvollen Augenblicke wurde meine Großmutter durch eine jener Eingebungen geleitet, die bei dem Weibe so mächtig sind. Sie setzte sich zwischen zwei der bösesten Weiber, die sie mit Schimpfworten überhäuften, ergriff ihre Hände und sagte: „Mag ich Aristokratin sein oder nicht, ich bin eine Mutter, die seit sechs Monaten ihren Sohn nicht gesehen hat, die schon fürchtete, ihn nie wieder zu erblicken, und die sich jetzt mit Lebensgefahr zu ihm begiebt. Wollt ihr mich verderben, nun wohl, so zeigt mich an, tödtet mich, wenn ihr wollt, nach meiner Rückkehr, aber hindert mich nur jetzt nicht meinen Sohn zu sehen; ich lege mein Geschick in eure Hände.“
Und sogleich antworteten die Weiber: „Geh nur, Bürgerin, geh, wir wollen Dir nichts Böses thun! Du thust wohl, Dich uns zu vertrauen, denn auch wir haben Kinder, die wir lieben.“
Als sie das Ufer erreichten, wollten der Schiffer und die andern Männer, die Deschartres Benehmen ärgerte, das Fortgehen der Beiden verhindern. Aber die Frauen hatten meine Großmutter unter ihren Schutz genommen, und erklärten den Männern: „Wir wollen das nicht, und verlangen Achtung für unser Geschlecht! lasset also die Bürgerin in Ruhe, und auch ihr Kammerdiener — so nannten sie den armen Deschartres — soll mit ihr gehen. Er beträgt sich albern, aber er ist nicht mehr ci-devant als ihr selbst.“
Meine Großmutter umarmte die braven Weiber mit Freudenthränen: Deschartres nahm sein Abenteuer von der lächerlichen Seite; sie gelangten nun ohne weitere Hindernisse in das kleine Haus in Passy, und Moritz, der sie noch nicht erwartete, war ganz außer sich vor Freude, als er seine Mutter in die Arme schloß. Ich weiß nicht mehr, an welchem Tage das Verbannungsdecret wieder aufgehoben wurde, aber es muß fast zu derselben Zeit gewesen sein. Meine Großmutter ordnete nun ihre Papiere, und ich bin noch im Besitze ihrer Aufenthaltskarte und der Bescheinigung ihres „Bürgersinns“. Letzterer ist besonders dadurch bewiesen, daß sich alle ihre Diener — und Anton der Lakai an ihrer Spitze, nach dem Urtheil der ganzen Section — bei Erstürmung der Bastille, sehr brav benommen hatten. Für den Hochmuth der Großen waren das bittere Lehren.
Aber ich sagte schon früher, daß meine Großmutter zu frei von Vorurtheilen war, um bei dem Gedanken zu erröthen, daß sie ihre bürgerliche Wiederherstellung dem guten Betragen eines Dieners verdankte. Gleichwohl theilte sie dessen Ansichten nicht, und war weit entfernt, deren gesellschaftliche Consequenzen anzuerkennen. Sie übersiedelte nun zu Anfange des Jahres III nach Nohant, begleitet von ihrem Sohne, Deschartres, Anton und Demoiselle Roumier, einer alten Wärterin, die meinen Vater großgezogen hatte und immer mit der Herrschaft speiste. Auch Nerina und Tristan wurden nicht vergessen.
Während ich neulich in dieser Sammlung von Erinnerungen Nerina's Geschichte schrieb, fand mein Sohn Moritz auf einem der Böden unseres Hauses, das Schild vom Halsbande dieses interessanten, kleinen Thieres. Es trägt die Inschrift: „Ich heiße Nerina und gehöre Madame Dupin in Nohant, bei la Châtre,“ Wir haben diesen Gegenstand wie eine Reliquie aufbewahrt. In den Papieren meines Vaters von 1796 finde ich Nerina's Nachkommenschaft erwähnt: sie bestand aus Tristan, dem armen Kinde der Schreckenszeit, dem Gefährten des Exils, und aus dessen nachgeborenen Schwestern, Spinette und Belle. Nerina ist auf dem Schooße ihrer Herrin gestorben, und unter einem Rosenstrauche im Garten begraben oder verscharrt, wie der alte Gärtner zu sagen pflegte, der, als ein Purist des Berry, das Zeitwort begraben nie auf ein anderes Geschöpf, als auf einen getauften Christen angewendet haben würde.
Nerina starb früh, weil sie ein zu bewegtes Leben gehabt hatte; Tristan dagegen erreichte ein außergewöhnliches Alter. Durch ein sonderbares Zusammentreffen stimmte sein zärtliches, melancholisches Wesen mit seinem Namen überein, und er war eben so ruhig und nachdenklich, als seine Mutter lebhaft und rührig war. Meine Großmutter zog Tristan allen Nachkömmlingen Nerina's vor, denn wenn wir eine schwere Krisis überstanden haben, fassen wir für alle Wesen, selbst für die Thiere, welche sie mit uns durchlebten, eine besondere Zuneigung. So wurde auch dieser Hund besonders gepflegt, und lebte fast eben so lange, als mein Vater; denn ich erinnere mich, in meiner ersten Kindheit mit ihm gespielt zu haben, obwohl er sich nicht leicht dazu hergab, und immer aussah, als versenkte er sich in die Erinnerungen der Vergangenheit.
Ich weiß das Datum der Begebenheiten, die ich erzähle, nicht immer genau anzugeben, aber ich besitze einen Brief, den meine Großmutter am 1. Brumaire des Jahres III. (October 1794) von der Verwaltungsbehörde des Distrikts la Châtre erhielt. Er trägt die Ueberschrift: „Einheit und Untheilbarkeit der Republik, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder der Tod.“ Die Republik war dem Geiste nach bereits gestorben, aber ihre Formeln wurden festgehalten. Die Zuschrift lautet: „An die Bürgerin Dupin.“
„Wir senden Dir die Abschrift des Kaufcontractes, welchen am 3. August (nach alter Rechnung) Piarou mit Dir abgeschlossen hat und ein Verzeichniß der Forderungen, welche er an Dich macht ec. Gruß und Brüderlichkeit“ — dann folgen die Unterschriften dreier Spießbürger.
Wie glücklich fühlten sich diese guten Leute, diese großen Kinder, die sich am Tage vorher emancipirt hatten, indem sie zu der bescheidenen Besitzerin von Nohant Du sagen und den Mann kurzweg Piarou nennen konnten, der für sie früher der Herr Graf von Serennes gewesen war. Meine Großmutter lächelte darüber und fühlte sich nicht beleidigt; aber sie bemerkte, daß die Bauern zu diesen Herrn nicht Du sagten und freute sich, daß ihr Tischler sie ohne Umstände so nannte, denn sie erblickte darin einen freundschaftlichen Vorzug, dessen sie sich mit einiger Schalkheit bewußt war.
Dieser Tischler war damals Einnehmer der Gemeinde, ein kühner, umsichtiger Republikaner und sein Leben lang unser treuer Freund, dessen letzten Seufzer ich empfangen habe. Meine Großmutter befand sich eines Tages mit ihrem Sohne in seinem Hause, als zwei weinselige Bürger von la Châtre vorüberkamen und es sehr verdienstlich fanden, ein Weib und ein Kind zu insultiren, sie mit der Guillotine zu bedrohen und sich das Ansehen eines kleinen Robespierre zu geben, obwohl gerade sie, in Uebereinstimmung mit ihren Standesgenossen, diesen Robespierre und die Revolution vernichtet hatten. Mein Vater, der erst 16 Jahre alt war, stürzte ihnen entgegen, ergriff die Zügel des einen Pferdes und befahl ihnen abzusteigen, um sich mit ihm zu schlagen. Godard, der Tischler und Einnehmer, kam ihm zu Hülfe, bewaffnet mit einem großen Schrägemaaße, womit er, wie er sich ausdrückte, diese Herren „ausmessen“ wollte. Aber die Herren antworteten nicht auf die Herausforderung und sprengten davon, — ihre Trunkenheit mag sie entschuldigen. Jetzt (1847) sind sie eifrig conservativ und königlich gesinnt — doch sie sind alt und ihr Alter mag sie rechtfertigen.
Ihr Zorn wird übrigens durch eine besondere Ursache erklärlich. Der Eine von ihnen war durch die Bezirksregierung, während der gesetzlichen Ueberwachung der Verdächtigen, zum Verwalter der Einkünfte des Gutes Nohant ernannt. Er hatte es angemessen gefunden, sich diese anzueignen und meiner Großmutter verfälschte Rechnungen vorzulegen; diese hatte ihn verklagt und er wurde zur Wiedererstattung verurtheilt. Aber der Prozeß währte zwei Jahre und während dieser Zeit war meine Großmutter zur größten Einschränkung gezwungen, denn sie bezog nur die Einkünfte des Gutes, welche sich damals nicht auf 4000 Franks beliefen, und mußte noch dazu eine Summe zurückzahlen, die sie im Jahre 93 geliehen hatte, um den erzwungenen Anleihen der Republik und den sogenannten freiwillligen Beiträgen zu genügen. Zwar ordneten und verbesserten sich ihre Verhältnisse nach und nach, aber von der Revolution an beliefen sich ihre jährlichen Einkünfte nie auf 15,000 Franes.
Doch da sie eine bewunderungswürdige Ordnung besaß, und sich mit großer Ergebenheit in die bescheidene Lebensweise fand, welche ihr durch die Verhältnisse vorgezeichnet wurde, kam sie vollständig damit aus und ich habe sie oft mit Lachen versichern gehört, daß sie nie so reich gewesen wäre, als in ihrer Armuth.
Ich will nun aber auch etwas von dem Gute Nohant erzählen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich fast mein ganzes Leben zugebracht habe und wo ich einst zu sterben wünsche.
Der Ertrag des Gutes ist gering; die Wohnung ist einfach und bequem und die Umgebungen sind ohne Schönheit, obwohl Nohant im Mittelpunkt der vallée-noire — eines weiten wunderschönen Thales — gelegen ist. Aber gerade diese Lage in dem flachsten, niedrigsten Theile des Thales, inmitten eines fruchtbaren Weizenbodens, beraubt uns der reichen Abwechselung und der umfassenden Aussicht, welche die Abhänge und Höhen gewähren. Wir haben zwar einen blauen Horizont, ein hügliches Land rings umher und im Vergleich mit der Beauce und der Brie ist die Aussicht hübsch zu nennen, aber im Vergleich mit den Schönheiten, die wir erblicken, wenn wir bis zu dem versteckten Bette des Flusses hinabsteigen — im Vergleich mit der reizenden Fernsicht, die sich vor uns ausbreitet, wenn wir die Hügel ersteigen, von denen das Land umrahmt wird, scheint unsere Landschaft nackt und beschränkt.
Aber wie dem auch sei, sie gefällt uns und wir lieben sie.
Meine Großmutter liebte sie ebenfalls, und mein Vater rettete sich aus seinem vielbewegten Leben oft hierher, um einige Stunden der Ruhe zu genießen. Diese durchfurchte, fette, braune Erde, diese mächtigen Nußbäume, die schattigen Wege und das wilde Gesträuch, dieser grasbewachsene Kirchhof, der kleine mit Ziegeln gedeckte Glockenthurm, die antike Halle, die großen morschen Ulmen, die kleinen Bauerhäuser, umgeben von hübschen Hecken, Weinlauben und grünen Hanffeldern — alles dies wird dem Auge angenehm und der Erinnerung theuer, wenn man lange in der friedlichen, bescheidenen und stillen Umgebung gelebt hat.
Das Schloß, wenn man es so nennen will — denn es ist nur ein mittelgroßes Haus aus der Zeit Ludwigs XVI. — ist nicht prunkvoller als eine ländliche Wohnung und stößt an das Dörfchen und den Communplatz. Die Feuerstellen der Gemeinde, zwei bis dreihundert an der Zahl, liefen weit zerstreut, aber etwa zwanzig drängen sich, so zu sagen Wand an Wand um das Haus — und man muß mit diesen wohlhabenden und unabhängigen Bauern, die in unser Haus treten, wie in ihr eigenes, in guter Eintracht zu leben suchen. Wir haben uns immer wohl dabei befunden — und obwohl die Gutsbesitzer sich gewöhnlich über die Nachbarschaft der Häusler beklagen, so sind die Unannehmlichkeiten, welche die Kinder, Hühner und Ziegen dieser Nachbarn uns bereiten, doch sehr gering gegen den Vortheil, den uns ihre Gefälligkeit und Gutherzigkeit gewähren.
Die Einwohner von Nohant, alle Bauern und kleine Grundbesitzer (man wird mir erlauben Gutes von ihnen zu reden, weil ich ausnahmsweise behaupte: daß der Bauer ebensowohl guter Nachbar als Freund sein kann), verbergen ihren heitern Sinn unter einem ernsten Aussehen. Sie haben gute Sitten, einen Rest von Frömmigkeit ohne Fanatismus, viel Anstand in Haltung und Manieren, eine ruhige aber anhaltende Arbeitsamkeit, Ordnungsliebe, außergewöhnliche Reinlichkeit, viel natürlichen Verstand und Freimüthigkeit.
Außer zwei oder drei Ausnahmen habe ich den Verkehr mit diesen ehrlichen Leuten nur angenehm gefunden — aber ich habe ihnen nie den Hof gemacht und sie nie durch das erniedrigt, was man Wohlthaten nennt. Ich habe ihnen Dienste erzeigt und sie erstatteten mir diese nach ihrem freien Willen, ihren Mitteln, ihrer Güte und ihrer Einsicht zurück. Sie sind mir nichts schuldig geblieben, denn eine kleine Hülfe, ein gutes Wort, ein Beweis wahrer Ergebenheit sind eben so viel werth, als das, was wir zu geben vermögen. Sie sind weder schmeichelnd, noch kriechend, und ich habe gesehen, wie sie täglich mehr gerechten Stolz zeigten und sich mehr vernünftige Freiheiten erlaubten, ohne je das Vertrauen zu mißbrauchen, das man ihnen schenkte. Sie sind ebensowenig rohe Menschen, sondern besitzen mehr Takt, Zurückhaltung und Höflichkeit, als ich unter denen gefunden habe, die man gut erzogene Leute nennt.
Das war auch die Meinung meiner Großmutter über die Dorfbewohner, unter denen sie achtundzwanzig Jahre lebte, ohne je Veranlassung zur Klage zu haben. Deschartres mit seinem reizbaren Charakter und seiner leicht verletzbaren Eigenliebe, fand das Leben unter den Bauern jedoch weniger angenehm — ich habe ihn beständig über ihre List, Schelmerei und Dummheit klagen hören. Meine Großmutter suchte seine Mißgriffe wieder gut zu machen und man vergab ihm, um des Eifers und der Menschenliebe willen, die er im Grunde des Herzens trug, seine lächerlichen Prätentionen und sein aufbrausendes Temperament.
Ich werde oft Gelegenheit haben, auf die „Landleute“, wie sie sich jetzt nennen, zurückzukommen, seit der Revolution ist nämlich die Benennung Bauer beleidigend geworden und gilt für gleichbedeutend mit Tölpel und Flegel.
Mehrere Jahre brachte meine Großmutter in Nohant allein damit zu, die Erziehung ihres Sohnes unter Beihülfe Deschartres fortzusetzen und ihre materiellen Angelegenheiten zu ordnen. Ueber ihren geistigen Zustand spricht sie sich auf einem zu jener Zeit von ihrer Hand geschriebenen Blatte aus, das ich aufgefunden habe. Ich kann allerdings nicht dafür einstehen, daß die Gedanken ihr eigen sind, denn sie hatte die Gewohnheit, Fragmente zu copiren, oder sich Auszüge aus ihrer Lectüre zu machen; aber wie dem auch sei, die Reflexionen, die ich abschreibe, geben ein sehr gutes Bild von dem moralischen Zustande einer ganzen Klasse der Gesellschaft nach der Schreckenszeit.
„Wenn Europa bei dem Anblicke aller Schrecken, deren Schauplatz Frankreich war, sich erlaubt, sie der besondern Gemüthsart und der angebornen Schlechtigkeit eines großen Theils des Volkes zuzuschreiben, so sind wir berechtigt, dies Urtheil zurückzuweisen. Gott behüte andere Nationen davor, jemals durch die Erfahrung belehrt zu werden, welcher Gewaltthätigkeiten die Menschen aller Länder fähig sind, wenn kein Band sie mehr fesselt, wenn das Räderwerk der Gesellschaft einen so heftigen Stoß erhalten hat, daß Keiner mehr weiß, wo er ist, nicht mehr dieselben Gegenstände sieht und seinen alten Ansichten nicht mehr vertrauen kann. Alles ändert sich vielleicht, wenn die Regierung besser wird, wenn sie sich befestigt und wenn sie darauf verzichtet, die Schwäche der Menschen zu mißbrauchen. — Ach! da unsere Erinnerungen uns tödten, laßt uns die Hoffnung aufsuchen; da unsere Gegenwart keinen Trost bietet, laßt uns der Zukunft zustreben! Und Ihr, Historiker, die Ihr das Urtheil der Nachwelt leitet, die Ihr es oft auf immer bestimmt, haltet ein mit Euern Darstellungen, bis Ihr deren Eindruck durch die Erzählung der Wiedergeburt und der Reue mildern könnt. Vollendet wenigstens Euer Gemälde nicht, bevor Ihr das erste Aufleuchten der Morgenröthe in der Tiefe dieser schrecklichen Nacht anzudeuten vermögt. Redet von dem Muthe der Franzosen, sprecht von ihrer Tapferkeit, und wenn es möglich ist, so werft einen Schleier über die Thaten, die ihren Ruhm befleckt und den Glanz ihrer Siege verdunkelt haben.
Alle Franzosen fühlen die Ermüdung des Unglücks. Durch Ereignisse von übernatürlicher Stärke sind sie zerschmettert oder gebeugt, und nachdem sie so lange unter schwerem Drucke gelebt haben, sind ihnen alle Wünsche, die einem andern Zustande angehören, fremd geworden. Ihr Verlangen und ihre Erwartungen sind eng begrenzt, sie werden zufrieden sein, wenn sie an das Aufhören ihrer Sorgen glauben können, denn eine entsetzliche Tyrannei hat sie dahin gebracht, die Sicherheit des Lebens für eine besondere Wohlthat anzusehen.
Der Gemeinsinn ist schwach geworden und wird noch lange hinsiechen — es ist die unvermeidliche Folge einer unerhörten Katastrophe, einer beispiellosen Verfolgung. Man hat sich so sehr mit eignem Leid genährt, daß die Gewohnheit verloren ist, an allgemeinen Interessen theilzunehmen. Wenn die persönliche Gefahr einen gewissen Punkt erreicht, verwirrt sie alle Verhältnisse und das Aufhören der Hoffnung verändert beinahe unser Wesen. Man bedarf ein wenig Glück, um sich der Liebe für das Allgemeine hinzugeben und man hat einen gewissen eignen Ueberfluß nöthig, um Andern etwas von sich selbst mittheilen zu können ...“
Wer auch der Verfasser dieses Fragmentes sein möge — es ist nicht ohne Schönheit und meine Großmutter war wohl fähig, es zu schreiben. Wenigstens ist es der Ausdruck ihrer Gedanken, wenn sie sich auch nur die Mühe genommen hätte, es zu copiren. Auch ist Wahrheit in diesem Zeitgemälde und eine gewisse relative Gerechtigkeit in den Klagen derer, die ohne augenscheinlichen Nutzen gelitten haben. Endlich aber verräth es eine Art Größe, daß sie dem revolutionären Gouvernement nicht den Schaden vorwerfen, den sie an ihrem Leben gelitten hatten, sondern nur den ihrer Seele.
Aber es zeigt sich darin auch ein offenbarer Widerspruch, der sich immer in dem Urtheile des Sonderinteresses bemerklich macht. Es wird gesagt, daß die Franzosen groß sind durch ihren Muth und ihre Siege und das setzt einen mächtigen Aufschwung des Patriotismus voraus, während zugleich der Verfasser die Niedergeschlagenheit und den Egoismus ausmalt, welche sich der nämlichen Franzosen bemächtigen, die durch eigne Leiden gegen fremdes Unglück unempfindlich geworden sind. — Es waren nicht dieselben Franzosen, daran liegt es. — Die Glücklichen von gestern, d. h. die, welche lange Zeit das Glück Andrer in der Hand hatten, bedurften einer großen Anstrengung, um sich an ein unsicheres Schicksal zu gewöhnen. Die Besten unter ihnen, wozu gewiß meine Großmutter gehörte, seufzten, daß sie nichts mehr zu geben hatten und Leiden sehen mußten, die sie nicht mehr lindern konnten. Indem man es ihnen unmöglich machte, die Wohlthäter der Armen zu sein, betrübte man sie tief und die Segnungen der neu entstehenden Gesellschaft waren noch zu wenig bemerklich. Sie konnten es um so weniger sein, da diese Wiedergeburt im ersten Keime erstickte, die Bourgeoisie die Oberhand gewann, und da zu der Zeit, als meine Großmutter die Gesellschaft beurtheilte, sie sich, ohne es zu wissen, am Todeskampfe der Rechte und Hoffnungen des Volkes betheiligte.
Was die Franzosen des Heeres betrifft, so waren sie nothwendigerweise die Freunde von Allem, was in Frankreich geblieben war. Sie vertheidigten das Volk, die Bourgeoisie und den patriotischen Adel. Als heldenmüthige Märtyrer der Freiheit hatten sie die in jeder Hinsicht und zu allen Zeiten unzweifelhaft ruhmvolle Aufgabe, das Vaterland zu schützen; und gewiß war das heilige Feuer auf dem Boden Frankreichs, der in einem Augenblicke solche Armeen hervorbrachte, nicht erloschen.
Als Gegensatz der eindringlichen Klage, welche ich eben mitgetheilt habe, werde ich neue Fragmente aus dem Briefwechsel meines Vaters anführen, in denen wir sehen, wie sich nach der strengen Herrschaft der Convention die Oberfläche des Lebens darstellt. Dies Bild widerlegt die traurigen Vorhersagungen des ersten Fragmentes. Wir sehen darin den Leichtsinn, die Trunkenheit, die tollkühne Sorglosigkeit der Jugend, die begierig ist, die Vergnügungen wieder zu gewinnen, deren sie so lange beraubt war; wir sehen den Adel halbtodt und halb zu Grunde gerietet nach Paris zurückkehren, weil er den Anblick des Triumphes der Bourgeoisie der einförmigen Lebensweise auf seinen Schlössern vorzieht; der Luxus wird durch die neuen Gewalten als Mittel der Reaktion gebraucht; das Volk selbst verliert den Kopf und bietet die Hand zur Rückkehr der Vergangenheit. Frankreich bot zu jener Zeit den sonderbaren Anblick einer Gesellschaft, die sich von der Anarchie befreien will und die noch nicht weiß, ob sie sich der Vergangenheit bedienen, oder ob sie auf die Zukunft rechnen soll, um die Formen wiederherzustellen, welche Ordnung und persönliche Sicherheit garantiren. Der Gemeinsinn verschwand, er lebte nur im Heere. Die Reaktion sogar, diese royalistische Reaktion, die eben so grausam und eben so blutig war, als die Maßlosigkeit der Jacobiner, fing an sich zu beruhigen. Die Vendée hatte im Berry, bei dem Treffen von Pallnau (Mai 96) den letzten Seufzer ausgehaucht. Ein royalistischer Anführer Namens Dupin, der aber meines Wissens nicht mit uns verwandt war, hatte diesen letzten Versuch organisirt. Mein Vater war damals schon alt genug, um sich dabei zu betheiligen und es würde ihm auch nicht an Muth zu einem verzweifelten Unternehmen gefehlt haben, aber er war nicht Royalist und wurde es niemals. Wie die Zukunft sich auch gestalten mochte (und zu dieser Zeit sah Niemand, trotz der Siege Bonaparte's in Italien, die Rückkehr des Despotismus voraus), so verdammte doch dieser Knabe die Vergangenheit und sagte sich von ihr los, ohne Rückhalt und ohne irgend welches Bedauern. Er sowohl, wie seine Mutter waren rein von aller geheimen Theilnahme, von aller moralischen Mitschuld an der Wuth der Parteien und der eigennützigen Rachsucht; beide ließen sich wiegen durch die noch zitternden Wellen der letzten Volksbewegungen und erwarteten die Ereignisse, indem sie dieselben mit einer philosophischen Unparteilichkeit beurtheilte, und indem er die Unabhängigkeit des Vaterlandes und die Herrschaft der unvollständigen, aber edeln Theorien der Schriftsteller des achtzehnten Jahrhunderts herbeiwünschte. Er sollte bald darauf den letzten Hauch des republikanischen Lebens in der Armee aufsuchen, und da seine Mutter zuweilen vor seinem heftig ausgesprochnen Verlangen erschrak, suchte sie ihn durch die sanften Genüsse der Kunst und den Reiz erlaubter Freuden zu zerstreuen.
Einige Worte über die Persönlichkeit meines Vaters, ehe ich denselben im Jahre 96 selbstredend einführe: seit 1794 hatte er mit Deschartres viel studirt, hatte jedoch in Hinsicht der classischen Studien nur geringe Fortschritte gemacht. Er war eine Künstlernatur und lernte eigentlich nur durch den Unterricht seiner Mutter. Musik, lebende Sprachen, Deklamation, Zeichnen, Literatur zogen ihn unwiderstehlich an; aber Mathematik und Griechisch flößten ihm gar kein Interesse ein, und das Lateinische ein sehr geringes. Für ihn ging Musik Allem voran und seine Violine war die Gefährtin seines Lebens; er hatte außerdem eine herrliche Stimme und sang ausgezeichnet. Er war ganz Gefühl, Gemüth, Begeisterung, ganz Muth und Vertrauen. Er liebte Alles, was schön war, versenkte sich vollständig darein und kümmerte sich eben so wenig um die Folgen als um die Ursachen desselben. Da er seinem Wesen, vielleicht auch seinen Principien nach weit republikanischer war, als seine Mutter, personifizirte er auf das Bewunderungswürdigste das ritterliche Element der letzten Kriege der Republik und der ersten Kriege des Kaiserreichs; — im Jahre 1796 war er übrigens noch nichts als Künstler.
Im Herbst desselben Jahres schickte meine Großmutter ihren lieben Moritz nach Paris, vielleicht um ihn für lange Zurückgezogenheit zu entschädigen, vielleicht aus andern, ernstern Gründen, die in den Briefen angedeutet zu sein scheinen, die ich aber nicht vollständig kenne.
In diesen allerliebsten Briefen, deren größter Theil hier natürlich wegfallen muß, wird die Physiognomie von Paris unter dem Direktorium so treffend geschildert, daß ich hier Einiges daraus einschalte.