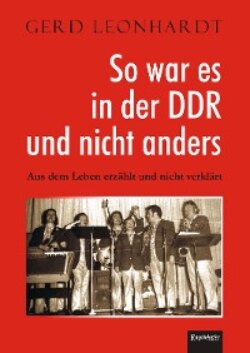Читать книгу So war es in der DDR und nicht anders - Gerd Leonhardt - Страница 6
Dankeswort
ОглавлениеIch möchte mich an dieser Stelle bei dem Deutschen Bundeswehrverlag – ehm. Deutscher Bundes-Verlag – bedanken für die freundliche Genehmigung des Druckes von Zitaten aus der Broschüre: „Ein Taschenbuch – und Nachschlagebuch über die sowjetische Besatzungszone Deutschlands.“
Im Grunde bin ich eigentlich froh, dass mein Großvater ehemals am Leipziger Konservatorium Musik studierte und mir den einzigen Anreiz gab, wenn auch ganz unbewusst – ich möchte Musik machen! Für uns Kinder, wir hatten ja keinen Vater, was nach dem Krieg als normal galt, war es das großartigste, wenn der Opa sagte: „Am Sonntag gehen wir nach Lichtenwalde.“ (Lichtenwalde liegt nebenbei erwähnt an der östlichen Peripherie von Chemnitz, ausgestattet mit einem Park, der als schönster seiner Art in Deutschland ausgezeichnet ist.) Das hieß für uns, es gibt ein 50-zig-Pfennigstück aus gutem Nachkriegskupfer, denn die Russen hatten bis zum Jahr 1954 noch nicht alles „raus geschafft“. Und jetzt kommt die Hauptsache. Der Opa spielt in der ersten Kneipe nach Ende der Straßenbahnhaltestelle Klavier! Dies war eine Prozedur der besonderen Art. Zumeist musste der „Bienenstock“ herhalten, eine kleine Gaststätte vor dem Schloss Lichtenwalde gelegen. Für uns damals 9- bis 12-jährige Cousins war es immer ein tolles Erlebnis. Kaum in dieser Gaststätte angekommen, ging mein Großvater schnurstracks zum Klavier, welches zu dieser Zeit noch kultureller Normalbestand einer jeden Kneipe war. Er klappte den oberen Deckel auf, danach wurde die vordere und untere Abdeckung vom Klavier entfernt. Meistens waren wenige Gäste anwesend, denen wurden dann mindestens eine Stunde lang klassische Variationen und Fantasien angeboten. Von Händel über Bach, Wagner und Liszt, nebenbei bemerkt sein Lieblingskomponist, spielte mein Opa sich in Rage, dass er schwitzte und dabei sehr laut die Luft ausstieß. Dann aber wusste ich – jetzt kommt das Finale. Dieses war das einfache „La Paloma“. Natürlich konnten wir damals nur maximal 10-15 Takte mit“hören“, danach war es vorbei. Eine Fantasie, inbrünstig vorgetragen und mit Harmonien gestaltet, von denen wir damals noch wenig Ahnung hatten. Mit Liszt, von dem man sagte, er habe Hände von der Größe eines Scheißhausdeckels, konnte er super umgehen. Mein Großvater konnte auf dem Klavier einen Tonumfang von 17 Halbtönen greifen und dies inklusive kannibalischer Harmonien mit 10 Fingern. Wir haben das später einmal nachgezählt. Leider wusste er aber nicht mehr, welche Harmonien er einst griff, denn er hatte alles vergessen. Aber das geht jeden angehenden Musiker so.
„Wer seine Fähigkeiten nicht ausbaut, pflegt und erweitert, wird schlechter“. Frei nach dem logisch bekannten Spruch: „Stillstand ist Rückschritt!“
Als Kinder gingen wir, meine Mutter hielt uns dazu an, jeden Sonntag in die Kirche, um vielleicht wieder ein paar Sternbuchblümchen zu erhalten. Also bunte Bilder mit Engelchen darauf. Später, als ich 10 Jahre alt war – die Kirche bekam gerade wieder neue Glocken – wurde uns in der Schule gesagt, wir sollten doch nicht mehr in die Kirche gehen. Schließlich könnten wir dort nichts lernen. Wir standen da und wussten nicht, was wir machen sollten. Der Kalender zeigte das Jahr 1954.
Mein damaliger Klassenkamerad und Freund war Sohn einer Bauernfamilie und musste genauso wie Beethoven an das Klavier geprügelt werden, welches in der so genannten „Guten Stube“ stand und nur aus diesem Grunde einmal in der Woche aufgeschlossen wurde. Die Klavierstunde war für ihn das schlimmste Vorkommnis in der ganzen Woche. In meinen Augen war er ein unmusikalisches Rindvieh, denn ich durfte ihn in der Schule ja „singen“ hören. Ich wäre froh gewesen, wenn meine Mutter die Zeit und das Geld hätte aufbringen können mich zum Klavierunterricht zu schicken. Von einem eigenem Klavier ganz zu schweigen. Ganze zwei Jahre später, ich war indessen 14 Jahre alt, konnte ich mir mein erstes Instrument leisten. Es war natürlich kein Klavier, sondern ich kaufte mir von meinem ersten Lehrlingsgeld eine Akkordzither, und dies zu einem Wahnsinnspreis von 21.- Mark der DDR. Dieses wunderschöne Instrument begleitete mich bis heute, und es klingt immer noch so, als hätte ich es gerade erst gekauft! Wer eine Akkordzither nicht kennt, dazu Folgendes: Es gibt dazu so genannte Unterlegenoten. Man braucht also nur die Melodiestimme mit dem rechten Daumen abzuspielen und mit den linken Daumen den bezifferten entsprechenden Akkord anzuzupfen. Natürlich gehörte kein großes Können dazu, dieses Instrument in kurzer Zeit einigermaßen zu beherrschen. Die Noten dafür musste jemand geschrieben haben, der entweder keine Ausbildung hatte oder kein musikalisches Gehör, denn die meisten Harmonien waren falsch. Ich habe dann die meisten bekannten Stücke für die Zither selber geschrieben. Alsbald bekam ich neuen „Hunger“ und kaufte mir kurz darauf meine erste Gitarre. Doch weil das Geld nicht zu etwas Besserem reichte, war es eine traurige „Wandergitarre“. Ein furchtbares Instrument, die Saitenlage war grauenvoll hoch. Es gab kein Schallloch, sondern zwei S-förmige Schlitze. Die Resonanz entsprach annähernd dem Klang einer Glocke aus Plastik. Aber wie soll Sperrholz schon klingen? Ein großer „Meister“ sagte einmal: „Das beste Instrument ist gerade gut genug zum Lernen“. Na, dann guten Appetit!
Zu dieser Zeit – so 1958 – kam der Musikinstrumentenbau in Sachsen langsam wieder in Hochform.