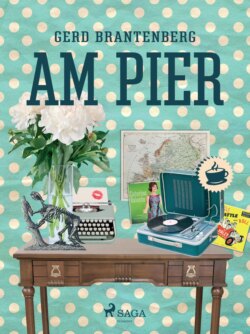Читать книгу Am Pier - Gerd Mjøen Brantenberg - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Ich schwöre bei Gott...“
ОглавлениеDie Jungen standen auf dem Schulhof, hielten die rechte Hand schräg vor sich und sagten: „Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid...“ und kannten den ganzen Hitlereid auswendig. Kjell Grunder an der Spitze mit seinem dicken großen Kopf und seinem Jokergesicht. Stramme Rücken, feierliche Mienen. Die Mädchen, Gravdahl und Rolf Magnor sahen zu. „Hört mit dem Quatsch auf! Mehrere von den Lehrern hier haben im Konzentrationslager gesessen!“ Vesia Jørgensen, die Gymnastiklehrerin der Mädchen, stand plötzlich vor ihnen. Ihre Stimme bebte. Die Jungen sahen sie an, ließen die Arme sinken, liefen davon. Als sie außer Hörweite gekommen waren, lachten sie. Und als Vesla Jørgensen mit ihrem geschmeidigen Rücken und ihren Turnschuhen im Altbau verschwunden war, legten sie den Eid noch einmal ab. Heil, Heil!
Muldvig trat in der nächsten Deutschstunde neben sein Pult und stemmte dabei die Hände in die Seiten. Er rümpfte die Nase. „Nein“, sagte er mit leiser Stimme. „Das da... das da... müßt ihr... an den Nagel hängen.“ Alle waren still. „Viele von den Lehrern hier sind... nach Deutschland geschickt worden. Ihr müßt damit aufhören.“
Die Klasse sah Muldvig an. Sie warteten. Niemand sagte jemals etwas darüber, was die von den Deutschen festgenommenen Lehrer erlebt hatten. Es wurde nur geflüstert. Alle flüsterten über Torsrud. Und über Konsul Saxeby. Und Sundt, bei dem sie Zoologie und Botanik hatten, war der nicht in Grini gewesen? Einige behaupteten, er sei von der Gestapo gefoltert worden. Deshalb sei seine Schulter schief. Aber die, die selber im KZ gesessen hatten, sagten niemals auch nur ein Wort. Weder über sich noch über die Deutschen. Und die anderen Lehrer sprachen nur darüber, wie die Deutschen an der Nase herumgeführt worden waren. Sie erzählten witzige Geschichten, daß die Deutschen Moelv wie „Mölf“ ausgesprochen und wie die Deutsche-Dirnen „Alf Vidersen“ als Kindsvater angegeben hatten, und wie ein Deutscher einmal einer Mutter mit ihrem Kind in der Straßenbahn seinen Platz angeboten hatte, worauf das Kind mit lauter Stimme zu seiner Mutter sagte: „Das war aber ein lieber Schweinehund, Mama.“ Im Krieg hatten sie viel zu lachen gehabt – insgeheim –, und das erzählten sie jetzt.
„Ich bin nicht selber im KZ gewesen“, sagte Muldvig mit noch tieferer Stimme als vorher. „Ich habe damals studiert. Zufällig ist mir das erspart geblieben. Die Reihe wurde fünf Studenten vor mir geteilt. Mehrere Bekannte von mir sind nicht zurückgekommen.“ Er schluckte. Änderte seine Stellung, schob das andere Bein schräg nach vorn. Er war ein ziemlich kleiner Mann. Er trug immer einen etwas zu weiten Anzug. Kleine Augen. „Aber die, die zurückgekommen sind“, fuhr er fort, „die wollen nicht darüber reden. Was sie erlebt haben, ist grausamer, als wir uns das vorstellen können.“
Zum erstenmal hatte ein Lehrer auch nur soviel zu ihnen gesagt. Nicht mehr, als sie ohnehin schon gewußt hatten. Aber in seiner Stimme hatte Bewegung gelegen.
Was hatten sie damals erfahren, als sie noch klein waren und mit einem norwegischen Papierfähnchen, das die Erwachsenen ihnen in die Hand gedrückt hatten, auf die Straße gerannt waren? Norwegen hatte den Krieg gewonnen! Yippieyeh, yippieh, yiippieh-yeh! hatten sie gesungen.
Drei, vier Jahre alt, waren sie mit den großen Kindern losgezogen. Hatten V auf das Kopfsteinpflaster geschrieben. Das war der erste Buchstabe, den sie lernten. Er bedeutete „vant“, gewonnen. Den Krieg gewonnen! Für sie hatte es bis dahin nichts anderes gegeben als „Krieg“. Was war der Krieg? Nun war er weg. Und Norwegen hatte ihn gewonnen. Hurra!
Aber jetzt – jetzt sind sie zehn Jahre älter. Jetzt sitzen sie hier vor ihrem Lehrer und wollen wissen, was damals eigentlich passiert ist. Norwegen hat gewonnen. Ja. Aber was hat es gekostet? Junge Männer hatten graue Haare bekommen. Die Schüler der 1 B senken die Köpfe über ihre Tische. Aber Muldvig sagt nicht mehr.
Zwei Tage später stand morgens, als sie zur Schule kamen, mit weißer Kreide am Tor: „Es gibt nur einen Führer!“ Da sahen sie Torsrud wie einen Schatten, er sprang vom Fahrrad, hüpfte hoch, denn es stand ziemlich weit oben, hüpfte noch einmal hoch und versuchte die Schrift mit der Hand wegzuwischen. Er war wie wild. Und er bekam es auch nicht richtig weg. Sie hatten einen Lehrer noch nie so wild gesehen.
Jetzt griff der Konrektor ein. Einzelne Jungen, aus der 1 B und anderen Klassen, wurden zum Rektor befohlen.
„Sie wissen nicht, was das bedeutet“, sagte Liv Abrahamsen. „Sie glauben, das wäre ein Spiel.“ Ihr Vater hatte in Sachsenhausen gesessen, er war Pastor und hatte sich nicht beugen wollen. „Aber er redet auch nie darüber“, fügte Liv hinzu.
„Muß man das denn so schrecklich ernst nehmen? Die machen sich doch bloß einen Jux“, sagte Rolf Magnor.
„Das haben sie damals auch gesagt. Sie haben über Hitler gelacht und ihn als Emporkömmling bezeichnet“, sagte Inger.
„Willst du etwa Kjell Grunder mit Hitler vergleichen?“ Alle sahen Inger an. Inger wußte nicht, was sie darauf antworten sollte.
„Es geht doch um Respekt vor anderen Menschen“, erklärte Liv. „Die, die das ans Tor geschrieben haben, haben keinen Respekt vor den Lehrern, die im KZ waren.“
Als die Jungen vom Rektor zurückkamen, einer nach dem anderen, sagten sie nichts. „Was hat er denn gesagt?“ fragte die Klasse in der Pause.
„Ist doch egal.“
„Ich schwöre bei Gott...“
„Ach, halt die Fresse!“
„Die knebeln uns, wie sie selber geknebelt worden sind.“
„Das ist nicht dasselbe.“
„Ist es wohl. So, wie sie uns tyrannisieren, sollte man nicht glauben, daß sie je tyrannisiert worden sind.“
Die Klasse stritt sich. Wer hatte recht? Wen konnten sie fragen? Davidsen. Der war nicht so alt. Im Krieg war er noch ein Schuljunge gewesen. Er hatte nicht vergessen, wie es ist, jung zu sein.
„Davidsen, warum mußten die Jungen deshalb zum Rektor?“ Rolf Magnor fragte. Er war dafür geeignet. Klang immer aufrichtig. Davidsen schluckte.
„Darüber macht man keine Witze.“
„Aber das macht ihr doch selber auch.“ Das war Inger.
„Ihr erzählt nur Heldengschichten. Sabotage, und wie die Leute nach Schweden geflohen sind. Nie erzählt uns jemand, wie es wirklich war.“
„Aber die Heldengeschichten sind auch ein Teil der Wirklichkeit.“
„Nicht alle waren Helden.“
Nicht alle waren Helden? Die, die keine Helden waren, waren Landesverräter. Was hatte sie jetzt sagen wollen?
„Nein, einige standen auf der falschen Seite“, erwiderte Davidsen. Inger schwieg. Liv meldete sich. „Ich finde es richtig, daß eingegriffen worden ist“, sagte sie. „Wir jungen Menschen von heute begreifen nicht, wie es im Krieg war.“
„Ich glaube, da hast du recht, Liv. Aber ihr könnt lesen.“
Was sie lesen sollten, sagte er nicht. Wieder verstummten sie. Was Liv sagte, hatten sie immer schon gehört. Im Krieg waren sie noch so klein gewesen, daß sie nichts verstanden hatten. Das schien ihr Fehler zu sein. Daß sie es sich einfach erlaubten, heranzuwachsen, ohne den Krieg erlebt zu haben. Es schien fast, als ob die Erwachsenen deshalb sauer auf sie wären. Aber was sollten sie dagegen tun? Sie waren nun mal 1941 und 42 geboren. Sie waren nun mal in die schlimmsten Jahreszahlen der ganzen Weltgeschichte hineingeboren worden. Sie waren nun mal geboren worden, während die Generation ihrer Eltern und ihrer Lehrer gefoltert und ermordet und inhaftiert und geschlagen worden war. Dagegen konnten sie nichts machen.
„Davidsen?“ fragte Astrid mit ihrer heiseren und ein bißchen frechen Stimme. „Stimmt es, daß Torsrud im KZ gesessen hat?“
Die ganze Klasse war erleichtert, weil endlich jemand diese Frage gestellt hatte. Aber Davidsen war sichtlich entrüstet. Er hatte ihren Tonfall falsch verstanden und sagte nur: „Ich glaube, wir gehen jetzt zum Unterricht über. Ich kann doch hier nicht über meine Kollegen sprechen.“
Und damit mußten sie Seite 5 im Lesebuch aufschlagen, wo sie in der letzten Stunde aufgehört hatten. „Die Mähmaschine kommt ins Dorf“ aus „Segen der Erde“ von Knut Hamsun. Die neue Zeit hat Sellanraa erreicht. Es sei eines der schönsten Bücher der neueren norwegischen Literatur, hatte Davidsen gesagt. Es hatte den Nobelpreis erhalten. Und als Hamsun bei der Schwedischen Akademie den Scheck in Empfang genommen hatte, war er ihm gleich wieder aus der Tasche gefallen. Zum Glück hatte das jemand gesehen und den Scheck aufgehoben. „Vielen Dank“, hatte Hamsun gesagt.
Beate hatte das ganze Buch gelesen. Jetzt las Inger es auch. Es war das beste Buch, das sie seit „Vom Winde verweht“ gelesen hatte. Vorher hatte sie nur Kinderbücher gekannt. Die Geschichten von Annik Saxegard über Tiere, die reden und denken konnten, und Pippi Langstrumpf, die ihr Pferd hochstemmen konnte, die die Großmutter liebte und immer wieder laut vorlas. Mit dreizehn hatte Inger angefangen, Erwachsenenbücher zu lesen. Da trat Scarlett O’Hara in Ingers Leben.
Erwachsenenbücher waren Bücher, in denen Erwachsene Dinge taten, über die sie niemals sprachen. Deshalb waren sie so spannend. In den letzten Sommerferien hatte sie Abend für Abend in ihrem Zimmer auf Tjøme gelegen und „Vom Winde verweht“ gelesen. Am Ende der 890 Seiten war sie total verzweifelt darüber, daß Schluß war. Das Buch strömte durch sie hindurch, wie noch niemals ein Buch geströmt war. Wie ging es weiter? Sie lebte doch. Es hörte nicht dort auf – auf der letzten Seite des Buches. Sie dichtete weiter daran, wollte nicht, daß Schluß war. Aber ihre Worte waren zu kindlich. Schlimmer als in einer Illustrierten. All das, was sie empfand, konnte sie nicht in den Sätzen über Scarlett O’Hara unterbringen, die in ihr weiterlebte.
Immer, wenn sie diese Bücher las, wünschte sie, dabeizusein und helfen zu können. Wenn sie weinten und verzweifelt und ganz einsam auf dieser Welt waren, hatte sie solche Lust, ins Buch hineinzugehen und zu sagen: „Aber ich bin doch bei dir!“ Sie las „Anna Karenina“. Das war noch schöner als „Vom Winde verweht“. Anna verliebte sich bei einem Besuch in Moskau in Fürst Wronski, und als ihr Mann sie bei ihrer Rückkehr auf dem Bahnhof abholte, fand sie seine Ohren so schrecklich groß. Das war das Treffendste, was Inger je gelesen hatte. Als sie am Ende des Buches ankam, war sie ganz außer sich, weil sie nicht dasein konnte, als die Lokomotive kam.
Bis zu diesem ersten Herbst in der neuen Schule war Inger mit all dem ganz allein gewesen. Die anderen hatten die Liebesgeschichten der Illustrierten über Erwachsene gelesen. Auch Inger machte das eine Zeitlang. Aber eines Tages entdeckte sie, daß immer wieder die gleiche Geschichte erzählt wurde. Sie hörte auf damit, und damit war sie allein.
Aber dann kam Beate. Es stellte sich heraus, daß die stille, blasse, engelhafte Beate die allergeheimsten Dinge über Erwachsene gelesen hatte. Sie erzählte, daß die Ausgabe von „Segen der Erde“, die sie in der Schule verwendeten, nicht das ganze Buch war. Die Schulbehörden hatten Stellen gestrichen, die nicht für junge Augen geeignet waren. Im ungekürzten Buch stand: „Nachts war er gierig nach ihr, und dann bekam er sie.“
Inger und Beate dachten an Inger mit der Hasenscharte, die Isak bekam. Sie gingen auf dem Schulhof hin und her und sprachen über das Leben der Erwachsenen. Es war seltsam, das mit jemandem teilen zu können. Inger glaubte, niemals einem Menschen begegnet zu sein, der genauso wie sie über die Dinge dachte, an die man nicht denken durfte. Die Liebe. Um die es doch im Leben ging. Sie lag allem anderen zugrunde.
„Einen Fehler haben die Erwachsenenbücher“, sagte Inger. „Die Personen darin haben immer ein Geheimnis, das sie bewahren oder über das sie nicht zu sprechen wagen, und deshalb werden sie von den anderen Personen im Buch mißverstanden. Warum sagen sie nicht einfach Bescheid? Dann würde nicht soviel Leid geschehen.“
„Aber dann gäbe es vielleicht auch kein Buch?“ meinte Beate.
Bücher über den Krieg lasen sie nicht. In denen liebte sich ja niemand. Nicht in denen jedenfalls, von denen sie gehört hatten. Darin bekamen die Leute nur Kinder. Sonst könnten sie sich ja hier und heute nicht den Kopf zerbrechen. Nein, im letzten Jahrhundert hatten sie noch geliebt! Wer doch im letzten Jahrhundert leben könnte! Auf einer Neusiedlerstelle weit weg von den Menschen, mit grünen Hügeln und harter Arbeit. „Warum sind Isak und Inger so glücklich?“ hatte Davidsen gefragt. Als niemand eine Antwort geben konnte, erklärte Davidsen, daß es daran lag, daß sie sich langsam hocharbeiteten – Schritt für Schritt, durch viele Jahre hindurch. So war das Glück. Es war nichts, das einfach so kam.
Aber Mama sagte, das Glück sei kein Zustand. Glück bestand aus Momenten, die kamen, oft, wenn man nicht wußte, daß man glücklich war. Erst später konnte man vielleicht sagen: Damals war ich glücklich. Das Glück war fast eine Form von Unwissenheit. „Dann sind wir vielleicht die Glücklichsten von allen?“ fragte Inger. „Wir, die im Krieg geboren sind und von nichts eine Ahnung hatten?“ – „Ja, vielleicht seid ihr das“, antwortete Mama.
Mama hatte oft gesagt, daß der Krieg das Schlimmste sei, was je passiert war. Er rief das Schlimmste und das Beste in den Menschen hervor. Für die meisten Menschen in Norwegen war Krieg nur ein Zustand. Ein ewiges Warten. Also beschäftigte man sich damit, Gerüchte über die Leute zu verbreiten, die „auf der falschen Seite standen“, Geschichten, die sich die anderen oft einfach aus den Fingern gesogen hatten. Oder darüber, wie die Deutschen norwegischen Frauen die Brüste abgeschnitten und sie im Schloßpark hatten liegen lassen. Das alles stimmte nicht. Die, die aus Deutschland zurückkamen, die wirklich die Schrekken des Krieges erlebt hatten, erzählten nichts dergleichen und beteiligten sich nicht an Hohn und Spott. Die, die nichts erlebt hatten, waren die Schlimmsten, sagte Mama.
Das hatte Inger ihr Leben lang gehört, aber sie konnte es niemandem weitersagen. Wenn sie das versuchte, bekam sie nur zu hören, daß alle Deutschen und alle NS-Mitglieder Schweine gewesen seien. Jetzt sagte sie zu Mama: „Aber die, die in die NS eingetreten sind, die waren doch auf der falschen Seite?“ – „Ja. Aber es gab so viele Gründe, warum sie in die NS eingetreten sind. Und nachher läßt sich leicht sagen, sie hätten klüger sein sollen. Die Menschen lesen die Geschichte von hinten und verurteilen dann. Damals wußten wir vieles nicht, was wir seitdem erfahren haben. Wir waren verwirrt.“
„Damals wußten sie vieles nicht, was sie seitdem erfahren haben“, sagte Inger am nächsten Tag auf dem Schulhof zu Beate. „Man liest die Geschichte von hinten. Und dann läßt sich leicht behaupten, man hätte vorher klüger sein sollen.“
„Aber alle wußten doch wohl, daß die Deutschen uns überfallen hatten?“ fragte Beate.
„Ja, aber was sollten sie denn dagegen tun? Sie waren verwirrt.“
„Haakon VII. nicht“, antwortete Beate.
„Ja, aber der war schließlich auch König.“
„Nicht alle Könige treffen die richtige Entscheidung. Denk an alle die verrückten Könige, über die wir im Geschichtsbuch lesen. Aber Haakon VII. hat ‚nein‘ gesagt.“
Ja, das wußte Inger. „Das ‚Nein‘ des Königs wurde ein ‚Ja‘ zum Leben.“ Dieses Zitat hatte Papa oftmals bitter vor sich hingeflüstert. Es war unmöglich, mit Papa über den König zu sprechen. Aber das wollte sie Beate nicht erzählen.
„Meine Eltern waren Mitläufer“, sagte sie. Es war das erstemal, daß sie so etwas erwähnte.
„Mitläufer?“
„Ja. Sie haben weder ja noch nein gesagt.“
Beate hatte noch nie etwas von Mitläufern gehört. Sie hatte überhaupt nur wenig über den Krieg gehört. Im Krieg war ihr Vater verschwunden. Das hatte sie jetzt im Herbst ihre Tante sagen hören. Und am letzten Sonntag hatte sie zufällig gehört, wie ihre Mutter und ihre Tante über ihn sprachen, ohne zu wissen, daß Beate im Haus war. Sie hatte gehört, wie ihre Tante sagte, das mit Ola im Krieg sei furchtbar gewesen und traurig für Beate. Als sie hörten, wie Beate sich im kleinen Zimmer bewegte, hatten sie ihr Gespräch jäh abgebrochen. Danach hatten sich Beates Gedanken über ihren Vater geändert. Jetzt war sie sicher, daß die Deutschen ihn erschossen hatten. Das war die ganze Erklärung, und es tat so weh, daß ihre Mutter nicht darüber reden wollte. Aber als sie später in der Woche ihre Tante gefragt hatte, hatte die nur dasselbe gesagt wie schon einmal. Der Ola war einfach verschwunden.
„Ich weiß nicht, was meine Eltern während des Krieges waren“, sagte Beate. „Jedenfalls waren sie gute Norweger. Meine Mutter zumindest. Mein Vater ist einfach verschwunden.“
„Verschwunden?“
„Ja.“
„Aber warum?“
„Ich glaube, die Deutschen haben ihn erschossen“, antwortete Beate.
„Aber weißt du das denn nicht sicher?“
„Nein. Er ist 1943 verschwunden.“
„Weiß deine Mutter das denn nicht?“
„Die kann ich nicht danach fragen. Sie waren nicht verheiratet, weißt du. Und sie saß da mit der ganzen Schande. Das war ich, verstehst du.“
Inger wußte nicht, was sie dazu sagen sollte. Sie wußte, daß Beate keinen Vater hatte. Aber sie konnte sich nicht vorstellen, daß es Mütter gab, die ihren Kindern nicht die Wahrheit sagen wollten. Zu Hause erfuhr sie immer, was früher passiert war, so schlimm es auch sein mochte. In ihrer Familie waren beide Seiten vertreten gewesen, Widerständler und Landesverräter, es hatte Scheidungen und Tragödien gegeben. Aber Mama versuchte nie etwas zu verheimlichen.
Inger ahnte auch nicht, was es für ein Gefühl war, ein Kind zu sein, das eine Schande darstellte. Sie begriff ohnhin nicht, was dieses Wort „Schande“ eigentlich bedeutete. Irgendwer hatte einfach erfunden, daß es eine Bedeutung hatte.
„Schande ist nichts“, sagte Inger. „Sie ist bloß Luft. Nur etwas, das irgendwer erfunden hat. Es gibt keine Schande. Es gibt bloß echt und unecht.“
„Aber ein uneheliches Kind ohne echte Familie ist auch irgendwie nicht echt.“
„Nein“, widersprach Inger. „Stimmt nicht. Unehelich ist bloß ein blödes Wort. Du bist genauso Mensch wie ich!“
Da nahm Beate ihre Hand. Sie gingen weiter. Machten am Ende des Schulhofes kehrt, so wie alle anderen. Alle gingen hin und her, hin und her. In jeder Pause fand eine richtige Völkerwanderung statt. Niemand hier rannte. „Inger?“ fragte Beate. „Das, was ich dir erzählt habe, weißt du? Das darfst du keiner Menschenseele weitersagen.“