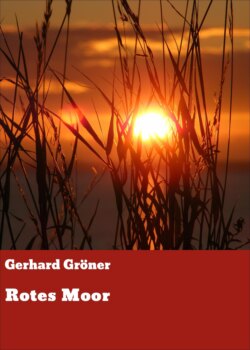Читать книгу Rotes Moor - Gerhard Gröner - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Kapitel
ОглавлениеSeit Menschengedenken waberten im Herbst dichte, Rheuma auslösende Nebel vom Donaumoor ins Dorf hoch. Schroffe, hellgraue Kalkfelsen, die hoch und zerklüftet aus der Humusdecke ragten, ächzten Jahr für Jahr unter winterlichen Frosteinbrüchen. Kälte und Nebel konnten von den gleichmäßig gewachsenen, immergrünen Wacholdersträuchern am Hommelberg nicht aufgehalten werden, veränderten in Menschen, was als Seele bezeichnet wurde. Zu allen Zeiten.
Unauffällig an den Aufstieg zur Schwäbischen Alb geklebt duckten sich zwei Dutzend Bauernhäuser einstöckig unter den scharf pfeifenden Westwinden. Keine Wand, kein Dach schützte wirkungsvoll vor überraschenden Temperaturstürzen und Stimmungsschwankungen im kargen Weiler Hattelfingen. Männer und Frauen fühlten sich dem wechselhaften Klima ausgeliefert. Dennoch trotzten sie laut als müssten sie unliebsame Geister verscheuchen:
„Bequem ist für faule Stadtleut“, riefen sich die „Älbler“ zu, wenn sie nach bitter kalten Nächten ihre Laufwege durch meterhohe Schneewehen frei schaufeln mussten. Sicheren Halt gaben klobige, aus Weiden geflochtene und grobem Holz gehobelte Schneebretter. Und dennoch waren Bauern und Knechte zufrieden. Bismarck hatte gerade Deutschland zusammengefügt und der Kanonendonner des ersten Weltkrieges brachte noch lange nicht das Trommelfell zum Zittern.
„Maria“, der Kopfbergbauer hob den gichtkrummen Zeigefinger, „den Händler mit den Kienspänen fürs Licht brauchst nicht mehr auf den Hof zu lassen. Die harzigen Holzspäne zum Licht anzünden sind mit fünf Pfennig pro Bündel mittlerweile zu teuer und qualmen mir zu sehr. Die neuen Petroleumlampen rußen weniger und die Flamme ist hinter dem Glaszylinder sicher.“
„Ist recht Bauer“, war die knappe Antwort und Magd Maria hoffte, dass auch sie in ihre Kammer helleres Licht bekäme. Dann kniff sie die Augen zusammen und schaute nach dem einzigen Fortschritt im Dorf, dem runden, indigoblauen Zifferblatt mit vergoldeten Zahlen am quadratischen, weiß getünchten Wehrturm der bulligen Kirche.
Dieser massig aufragende Fingerzeig bekundete weit sichtbar Hattelfingen. Wären die vier Zifferblätter blaue Augen gewesen, sie hätten durch den dicht und schwefelgelb aus den Schornsteinen quellenden Rauch der Torffeuer geschaut und bunte Bilder überquellender Freude, überschäumender Liebe aber auch tiefem Leid aufgesaugt. In jeder Epoche.
„Zu Heilig Drei Könige, anno 1878.
Schöne Menschen sehen anders aus als hier. Elegante auch. Doch ehrlich sind Alt und Jung. Auch direkt, manchmal derb und erdig“, charakterisierte der von Ulm, weit aufs Land nach Hattelfingen versetzte Volksschullehrer am Feiertag die Menschen in seinem Tagebuch. Der schmale Lehrerlohn reichte kaum fürs Leben und so schrieb er die Ortschronik, trug Geschichten zusammen oder formulierte Briefe fürs Gesinde, das in dieser Zeit des Schreibens oft unkundig blieb. Der Lehrer, von dem auffiel, dass er nie mit einer Frau gesehen wurde, schrieb mit schwarzer Tinte und pedantisch polierter Stahlfeder, dabei klemmte er immer sein Monokel zwischen Wimpern und Wangenknochen: „Von der steinigen Landschaft geprägt, sind sie alle mit starkem, oft sturem Willen ausgestattet.“
Das Wort „jähzornig“ hatte er mit einem spitzen Messer wieder ausgekratzt, aus Angst, es könne jemand sein negatives Urteil in den geheimen Aufzeichnungen lesen. Doch der konzentrierte Fingerdruck aus seinen eher zierlichen Fingern auf die spitze Schreibfeder war als Prägung selbst nach Jahren im vergilbten Büchlein wie ein Menetekel sichtbar, „...zornig“.
Ein Tagebuch weiter schien sich eine Meinungsänderung anzudeuten: „Nach einem Jahr hier sehe ich einen Zukunftsschimmer für Hattelfingen, später jedoch, wenn die Industrialisierung an diesem Ende unserer Welt Fuß fassen kann. Ich mag es ihnen wünschen.“
Eine hellgelbe Schicht aus aufgewirbeltem Straßenstaub bedeckte ganzjährig die Ziegeldächer. Selbst Mensch und Tier waren damit in den trockenen Sommermonaten überpudert. Breitkrempige Hüte hielten Bauern und Knechten den vom ausdauernden Westwind verwehten Staub aus den Haaren. Frauen schützten ihre einfachen Frisuren mit blau weiß karierten, von harter Arbeit durchschwitzten Kopftüchern aus grobem Leinen.
Der poröse Kalkstein unter der Erdkrume hielt soeben genügend Trinkwasser für Mensch und Tier, von Frauen mit Seilwinden geschöpft aus tief gebohrten Brunnen. Für tägliche Körperwäsche war kaum ein Tropfen übrig und das tiefer liegende, feuchte Donaumoor war mehr gefürchtet als beliebt, gierig verschlang das Moor alles was sich näherte.
Mit dem Anbau von Kartoffeln, Rüben, einem Jahr später Weizen und Mais wollten die Bauern dem Sumpfgebiet neues Ackerland abringen doch jede Art Saatgut ersoff im nassen Dunkel. Auch mancher übermütige oder betrunkene Knecht war darin spurlos verschwunden und Kaiser Wilhelm II. steckte die letzten Goldreserven in die Rüstungsindustrie für dicke Kanonen. Keine der wohl formulierten Bitten aus Hohenzollern-Württemberg um notwendige Wasserpumpen und Leitungen, fand Gehör in Berlin. Zu weit entfernt lag diese militärisch und wirtschaftlich unbedeutende Landschaft.
Erst drei Generationen später, in den Fünfzigern des zwanzigsten Jahrhunderts, sollten Brunnen, großvolumige Pumpanlagen und Leitungen die Dörfer auf der Alb mit genügend Frischwasser versorgen. „Ob mehr Komfort auch mehr Liebe zu den Menschen bringt?“, fragte Maria Geyer als das erste Rinnsal silbern und schüchtern aus neuen Leitungen blinzelte. Sie hoffte es und lauschte der Musik des Wassers.
Noch aber war zu Kaisers Wilhelms Zeiten kein Tropfen übrig und elektrischer Strom existierte nur in kühnsten Plänen. Nützlich war was Kraft kostete und Geld brachte. Die schönen Begleiter des Lebens waren verpönt. Keine zauberhaften Rosen blühten in Gärten verführerisch, keine Blütenpotpourris bespielten die Klaviatur der Düfte. Während der harten Tagesarbeit nahm selbst die blühenden Flechten niemand war, die bescheiden auf den Felsen der steilen Südhänge klebten, obwohl sie sich mühten, durch frische Farben die Augen auf sich zu lenken. Anthrazit, metallisch wirkten die einen, schwefelgelb, hell, die anderen und dazwischen leuchteten manche kräftig rot.
Auf Brachflächen wuchsen an starken Stängeln im Wind wiegend, üppige Disteln. Sie leuchteten den langen Sommer in sattem Purpur und Violett und dennoch, sie waren auf stachelige Abwehr ausgerichtet.
Rotbraune, angetrocknete Blutstropfen auf Felsen und Flechten wusch der Regen fort, mal gleich, mal erst nach Monaten. Hin und wieder schnupperte ein freilaufender Jagdhund daran. Ansonsten ignorierte die Albseele solche Reste eines freudlosen Lebens.
Im Dreißigjährigen Krieg waren zuerst die Schweden vom Lechfeld kommend durchs Dorf gezogen und plünderten Stall, Keller und Vorratsraum. Tage später wüteten die gegnerischen Österreicher. Höfe die nichts mehr hergaben, nicht Verpflegung, nicht Weiber oder Jungmänner als neue Söldner, wurden rigoros mit Pechfackeln in Brand gesteckt.
Als der Ziegelbauer, der ein paar Äcker und eine kleine Lehmgrube für Dachziegel betrieb sich wehrte, dass ihm schon wieder alles Federvieh weggenommen werden sollte, erstochen ihn die wüst schimpfenden Soldaten mit einer Hellebarde, vor den Augen seiner Frau und dem Gesinde. Nur seine Kinder durften zur Hinrichtung im Haus bleiben.
In den Wintermonaten bei Kerzenlicht, wenn die Feldarbeit ruhte, wurde diese Geschichte von Generation zu Generation weitererzählt. Gleich anschließend, hinter vorgehaltener Hand, die von einem blutigem Erbstreit und von mehreren Vergewaltigungen im Donaumoor.
Doch flimmerte selbst nach grausamen Taten wieder die Sommersonne über die nackten Felsen der Albkante, irgendwie hellgleißend, doch gütig und treu.
Die frohe Botschaft einer dauerhaft gottbehüteten Sonne predigte der Pfarrer, wobei ihm nicht verborgen blieb, dass Ungläubige unter seinen Schäfchen die Sonnenstrahlen auf den Felsen als ekstatisch tanzende Geister werteten.
Jahr für Jahr lag der Ertrag bei Weizen weit unterm Durchschnitt. „Die Erdägpfel“, klagten die Bauern in ihrem alemannischen Dialekt, „sehen manchjährig arg verschrumpelt aus.“ Nur das biblische siebte Jahr galt uneingeschränkt als gutes Erntejahr für Frucht und Kartoffeln. Und der breitschultrige Schmied der selbst beim allsonntäglichen Kirchgang durch das rußgeschwärztes Gesicht auffiel und durch Hände wie Schaufeln, vor denen jeder zähnefletschende Kettenhund am Hofeingang abduckte, der lebte gut davon, die von üppigen Steinen verbeulten Pflugscharen glatt zu hämmern und das glühende Eisen im kalten Wasser wieder zu härten.
Mühsam kämpften schweißgebadet, acht Monate im Jahr, Bauern und ihr Gesinde gegen schier unüberwindbare Unbillen der Natur.
„Los jetzt, in die Hände gespuckt“, hallte wie ein Wahlspruch der Albbauern über die Felder. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wurde geschuftet. Schwielige Hände und tiefe Falten in bronzen gegerbten Gesichtern spiegelten das harte Leben wider.
Schwarze Trachtenkleider für den Kirchgang am Sonntag und schwarze Anzüge der Männer wurden in Hattelfingen selbst während unbarmherziger Sommerhitze nie in Frage gestellt. „Was gut ist gegen d'Kält ist gut gegen d'Hitz“, galt uneingeschränkt.
Kleine Farbtupfer lugten unter der schwarzen Tracht hervor. Weiße Knopfleisten und Kragen der Blusen zierten Motive aus Kornblumen und Klatschmohn, in Rot, Grün und Blau gestickt.
Männer leisteten sich sonntags ein weißes Hemd oder zum Spaziergang, über die Hose hängend, ein weites, blaues Bauernhemd mit kleinem, rotweiß besticktem Stehkragen. Wochentags banden sie sich den blauen Arbeitsschurz um, mit einer Doppeltasche für den Schleifstein zum Schärfen von Sensen und Sicheln und das obligatorische Klappmesser.
Armut, Sparsamkeit und Tradition eröffneten keiner Jahreszeit die Chance, das „Häs“, wie die Kleidung genannt wurde, zu verändern. Temperaturschwankungen glichen höchstens aufgerollte oder zugeknöpfte Hemds- und Blusenärmel aus.
Einzig die klein gewachsene Angerbäuerin fiel aus der dörflichen Rolle. Sie trug in den Sommermonaten zu jedem Kirchgang weiße Spitzenhandschuhe und erweckte dazu noch den Eindruck, dass sie das Getuschele hinter ihrem Rücken vorbei gehe. „Herrgott nochmal, die wird’s vor dem jüngsten Gericht büßen müssen“, schimpften die alten Weiber, „doch ist die uns sowieso egal. Ja, sowieso.“
Irgendwie suchte auch Hattelfingen seine Außenseiter, die im heißen Sommer oder der Beschaulichkeit der Wintermonate, in denen dicke Holzscheite die Kachelöfen befeuerten, manchen im Puls herunter gefahrenen Geist erregte.
Im Zentrum Hattelfingen's bündelte die dicke Kirchhofmauer aus unbehauenen Bruchsteinen ihre Stille nach innen zu den Gräbern. Nicht zu übersehen unterteilten unterschiedliche Kreuze über den Tod hinaus in arme und reiche Familien.
Hölzernen Kreuze auf der schattenlosen Sonnenseite zeigten verstorbene arme Sünder an. Auf der ruhigeren, der kühleren, mit Büschen bewachsenen Seite, standen Bänke. Emaillebilder in schwarz/weiß der Verstorbenen zierten Grabsteine und kunstvoll geschmiedete Eisenkreuze. Hier wurde Status geprägt, die Grabstätten reicher Grundbesitzer zeigten her, wie sie gesehen werden wollten.
Von der Kirche hinaus führten Wagenspuren auf sternförmig angelegten Wegen. Über ihnen drehten sich in heißen Sommermonaten staubige Windböen hoch, die sich draußen auf Äckern und Wiesen verflüchtigten.
Gräben entlang der Wege transportierten nach anhaltendem Regen allen Unrat aus dem Dorf. Abfall, der zu keiner zweiten oder dritten sinnvollen Verwendung mehr genutzt werden konnte.
Haldenweg hießen die Verbindungsgassen, Bachweg, Moorweg oder Bleichwiesenweg. Auf ihnen hinterließen Zugpferde und Kühe ihre Spuren. Und unzählige, dicke Schweißtropfen von Rind und Knecht versickerten im hellgelben Schotter. Nur der Belag auf der Verbindung von Kirche zu Rathaus war verfestigt.
Das einzige Schild im Dorf zeigte die Hauptstraße an. Zehn Jahre später, kurze Zeit vor dem Wechsel zum zwanzigsten Jahrhundert, hieß sie dann Bismarckstraße, dann Adolf-Hitler-Straße und zu guter Letzt wieder Hauptstraße.
Den Pärchen, die mit gehörigem Abstand in den Dämmerstunden auf der staubigen Straße geneigt für eine Berührung flanierten, war der Straßenname zu jeder Zeit einerlei.
„Nur einen Kuss“, flüsterte der Bursche im blauen Bauernhemd und drückte das Mädchen in den Eingang des Rathauses, „nur einen, bitte.“
„Mehr geht heut auch nicht, Friedrich, nur einen. Und lass deine Hände weg von meinem Mieder. Mutter fiel bereits auf, dass ich in den letzten Tagen erst in der Dunkelheit nach Hause kam. Tagsüber faulenzen, schimpft sie mich, abends dagegen aktiv sein, was soll bloß aus dir werden!“
Kein Auspuffgas verpestete zu dieser Zeit die Luft und selbst den Kohlequalm aus Schornsteinen der Dampflokomotiven hatten die Menschen in dieser Gegend noch nie gesehen. Die erste Trassenplanung der Bahnstrecke von Ulm nach Heidenheim allerdings, hatte auf Pergamentpapier fein gezeichnete Konturen angenommen.
Für Mensch und Tier begann der Tag in der Früh mit den ersten Sonnenstrahlen und endete zu dieser Zeit, mangels elektrischen Stroms, direkt nach dem Sonnenuntergang. Zwischen Morgen und Abend verpflichtete harte Arbeit, unterbrochen nur durch ein habhaftes Mittagessen aus einer großen Bratpfanne. Mittig auf dem Tisch stand sie, aus dickem Eisen vom Dorfschmied gehämmert, gefüllt mit Bratkartoffeln oder Brotsuppe oder Eintopf, alles aus Restbeständen zusammen gebruzelt. Mit löffelweisem Schweineschmalz oder Schmalzgrieben auf Kalorien getrimmt.
Nur sonntags und an Feiertagen wurde frisch gekocht, Hefeklöße mit einem Stück Braten aus der Backröhre im riesigen, weiß emaillierten Küchenherd. Dazu Gemüse der Saison: Kohl, Karotten oder Lauch.
Jeder Bauer im Dorf sprach vor dem Essen ein Gebet und rüffelte ungeduldige Kinder und Bedienstete:
„Wer am Tisch nicht das Haupt senkt und gottesfürchtig betet, der brauchet heut nix zum Essen!“
Kindern wurde eine aufrechte Haltung am Tisch befohlen. Wer dies nicht begriff oder müde mit den Unterarmen auf den Tisch lümmelte bekam vom Hausherrn körperlichen Unterricht im aufrecht Sitzen: Die Ellbogen mussten weit nach hinten gestreckt werden. Quer zum Körper, zwischen weit nach hinten ragenden Ellbogen und geradem Rücken wurde einen Besenstiel gesteckt. So erzwangen strenge Familienväter eine unangenehme, klaglos zu erduldende, aufrechte Haltung.
Erziehung hatte hart zu sein, keinesfalls verständnisvoll.
„Reden beim Essen fördert den Husten“, fauchte das Familienoberhaupt redende Kinder an und zur Frau gewandt tadelte er: „Muss unsereins solch Taugenichtse großziehen!“
Kaum vier Generationen später sonnten sich Hattelfinger Urlauber am Strand auf Gran Canaria und Soldaten wurden zu Kampfhandlungen nach Afghanistan geschickt, um mit elektronisch ferngelenkten Drohnen, Raketen und Blendgranaten auf schlafende Menschen in Lehmhütten zu schießen und mit elektronischen Nachtsichtgeräten die stockdunkle, asiatische Nacht zum Tag zu machen.
Johannes Geyer, später schlicht Hans genannt, mit stattlichen vierundfünfzig Zentimetern auf die einsame Alb geboren, lag in der gepolsterten Holzkrippe des Kopfberghofes in Hattelfingen. Ein Privileg aller Säuglinge, das nur auf diesem Hof gepflegt wurde, egal ob Bauernkind oder Gesindeabkömmling. Denn die Mutter von Hans Geyer war Magd auf dem Kopfberghof und der Vater nur Knecht im Nachbardorf. Eine Krippe für alle frisch Geborenen wurde von den anderen Bauern mit Kopfschütteln quittiert, erst recht von den überheblichen Großbauern.
Die Rosshaarmatratze auf die jedes Wickelkind in dieser kinderreichen Zeit gebettet wurde, wusch die Bäuerin selbst intensiv über dem großen Stein im Weiher.
Die Mutter des kleinen Hans deckte ihn mit einer Gänseflaumdecke zu, streichelte über den schwarzen Haarflaum und sagte mit gefalteten Händen leise: „Hübsch bist du mit deinem Muttermal auf dem Wangenknochen. Liebes Hänschen, ich wünsch dir ein gesegnetes Leben, besser als das deiner armen Mutter. Und ich geb dir meine Liebe mit auf deine Lebensreise.“
In Buchenfelden, etwas höher auf der Alb gelegen wurde sieben Monate später Maria Renzer geboren. Gebettet in die hölzerne Lade, in der sonst Gemüse, Rote Bete, Rettiche und Karotten lagerten und die aus Schutz vor Mäusen an einem Balken aufgehängt war. Auch sie wurde mit einem weichen Flaumkissen zugedeckt.
Unter die kleine Maria, Tochter einer Tagelöhnerin und eines Knechtes wurde eine aus grobem Leinen zusammengenähte, feste Matratze gelegt, prall gefüllt mit Sägespänen, die der Vater, ein Holzknecht in der „Fürstlichen Holzsägerei“, umsonst erhielt.
Die zarten Fingerchen vorsichtig in Bewegung, lag Maria auf dem Rücken und blinzelte aus tiefblauen Augen verwundert in die erschreckend helle Welt.
Noch war keinesfalls sichtbar, dass in ein paar Jahren gerade diese beiden Abkömmlinge von einfachem Stand, Maria Renzer und Hans Geyer, in Hattelfingen euphorisch den Kopfberghof kaufen sollten.
Beide durften unabhängig und sieben Kilometer voneinander entfernt, Hans Geyer in Hattelfingen und Maria Renzer in Buchenfelden, ein paar Jahre zur Schule gehen. Lesen und Rechnen lernen war kurz vor dem Jahr 1900 unter Gesinde nicht üblich und zeigte die Weitsicht ihrer Eltern.
„Bibel lesen, schreiben und etwas rechnen sind großartige Gaben Gottes. Selbst Gesindekinder können dies lernen“, sagte der Pfarrer und so zerschliss nicht die harte Feldarbeit die Kinder Hans und Maria. Ihre Köpfe durften erleben, dass selbstständiges Denken wichtiger sein kann als Befehle der Herrschaften in Taten umsetzen.
Die letzten Jahre des neunzehnten Jahrhunderts verstrichen in Hattelfingen auf der Schwäbischen Alb noch bedeutungslos. Die Dorfgemeinschaft verhielt sich wie die melancholische Stimmung im feuchten Donaumoor. Sie suchten nicht wie Städter den Wandel, sie wollten nur ängstlich alles Bestehende bewahren.
„Diese verrückte Entscheidung, von Gulden mit 60 Kreuzern auf Mark mit 100 Pfennig umzustellen, war niemals notwendig“, sagten die Bauern, „ich rechne immer noch um, auch wenn nun das Dezimalsystem gilt. Hoffentlich widerfährt dies später keiner anderen Generationen, es wird damit sowieso alles teurer.“
Das Deutsche Kaiserreich der Preußen dagegen strotzte vor stolzen Veränderungen. Bismarck schmiedete nach dem gewonnenen Feldzug gegen Frankreich in den Jahren 1870 und 1871 die sich neidvoll beargwöhnenden deutschen Herzogs- und Königshäuser enger zusammen. Der Erfolg über den linksrheinischen Erzfeind verwob die aus Gründen des Machtzuwachses kreuz und quer verheirateten, doch durchaus unterschiedlichen und in eifersüchtiger Abneigung funktionierenden Adelshäuser, zum Deutschen Reich.
„Wir, die hochwohlgeborenen, von Gott erwählten Blaublütigen. Und die uns untergebenen Handwerker und Bauern“, differenzierten die Adeligen zu Kaisers Geburtstag beim Knall der Champagnerkorken. Dabei planten sie die Zukunft: „Keiner wird wohl auf die verwegene Idee kommen, dem Volk das Reiten zu lehren, sie mögen neben den Rössern gehen. Und noch weniger wird je ein Bürgerlicher die Laufbahn eines Offiziers einschlagen können!“
Die Hauptstadt Berlin mauserte sich zum Zentrum von Intelligenz, Politik, Militär und zog Künstler aus ganz Europa an. Und schon damals bewegten sich im morastigen Fischgrund die Lobbyisten der neu entstehenden Industrie.
Hinter dem alles Deutsche glorifizierenden Sieg über den Erzfeind westlich des Rheines versammelten sich bald viele politische Fahnen unterschiedlicher Schattierungen. Doch unterbezahlte Fabrikarbeit und das marode preußische Adelshaus provozierte die im Untergrund agierenden rechten und linken Vordenker zu neuen Theorien. Erste Flugblätter flatterten nachts durch die Straßen.
Städte, die politisch etwas auf sich hielten, ließen auf ihrem höchsten Punkt einen monumentalen Bismarckturm erbauen. Zu pompösen Einweihungsfeiern fuhren Fahrradkorsos mit bunten Bändern in den Speichen, Herrschaften saßen im Vierspänner und vereinzelt zeigten sich erste Kutschen mit Benzinmotor, deren knatternde und stinkende Maschinen alle Pferde scheuen ließen.
Im Ruhrgebiet drang die Industrialisierung mit metallisch dröhnenden Schritten voran, Hochöfen glühten rund um die Uhr. Hohe eiserne Türme, weit überspannende Brücken und dicke Kanonen wurden geschmiedet und genietet. Im Tal der Wupper wurde als Verkehrsmittel der Zukunft eine weltweit anerkannte Ingenieurleistung umgesetzt: Die sich unter Eisenträgern über den Fluss schlängelnde Schwebebahn. Sie verband die aufstrebenden Städte Barmen und Elberfeld und sollte im Jahr des Herrn 1900 eingeweiht werde. Ein Jahr Verzögerung, ein Thema bei allen Prestigebauwerken, hielt den Kaiser von der Einweihung nicht ab und weit über hundert Jahre später sollten noch Touristen im kaiserlichen Plüschwaggon bei einem „Bergischen Kaffee“ über die Wupper schweben.
Kohle und Erz, das klang wie nie endende Zukunftsmusik und zog Menschen weit über die Landesgrenzen an. Schmiedehämmer und Schleifsteine wurden noch mit Wasserrädern, bald darauf mit riesigen Dampfmaschinen und wenig später mit Motoren bewegt. Stahl wurde zur Zukunftstechnologie und Geldgarantie.
In Württembergs Armenhaus, der Schwäbischen Alb spannten die Bauern für die kargen Ernten noch Ochsen vor grob geschreinerte Karren mit Holzspeichenrädern.
Die menschliche Kraft wurde hier noch nicht durch Maschinen ersetzt und dennoch miserabel entlohnt.
Ein ehemaliger Knecht kam aus Essen im Ruhrgebiet ins Dorf zurück und berichtete:
„Wir streiken zurzeit bei Krupp in Essen, ich wurde kurzfristig freigestellt, geh aber bald wieder hin, sonst wirbt die Werksleitung immer neue Arbeiter aus Masuren und Schlesien an. Die sind billiger als wir, die drücken auf unsere Löhne und werden als Streikbrecher eingesetzt.
Ich geb zu, die Arbeit in metallisch dröhnenden und stickigen Werkshallen ist schwerer als auf einem Bauernhof. Doch die Entlohnung ist deutlich höher. Und gutes Geld fließt gleichmäßig, Woche für Woche.“
„Wenn unser Gesinde nun nach Geld giert, dann Himmel und Herrgott, Gnade über uns“ fluchte der als geizig bekannte Bauer vom Ludwigshof. Eine neue Zeit mochte er sich nie und nimmer vorstellen.
„Ins Ruhrgebiet gehen doch nur Verrückte hin, die teilen sich in Untermiete eine Bettstelle für zwei Leute. Einer schläft nachts und arbeitet tagsüber, der andere arbeitet Nachtschicht und schläft über Tag im gleichen Bett“, schimpften bald alle Bauern in Sorge um teure Veränderungen beim Hofgesinde, denn jeder von ihnen hielt sich billig Mägde und Knechte. Reiche Großbauern nannten gar Hilfsknechte und Hilfsmägde ihr Eigen, meist bedauernswerte, schamlos ausgenutzte Kinder aus Inzucht, gezeugt in zu langen Winternächten mit unbegehbaren, verschneiten Verbindungswegen.
Lange noch wurden in den abseits liegenden Albdörfern diese armen Geschöpfe wie ein von der Staupe befallenes Nutztier gehalten.
Gegenüber dem gemauerten Bauernhaus stand, zum Schutz vor schlechtem Wetter ebenfalls massiv gemauert, der Stall für Pferde, Kühe und zwei, drei Schweine. Anschließend, mit einem Durchgang verbunden, der Stadel für Heu, Stroh und Futterrüben, daran angebaut ein kleinerer Holzstall für einen Hahn und sein Hühnervolk, umgeben von einem Drahtzaun gegen nächtliche Angriffe hungriger Füchse. Daneben der durchlüftete Holzstadel für Brennmaterialien, Holz und Torf. Und nicht nur hinter vorgehaltener Hand, unter beflissentlichem Wegsehen des Pfarrers, mussten hier im zugigem Torfstadel die zwischen Bauer und Magd oder innerhalb der Blutsverwandten gezeugten Hilfsknechte und Hilfsmägde, zerlumpt und ohne Zugang zu Wasser oder Toilette, dahinvegetieren.
Ihre Behinderungen bekam nie ein Arzt zu Gesicht. Die Entlohnung für Drecksarbeit, wie Gülle aus der Grube schaufeln oder faulige Kartoffeln auslesen, bestand aus vertrockneten Brotkrusten in Milch oder an Feiertagen, Mehl mit Schweinefett zu Klumpen gerührt und in der Pfanne angeröstet.
Der alte Kopfbergbauer, ein nachdenklicher, unaufgeregter Mann, der selbst nach harten Jahren auf den Äckern immer noch wie ein Intellektueller wirkte, übertrug mehr Verantwortung als die anderen und wurde deshalb oft getadelt: „Gib deinen gemeinen Gehilfen nicht Bürde und Befugnisse, dazu sind die nicht geboren!“
„Was kümmern mich die anderen, unser Bauernwerk ist klein“, sagte er zur Bäuerin die ähnlich fühlte wie ihr Mann, „bei uns muss und darf jeder alles können.“
Gemeint waren damit der noch jugendliche aber starke, auf dem Hof geborene Knecht Hans Geyer mit den schwarzen, leicht welligen Haaren und dem Ausdruck von Entschlossenheit im Gesicht und Knecht Fritz, ein kleiner, drahtiger Mann mittleren Alters, der mit heller, eindringlicher Stimme im Stall regierte.
Hans Geyer vertrug sich mit dem Stallknecht Fritz und wollte sich dennoch von ihm abheben. Als äußeres Zeichen trug er den lieben langen Tag ein am langen Riemen befestigtes Ochsenhorn um die Hüfte, in dem ein Schleifstein zum Schärfen der Sense steckte. Seht her, sollte dieses dörfliche Prestigeobjekt aussagen, ich mähe Frucht und muss nicht nur Garben und Stroh tragen, ich bin fast gleich dem Bauern.
Zu Pfingsten stellte der Kopfbergbauer noch die junge Magd Maria Renzer aus Buchenfelden ein. Das war notwendig, denn Friederike die Tochter der Kopfbauern wurde selten im Hof und noch seltener auf den Feldern gesehen.
„Hab zu deiner Entlastung eine Jungmagd eingestellt, kann sogar lesen und schreiben“, sagte der Kopfbergbauer eines Abends zu seiner Frau.
„Prima, danke“, antwortete diese und dachte heimlich, vielleicht kommt die Zeit, in der wir Frauen ein Mitspracherecht bei solchen Entscheidungen erhalten.
Zur neuen Magd sprach der Bauer: „Kommst Dienstag nach Pfingsten, morgens bei Sonnenaufgang. Bringst dein Bündel mit. Die Bäuerin richtet eine Schlafstatt her. Wenn dich bewährst, Maria, bekommst zu Martini im November eine gute Entlohnung.“
„Ist gut Bauer, ich werd ihm die Arbeit hoffentlich recht machen.“
Wie bei einer zunächst lustigen, wilden, steilen Talfahrt auf hölzernen Schlitten beschleunigte ab diesem Zeitpunkt die Lebensreise von Maria und Hans.
Allerdings, von Jahr zu Jahr zunehmend nach Gleichgewicht suchend.
Hans Geyer der groß gewachsene, breitschultrige Knecht und die zierliche Jungmagd Maria Renzer, aus deren Antlitz auch nach tagelanger Arbeit die blauen Augen strahlten, lernten akkurat pflügen oder Getreide aus einem blechernen Bauchtrog sähen. Sie bündelten die Fruchtgarben zum Trocknen mit Strohstricken und ließen im Spätsommer mit Bauer und Bäuerin die hölzernen Dreschflegel im Viervierteltakt aufs Getreide tanzen.
„Bist noch ein bisschen schmächtig, Magd“, sagte der Kopfbergbauer zu Maria, wenn sie die Schwielen an den Händen zur Kühlung anblies, „das wird noch werden.“
Mutig schaute sie dann aus ihren blauen Augen und nickte still.
Einige Doppelzentner Weizen wurden vom Kopfbergbauer geerntet. Das Mehl fand Verwendung fürs Kochen, Kuchen backen und für Weißbrot. Etwas Roggen wurde für dunkles Brot und Mischbrot sowie fünf Sack Hafer als Pferdefutter gedroschen. Die angebaute Gerste wurde an eine Mälzerei verkauft, die daraus Malz für Brauereien und Malzkaffee keimte. Drei Sack Gerste stellte der Bauer auf den oberen Speicher. Sie wurde für die stark sättigende Graupensuppe verkocht, die jeden Montag, dem Wäschetag, von der Bäuerin aufgetischt wurde.
Neben Getreide säten und steckten die Kopfbergbauern Rüben als Viehfutter und Kartoffeln für den Eigenbedarf. Kleine Exemplare der Knollen wanderten gekocht in den Futtertrog der drei Schweine, von denen alle Winter eines geschlachtet wurde. Hühner mussten wegen frischer Eier mit reichlich Körnern ernährt werden. Vorsorglich für die kalten Winter, wenn die Hühner weniger legten, wurden Eier in einen Blecheimer gelegt, der gefüllt mit Wasserglas die wichtige Zutat für die Weihnachtsbäckerei konservierte.
„Und vergesst nicht die Gans für den Weihnachtsbraten zu mästen“, mahnte der Kopfbergbauer fast jeden Tag im Herbst.
Das gesamte Gesinde im Dorf, auch Maria, Hans und Fritz bei den Kopfbergbauern, ja selbst eingeheiratete Schwiegertöchter, sprachen die bäuerlichen Herrschaften in der dritten Form an, mit Sie oder Ihr, „soll ich ihr die schwere Kanne tragen, Kopfbergbäuerin?“
Nur Pfarrer und Lehrer in Hattelfingen waren sich des Familiennamens Ziegler bewusst, den seit Generationen alle Kopfbergbauern trugen. Die Bauern sprach man traditionell beim Hofnamen oder Gemarkungsnamen an und Handwerker bei Ihrer Tätigkeit, der Korbbinder Ludwig oder der Zimmermann Alfred oder der Müller Gottlieb.
Bäuerinnen und Frauen der Handwerker legten mit der Hochzeit ihre Namen ab. „Kopfbergbäuerin“ war die knappe Ansprache. Ihre Tochter hingegen wurde von Geburt an, in Kindergarten und der siebenjährigen Volksschule, „die Friederike vom Kopfberghof“ genannt. Erst kurz vor der Vermählung, die jedoch in unendlich weiter Ferne lag, hätte sie einen „richtigen“ Namen erhalten.
Sonderstellungen genossen nur Töchter von Pfarrer und Lehrer. Der Hattelfinger Pfarrer hatte keine Kinder, im Dorf munkelte man hinter vorgehaltener Hand über ein inniges Verhältnis mit der Hebamme. Genaueres hätte man gerne gewusst, doch Hochwürden und Hebamme wurden in zeitlichen Abständen immer wieder benötigt und man wollte es mit ihnen nicht durch direkte Fragen verscherzen. Die Lehrertöchter hörten geflissentlich auf die Namen Fräulein Selma und Fräulein Wilhelmine, in Ehrerbietung vor dem obersten Dienstherrn Kaiser Wilhelm.
Frauen waren den Männern untertan und unbesonnen wurden ihnen mit geweihtem Taufwasser in dieser Epoche Vornamen auf die Stirn gedrückt, die sich einfallslos an den männlichen orientierten: Antonia, Eugenia, Franziska, oder aus dem Bayerischen über die Sprachgrenze gewandert, Aloisia. Unrund klangen die mit „e“ endenden Vornamen Auguste, Hermine, Hubertine, Josefine oder Pauline.
Gänzlich ohne Vornamen wurden nur Leute angesprochen mit denen man wenig zu tun haben wollte. Der Seifensieder, oft niederträchtig Frau und Kinder schlagend, gleichzeitig unterwürfig den Großbauern nach dem Mund redend, war so einer. Seine struppigen Haare, sein grob gestutzter, fransiger Vollbart und die tief zerknitterte, fahle Haut verwehrte sich geradezu einer Namensgebung.
Er wohnte mit seiner Familie weit draußen in einer kleinen, notdürftig mit Lehm verputzten Unterkunft. Zwei Zimmer hatte die Behausung. Einen kombinierten, nicht unterteilten Ess- und Schlafraum, für Vater, Mutter und sieben Kinder. Daneben Küche und Plumpstoilette und anschließend einen Arbeitsraum in dem gewaschen und Kernseife hergestellt wurde.
Schwartenreste, Knochen und andere ungenießbaren Fette wurden aufgekocht. Ein übler Geruch wälzte sich schwerfällig vom Haus weg und die Kleider der ganzen Familie stanken nach ranzigem Fett.
Die im Dorf niedrig bewertete Arbeit des Seifensieders und der penetrante Geruch aus den rohen Fleischabfällen, brachte den fünf Mädchen im Einklassenraum der Schule täglich bösartig plumpen Spott ein, was die Lernmotivation nicht eben erhöhte. Sie wurden bereits jung zu so genannten „Wanderpokalen“ in den Bettkisten der Knechte und die beiden Jungs zu Raufbolden, die bald mit einem Wanderzirkus wegzogen und nie mehr gesehen wurden.
Die Seifensiederin sah diese Entwicklung und konnte sie dennoch nicht stoppen. Zu hart war täglich die körperliche Arbeit. Sechs Tage in der Woche zog sie mit der Handkarre in den Wald entlang des Lonetals, sammelte Holz und Tannenzapfen fürs Feuer unterm Kessel, aus dem sie spät abends noch die flüssige Seife in Formen füllte. Zwei rechteckige Seifen bildeten zusammen ein Stück, in der Mitte eine Nut, damit sie mit einem starken Messer auseinandergeschnitten werden konnten.
Getauscht wurden Kernseifen gegen Lebensmittel und verkauft an wandernde Händler. Aus einem kleinen Dorf in Richtung Heidenheim, in dem vier große Sippen Korbbinder wohnten, kamen diese Weidenflechter und Händler zum Seifensieder. Sie bezahlten miserabel, kamen aber regelmäßig.
„Rudolph halt still, wir haben das Geld bitter notwendig“, sagte seine Frau, wenn dieser sich über den zu geringen Erlös beklagte, „wir beide müssten zu viele Kilometer laufen um die Kernseifen unter die Leut zu bringen. Und die Bauern sind allemal geizig und die Korbflechter können jeder einzelne besser reden als wir beide zusammen.“
Die Korbflechter und Hauswarenhändler dagegen schimpften: „Mehr Geld ist nicht drin, musst halt fleißiger sein, Seifensieder. Kauf lieber deiner Frau einen neuen Korb von mir, du Geizkragen.“
Friederike, die Tochter des Kopfbergbauern, beobachtete gerne mit zurückhaltendem Abstand jegliche Hofarbeit. Sie war in einer Altersphase, in der gleichaltrige Jungs noch kindische Späße veranstalteten oder mit Steinschleudern den Wildtauben nachjagten, die Mädchen bereits von ihrer großen Bauernhochzeit träumen. Heimlich schaute sie oft durch zugezogene Vorhänge Hans Geyer hinterher. Sein ernstes Gesicht, die schwarzen, jeden Tag frisch gescheitelten Haare und sein unüblich aufrechter Gang hoben ihn von der Knechtschaft des ganzen Dorfes ab.
Friederike blieb bewusst im Wohnhaus. Sie wollte sich ihren unschuldig weißen Teint bewahren. Ihr widerstrebte, eine durch handfeste Arbeit auf den Äckern erdbraun gegerbte Gesichtshaut zu tragen, so wie es die einfachen Mägde mussten.
Eiserne Standesdünkel unterdrückten ihr jegliche freundliche Unterhaltung auch wenn sie dem jungen Knecht Hans Geyer zufällig im Hausflur körperlich näherkam. Zu gerne hätte sie in seine braunen Augen geschaut.
Hans Geyer, der seine Chance bei der jungen Dame fühlte, wollte keinen Streit mit dem Bauern. Es galt nicht nur in Hattelfingen: Geld zu Geld und Boden zu Boden. Hans Geyer wäre als Knecht für ein Verhältnis mit der Bauerntochter, das stand als ungeschriebenes Gesetz fest, im ganzen Dorf geächtet worden.
„Was nützt ein feuriges Abenteuer, wenn zwei unglückliche Seelen daran zerbrechen und dem Ergebnis daraus wie einem Mischlingshund „Bangert“ hinter hergerufen wird“, redete er sich realitätsnah ein. Meist wurde der Knecht in solchen Fällen vom Hof gejagt und die Jungbäuerin musste sich mit teurer Mitgift in ein weit entferntes Dorf verheiraten lassen, dorthin, wo sich die Schande noch nicht herumgesprochen hatte.
„Ich find bald eine rechtschaffene Frau“, sagte er sich laut tröstend.
Von den Eltern zu Bescheidenheit und Sparsamkeit erzogen, ließ sich Knecht Hans Geyer in dieser Phase der inneren Unruhe bei jeder sich bietenden Gelegenheit von Bildern mit schmucken, adeligen Offizieren beeindrucken. Der Kopfbergbauer spürte dies und erlaubte Hans das Wohnzimmer zu betreten, das nur sonntags nicht abgeschlossen war und das ohne ausdrückliche Erlaubnis weder Mägde, Knechte noch die eigene Tochter Friederike betreten durften.
Der Bauer bat Hans zu sich an den eichenen, ehrwürdigen Schreibsekretär und öffnete mit würdevoller Geste die mit Bienenwachs gut geschmierte Schublade. Er holte den mit dunkelrotem Samt überzogenen Pappkarton heraus, band behutsam die Schleife auf, hob den Deckel und zeigte eine Sammlung kolorierter Schwarzweißfotos.
Breite, adelige Männerbrüste standen im Mittelpunkt, verziert mit Schärpen aus feinster Moireseide und bunten Spangen, überfrachtet mit militärischen Orden. Mächtige, hoch gedrehte Bärte nach wilhelminischer Kaisermode schmückten alle Altersklassen, vorlaut schreiender Prunk und Protz einer Aufsehen erheischenden Soldateska.
Sie nahmen die Schachtel und breiteten den Inhalt auf der Sitzbank des riesigen, grünen Kachelofens aus, der im Winter von der Küche her befeuert wurde. Hans Geyer genoss das Privileg, mit seinem Bauern in der Wohnstube die Bilder von berühmten Heerführern und weitläufigen Verwandten anschauen zu dürfen.
„Na, Hans, gefallen dir Mannen in schmucken Uniformen, mit vielen Auszeichnungen?“ fragte der Kopfbergbauer. „Ich durfte nie eine tragen! Bei der großartigen Schlacht gegen die Franzosen, die diese selbst begonnen hatten, als wir 1870/71 Elsass-Lothringen heim holten, war ich leider zu jung und mittlerweile bin ich zu alt fürs Soldat sein. Das wär doch was für einen aufrechten Kerl wie dich. Ich will dich nicht wegloben aber du bist ein fescher und mutiger Bursch, du kannst in ein paar Jahren fürs Vaterland große Verantwortung tragen.“
„Ja, Bauer, ich geb ihm recht. Eine schicke Uniform, ein Säbel mit kunstvoll geschwungenem Handkorb und ein Gewehr. Das könnt mir gut zu Gesicht stehen“, antwortete Hans mit glühenden Augen.
Einen Monat später erklang von weitem in hellen Tönen die Fanfare des fahrenden Händlers, die Frühjahrestour führte seine pferdebespannte Verkaufskarre wieder nach Hattelfingen. Der hohe Kutschenwagen war außen mit polierten Pfannen, emaillierten Sieben und Kupferkesseln behangen, innen ausgestattet mit einer Vielzahl Schubladen für Stricknadeln, Hosenknöpfen aus Blech, bunten Garnen, Kämmen aus Horn, Schleifsteinen für Messer oder Leder zum Polieren der Rasierklingen.
Der sparsame Knecht Hans Geyer wiegte lange den Kopf hin und her. Nach kurzem Zögern sprach er sich Mut zu: „Ich möchte auch wirken wie die Soldaten auf den Bildern. Ich kaufe mir, wenn der Händler auf unseren Hof fährt, eine schwarze Bartwichse und die passende Bartbinde.“
Und kaum war das Bellen des scharfen Wachhundes verklungen, der an der Verkaufskarre mit Lederriemen in der Nähe der geheimen Geldschublade festgebunden war, hatte Hans sich mit flinken Fingern seinen Oberlippenbart schneidig nach oben gezwirbelt.
Stolz lief er am folgenden Sonntag durch Hattelfingen, nicht überheblich aber aufrecht, mit großen, wachen Augen und selbstbewusster denn je.
Heimlich musterten ihn die jungen Frauen. Manche Magd, die ihm zu einfach war und manche Bauerntochter, die nur kurz aus dem Blickwinkel linsen durfte, drehten sich verstohlen nach ihm um. Das Spiel aller Spiele war in vollem Gange und kreiste auch in diesem verschlafenen Dorf auf Hochtouren. Hans fühlte sich aufgewühlt gut, und dennoch, die sonntägliche Balzschau auf dem breiten Weg zwischen Kirche und steinernem Rathaus verunsicherte ihn eher, als dass sie ihm klare Erkenntnisse gebracht hätte.
So blieb es kaum aus, dass sich nach dem Motto, das Gute, das Bewährte liegt so nah, Knecht Hans Geyer und Magd Maria Renzer vom gleichen Hof näherkamen. Beim Bändertanz unter dem mit Silberdisteln, Stroh, Sicheln, Sensen und bunten Stoffbändern geschmückten Erntedankbaum fasste Hans zart um die schmale Taille von Maria und diese schmiegte Ihren Kopf an seine breiten Schultern. Doch noch ergab sich keine Gelegenheit mehrere Stunden alleine zu sein.
Im Winter sangen sie gemeinsam schwermütige, erdige Volkslieder und im Frühjahr Moritaten, die den Sommer herbeisehnten:
„Mariechen saß weinend im Garten,
im Grase da schlummert ihr Kind,
durch ihre schwarz-braunen Locken,
weht leise der Abendwind…“
Und immer noch traten andere Leute zwischen sie und verhinderten enge Umarmungen.
In den ersten Maitagen dann zogen Magd und Knecht zu Fuß, der Bauer auf seinem Ochsenkarren und die Großbauern mit dem Pferdegespann viele Tage ins Donaumoor hinunter, um Torf zu stechen.
Riesige Mengen Heiztorf mit niedrigem Brennwert wurden dem Moor abgetrotzt, für den nächsten langen, kalten Albwinter. Entwässert wurde diese Feuchtlandschaft zwischen Alb und Donau über den Kaisergraben, der gleichzeitig die Grenze zwischen Bayern und Württemberg darstellte. Das trocken gelegte Moor wurde danach von kräftiger Männerhand mit einem Spaten ähnlichen, U-förmigen Eisenschuh an langer Holzstange, in Brikettform herausgestochen.
Zum Trocknen stapelten Bäuerinnen, Kinder und Mägde die Moorbriketts. Zwei längs, darauf zwei quer, dann wieder zwei längs, zwei quer, bis zu acht Lagen hoch. Harte Arbeit, die schmerzhaft den Rücken beugte. Nach mehreren Monaten der Trocknung, zwischen Ernte und Herbst, wurde das Brennmaterial mit den schweren Ochsenkarren ins Dorf gefahren und in der Scheune neben der Einstreu für den Tierstall oder im Torfstadel gelagert.
Beim Entladen und bereits während der Arbeit im Moor sangen die Frauen Volkslieder: „Wenn wir schon unser Kreuz schinden müssen“, sagten sie, „dann lasst uns wenigstens singen.“
„Ich schlage vor“, sagte die Kopfbergbäuerin, „wir singen nun gemeinsam im Takt:
Ännchen von Tharau ist’s die mir gefällt.“
Und alle stimmten ein:
„Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld.
Ännchen von Tharau hat wieder ihr Herz
Auf mich gerichtet in Lieb und in Schmerz.
Ännchen von Tharau mein Reichtum, mein Gut,
du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut!“
Wie so oft waren die meisten mit dem auswendig gelernten Text nach der ersten Strophe am Ende. Doch die Kopfbergbäuerin wollte Grips zeigen und sang laut und auffordernd weiter. Zum Schluss stimmten dann alle wieder ein:
„Ich will dir folgen durch Wälder durch Meer,
durch Eisen, durch Kerker, durch feindliches Heer…
Was hat die Liebe doch für ein Bestand,
wo nicht ein Herz ist, ein Mund, eine Hand?“
Die Arbeit im Donaumoor war mühselig und Kräfte zehrend, sie quälte Bauern und Knechtschaft, Frauen und Männer gleichermaßen. Vom Sonnenaufgang, bis erlösend pünktlich achtzehn Uhr die Betglocke vom Kirchturm herunter schallte, wurde gestochen und gestapelt. Unterbrochen nur alle zwei Stunden durch eine kürzere Pause.
Herber Apfelmost aus einem zur Kühlung mit nassen Lappen umhüllten Tonkrug kreiste dann die Runde, dazu griffen die schwieligen Hände nach dick geschnittenem Schwarzbrot und zur Mittagszeit etwas geräucherten Speck. Eine karge Nahrung in heißer Moorlandschaft.
Maria und Hans sanken in den Pausen auf den weichen Boden und genossen die weitläufige Natur, beobachteten hochbeinige Störche die Frösche jagten und zarte weiße Wolken am Horizont der weiten Ebene.
Wenn am späten Nachmittag, nach vollbrachtem Tagwerk, den anderen im unwirklichen Donaumoor die Kondition ausging, der Bauer Punkt Glockenschlag zur Tierfütterung auf den Hof und die Bäuerin zum Kochen eilte, wenn die Helfer langsamen Schrittes den steilen Anstieg zur Alb hinauf trotteten, blieben Maria und Hans im weich federnden Grün zurück.
Hans nahm Maria behutsam die Spangen aus dem Haar und löste vorsichtig ihren Zopf. Sanft öffnete er ihre Bluse und die langen Schnüre des Mieders.
„Nicht Hans“, sagte Maria leise, „noch nicht.“
„Warum nicht, warum nicht, wenn du mich liebst. Ich liebe dich doch auch und wir sollten bei jeder Gelegenheit zeigen, dass wir uns lieben. Auf was müssen wir warten?“ Dann streichelte er behutsam ihre Brüste.
Maria steifte ihm feinfühlig die Hosenträger von den breiten Schultern:
„Ja, Hans, drück deine Brust an meine und streichle mein Haar“, flüsterte sie und seine Hand tastete sich sanft unter Marias weiten Rock, der knielangen Unterhose entlang nach oben, durch den zu dieser Zeit üblichen Schlitz im Schritt.
Hans legte sich auf Maria und sie streichelte mit warmen Fingern über das dunkle Muttermal an seinem rechten Wangenknochen, dann über seinen Rücken und sein muskulöses Hinterteil.
Jahre später dann, nach der Geburt ihrer drei Kinder, sagte Maria mit leerem Blick oft traurig: „Ich hör die Lerchen nicht mehr zwitschern und das Donaumoor riecht mittlerweile das ganze Jahr über nach modrigem Herbst.“
Doch noch hatten Maria Renzer und Hans Geyer einen langen, heißen Sommer vor sich und einen kuscheligen Winter mit etwas weniger Arbeit, dafür langen Nächten.
Der 11. November, der Martinstag und Lichtmess sechs Wochen später, waren im bäuerlichen Jahreskalender mit blauer Tinte dick eingerahmt.
Den Martinstag, in Hattelfingen kurz Martini genannt, sehnte das gesamte Hofpersonal den langen Sommer als Tag der Auszahlung herbei. Übers Jahr gabs nur Naturallohn, also Essen und Trinken, dazu ein knapp bemessenes Tages- und Kleidergeld. Der eigentliche Lohn in echter Goldmark wurde immer dann ausbezahlt, wenn alle Äcker abgeerntet waren, also zu Martini. An diesem Tag wurde auch die Pacht fällig, wenn ein Bauer einen oder mehrere Äcker angemietet hatte.
Die Frauen in Hattelfingen fürchteten sich vor diesem Tag denn die Männer, egal ob stolzer Bauer oder einfacher Knecht, beendeten ihn gemeinsam im Schankraum der Hirschenbrauerei.
Die Bauern saßen am langen Tisch, direkt an der Theke, die Knechte an den beiden hinteren Tischreihen. Auf dem Tisch der Bauern lag ein dunkelblaues, leinenes Tischtuch. Die Tische der Knechte waren aus gehobelten Fichtenbrettern zusammengezimmert und mit einer Drahtbürste grob geglättet.
Über allen Köpfen hing eine undurchdringliche Wolke Tabakrauch aus teuren Zigarren der Bauern, billigen Stumpen der Knechte und in Mode gekommenen kurzstieligen Pfeifen.
Die Bauern sprachen über die Ernte des sich zu Ende neigenden Jahres, der eine untertrieb wie jedes Jahr, der andere log ein paar Zentner Weizen dazu. Sie klagten über das Wetter und über den mehr oder weniger vorhandenen Fleiß ihrer Bediensteten.
Die Gespräche der Knechte, erst duckmäuserisch leise, nach zwei Stunden bereits stark alkoholisiert immer lauter, stellten die hübschesten Mägde in den Mittelpunkt, ihre Brüste, die im Sommer schweißdampfend durch die abgeriebene, dünne Leine der Bluse schienen und ihre geflochtenen oder gebundenen Haare.
„Wenn ich die mal im Stroh erwische, dann sag ich euch, dann gibt’s ordentlich Spaß.“
„Und ich erst. Die Hermine mit ihren prallen Brüsten. Die sonntags ihre Zöpfe an den Ohren zu Schnecken dreht. Ja, die möcht ich gern an den Schnecken packen und ein paar Stöße mit ihr reden.“
„Angeber, du großkotziger. Die sucht keinen solch dürren, abgehalfterten Kerl wie dich.“ Ungeschminkt wurde die Antwort der anderen über den Tisch zurückgeschleudert.
Bald war die hohle Prahlerei beendet und nach schnellem Abkühlen mancher überhitzten Phantasie wurde die Kochkunst einzelner Bäuerinnen gelobt. Und danach, hinter vorgehaltener Hand, wurde über die Bauern gelästert, ihre immerwährende Ungeduld und die offenbar auf allen Höfen weitervererbte Ungerechtigkeit gegenüber den ach so armen Bediensteten.
Stickig war die Luft nach kurzer Zeit, dicht angereichert vom tranigen Geruch des frisch geölten Holzbodens, vom Schnupftabak, Pfeifen- und Zigarrenrauch, dem alles überlagernden Aroma aus Bierkrügen und den in Runden kreisenden Schnapsstamperln.
Nach fünf oder sechs geleerten Steinkrügen und hochprozentigem Obstler wurde das Stimmengewirr immer lauter. Das viele Reden beruhigte jedoch kaum die übers Jahr angestauten, wirklichen oder vermeintlichen Ungereimtheiten:
„Ich muss immer schwerer arbeiten als du. Ich trag die Strohgarben vom Wagen in die Scheune und du schichtest sie nur auf, ich miste den Stall aus und du verteilst die frische Einstreu. Du bist ein gemeiner Faulenzer!“
„Das sagst gerade du Tagedieb...“
Argumente und deftige Schimpfworte flogen kurz vor Mitternacht lautstark über die Tische. Und, als stünde Jahr für Jahr das gleiche Drehbuch an, bald auch die Fäuste.
Hatten die Knechte Streit, interessierte es die Bauern nur am Rande. Gingen jedoch zwei oder mehrere Bauern aufeinander los, mussten jeweils die Knechte zu ihrem Bauern halten und auf die andere Seite einprügeln, auch wenn sie sich vorher noch gut vertragen hatten. Manche Nase blutete danach und manche Gesichtsschwellung musste noch Tage danach mit Arnikatinktur behandelt werden.
Und die Bäuerinnen waren oft über Monate gefordert, mit diplomatischem Geschick die zerstörte Nachbarschaft wieder ein zu renken.
Zu Lichtmess, dem Sonntag vierzig Tage nach verschneiten Weihnachten, zog die bittere Kälte immer noch durch alle Ritzen der Hattelfinger Gehöfte. Es war, neben Martini, der zweite bedeutende Tag für Gesinde.
Lichtmess war der einzig mögliche Kündigungstermin. Zu diesem Tag konnten Mägde und Knechte den Hof oder die ganz mutigen gar das Dorf verlassen und bei neuen Herrschaften anheuern. Dazwischen gab es zur sicheren Jahresplanung der Bauern keine Chance auf einen Wechsel. Wer gegen diese Regel verstieß erhielt seinen Restlohn nicht ausbezahlt.
Auch Lichtmess im Februar wurde intensiv gefeiert. Nicht weniger lautstark als den Martinstag, hauptsächlich von Knechten und Mägden, denen die Großbauern jährlich abwechselnd eine Scheune frei räumten.
Jeder Knecht der ein Instrument spielte, Bandoneon, Hackbrett oder Gitarre, zeigte seine Kunst so gut er konnte. Die anderen sangen und tanzten, einige, immer die gleichen, frönten ausgiebig dem Alkohol. Einzig Hans Geyer sagte zu seiner Maria:
„Ich will sparen. Vielleicht kann ich in ein paar Jahren etwas Eigenes kaufen. Auch wenn's nur ein, zwei Äcker sind.“
Er holte nur einen einzigen Krug Bier aus der Hirschenbrauerei, tanzte mit Maria einen Reigen und eine Polka, deren Augen danach in tiefem Glücksblau strahlten. Hans Geyer sagte: „Ich will einen klaren Kopf behalten. Morgen müssen wir die Kühe striegeln und ich bin davon überzeugt, dass Tiere, egal ob Pferd oder Rind, durch unsere ruhig streichelnde Hand den vollen Einsatz bei der Arbeit zurückgeben. Ich meine damit bei Kühen mehr Milch und mehr Zugkraft vor dem Karren. Die Pferde werden uns demnächst beim Ausbringen der Saat mehr Freude bereiten, durch eine gleichmäßige Gangart und Gehorsam.“
Stählernen Haken der Eggen bereiteten ab Mitte März die Äcker vor und in den ersten warmen Frühjahrestagen wurde gesät. Danach begann die unbeliebteste Arbeit des Jahres. Mit Hacke und Stecheisen musste tagelang, Schritt für Schritt, Unkraut gejätet werden.
„Eine scheußliche Schinderei für den Rücken“, schimpfte selbst der starke Knecht Hans, der sonst nie über seine Arbeit klagte.
Nachdem alles Gras und alle Disteln ausgestochen waren konnte sich der Weizen ungestört der Sonne entgegenstrecken und die Bauern nutzten die schläfrige Zeit des Reifeprozesses zur Entspannung und Vorfreude auf eine ertragreiche Ernte.
Doch dann, mitten im Getreideschnitt, im August 1914, schlugen die diplomatischen und militärischen Feuersteine europäischer Großmächte zündelnde Funken. Den vorhersehbaren Flächenbrand durfte in Hattelfingen der Dorfbüttel ausrufen. Verkündete er sonst in staubigen Schuhen und einer abgewetzten, vor Jahren schwarzen und nun grauen Hose die Neuheiten, trug er dem Anlass entsprechend gewienerte Sonntagsschuhe und eine gebügelte, blaue Jacke. In voller Amtsmontur mit glänzender Messingschelle verkündete er im sommerheißen Hattelfingen die Mobilmachung gegen die Erzfeinde Frankreich und Russland.
Mehrere Minuten forderte an jeder Wegkreuzung seine polierte Klingel mit dem massiven Holzgriff die Aufmerksamkeit. Und selbst die Gockel im Hühnerstall vergaßen vor Schreck das Krähen:
„Die rebellischen Serben haben meuchlings den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau ermordet“, las er weit hörbar von seiner Bekanntmachung ab, „ein Ultimatum haben die Serben abgelehnt. Wir stehen treu an der Seite der verbündeten Habsburger Monarchie! Das Deutsche Kaiserreich nimmt den Zweifrontenkrieg im Osten und Westen voller Hingabe an! Unser Vaterland wir abermals einen Sieg gegen alle Feinde davontragen.“
Die blaue Jacke mit den Goldlitzen an Ärmel und Kragen und den großen goldenen Metallknöpfen spannte sich vor jedem Satz zum Zerreißen und schrumpfte zu den Satzpausen hin in sich zusammen.
„Ein Hoch auf unsere Erlauchtheit, Kaiser Wilhelm von Preußen“, fügte der Büttel noch lautstark hinzu. Dann nahm er die Schirmmütze ab und rieb sich den Schweiß von der Stirn um hundert Meter weiter dieselbe Botschaft zu verkünden.
Ganz Hattelfingen schien plötzlich stramm zu stehen und verfiel in erregte Aufbruchstimmung:
„Wir werden es denen schon zeigen“, schrien die Männer jeden Standes, nicht vorausahnend, dass die Wegstrecke zum Abgrund nur wenige Jahre dauern würde.
Der Schullehrer begann den folgenden Unterrichtstag pathetisch. Als wären ihm die vierzig Jahre Friedenszeit seit 1871 zu langweilig gewesen, schwor er die Kinder ein: „Unser geliebtes Vaterland wird, getragen von der griechischen Göttin Aurora, einer neuen Morgenröte entgegen gehen. Der Sieg ist unser!“
„Schlagt die Franzosen in ihren Flatterhosen“, sangen Kinder und spielten mit aus Holzlatten zusammen genagelten Schwertern und aus Brettern gesägten Gewehrimitaten an jeder Hausecke Krieg gegen den Erzfeind.
„Diese Lotterlebigen, die nur Champagner saufen, sie werden wir bald besiegen. Mitsamt der Entente, den Verbündeten aus Russen und Engländern“, sagten die Männer und warfen sich in die Brust.
Eine Zeit nachzudenken war dies nicht. Mütter appellierten händeringend an ihre Söhne, das Vaterland gegen diese vaterlandslosen Gesellen aus Russland und Frankreich zu verteidigen. Pfarrer segneten im Namen Gottes Regimentsfahnen und Kanonen. Bräute blickten voller Stolz zu ihren zukünftigen Helden auf. Nach langer Friedenszeit ahnte niemand, was Krieg bedeute.
Zum Ausmarsch der acht Wehrpflichtigen ab dem Rathaus stand das ganze Dorf Spalier. Die Äcker hätten wichtige Arbeiten geboten doch für einen aufregenden Waffengang musste die alljährlich wiederkehrende Ernte schon mal warten. Nicht der kleinste Standesunterschied war in der hitzigen Euphorie spürbar. Besitzer und Gesinde waren im Feinddenken vereint.
Bäuerinnen und Bauern hatten sich abgesprochen und standen nebeneinander in schwarzer Tracht mit weißer Bluse oder weißem Hemd, vom Rathaus bis zum Dorfende, Richtung Ulm. Alle Bäuerinnen trugen zur Feier des Tages ihre weiße Spitzenhütchen, die sie sonst nur zu Hochzeiten ins Haar steckten. Die Männerbrust zierte eine Krawatte. Mägde und Knechte jeden Alters hatten sich frische blaue Sonntagsschürzen umgebunden. Eine Magd, sie hieß Ruth, imponierte den abmarschierenden Männern mit einem frisch geflochtenen Doppelkranz aus blauen Kornblumen im Haar.
Alle im Spalier klatschten laut Beifall und schrien „Hurra! Hurra!“ Junge Frauen steckten dem Freund oder Bräutigam einen zierlichen, in Silberpapier gebundenen Strauss aus kurzstieligen Feldblumen ans Revers der Uniformjacke.
Aus den marschierenden Soldaten ragte Hans Geyer heraus. Sein aufrechter Gang ließ ihn größer erscheinen und die tief schwarzen Haare hoben sich von den strohblonden, den dunkelblonden und rötlichen wohltuend ab. Maria Renzer stand auf wippenden Zehenspitzen und sah ihm direkt in die Augen. Sie fühlte noch die letzte gemeinsame Nacht in sich. Doch beide schienen froh zu sein, dass Soldaten ihre Muskeln spielen lassen dürfen.
Die Tochter vom Bichlhof, ohnehin als eitel bekannt, polierte mit weichem Taschentuch und heißem Atem ihrem Verlobten im Marschieren noch schnell die großen Messingknöpfe am Uniformrock.
„Muß i denn, muß i denn, zum Städtele hinaus…“, sangen die acht herausgeputzten und gefeierten Mannsbilder im Marschtempo und die verchromten Spitzen auf ihren ledernen Pickelhauben funkelten in der Sonne.
Nur eine alte Bäuerin drehte sich ab. Sie ging zurück in ihr Ausgedinghaus, in dem sie untergebracht war, seit sie nach dem Tod des Bauern den Hof an den Sohn weitergegeben hatte. Versteckt in den Falten ihres weiten Rocks, hielt sie in ihrer Rechten ein tränennasses Taschentuch, schaute in die Ferne und sagte leise vor sich hin: „Das sieht aus als würden unsere Buben zu einem freudvollen Turnfest ausrücken, Kraftübungen an Stufenbarren und Reck. Ahnen die nichts von schlimmen Tagen die ihnen bevorstehen?“
In der Garnisonstadt Ulm traf sich das Infanterieregiment Wilhelm König von Preußen, dem die Spezialeinheit mit Hans Geyer, das Grenadierregiment König Karl von Württemberg, zugeordnet war. Salutieren stand auf dem Programm, Zielschießen, Handgranaten werfen, marschieren und in voller Montur rennen. Und abends tranken die jungen Männer krügeweise Bier und ließen in Vorfreude auf den heroischen Kampf lautstark Kaiser und Vaterland hochleben.
Nach wenigen Tagen harter körperlicher Ertüchtigung in der Eselsburgkaserne folgte Unterricht und Belehrungen zu Spionage, Sabotage, zu Dienstgeheimnissen und Vaterlandverrat.
In den seltenen ruhigen Minuten polierte Hans Geyer gedankenverloren seinen Gürtel und die ledernen Patronentaschen daran.
Nach zwei Wochen marschierten sie mit laut aufs Kopfsteinpflaster knallenden Stiefelabsätzen, in frisch gedrilltem Gleichschritt, ins Ulmer Münster. Laut sangen, ja, brüllten sie inbrünstig ihre Marschlieder bis zum Kirchenportal. Prachtvoll mit Blumen und goldbestickten Tüchern, als stünden Taufen oder Hochzeiten an, war der Abschieds-Gottesdienst ausgestattet. Dazwischen Fahnen des Kaisers und der Ulmer Regimenter. Nach dem Segnen der Soldaten und Fahnen und dem ungeduldig erwarteten „Amen“ wurde wieder Haltung angenommen und der Marsch zum Hauptbahnhof fortgesetzt, in dem qualmende und zischende Dampfrösser bereits auf ihre Fracht warteten.
Heiter gelaunte Frauen steckten ihnen von der Straße aus bunte Blumensträuße in den Lauf der frisch ausgefassten Meuser-Karabiner 98 und drückten ihnen einen schnellen Kuss auf die Wangen.
Ein letztes Mal winken, unbeschwert lachen und schon schnaubte laut, unter der schweren Last der Mannschaftswagen und der angehängten Geschützwagen ächzend, die Dampflokomotive aus der Garnisonstadt, hinaus in Richtung Nordwest. Die starken Arme der Kolbenstangen stampften und die Messingarmaturen glänzten vibrierend durch den Kohleruß. Die mit Kreide auf die Waggons gemalte Parole “Von Ulm nach Paris“ verschwand in der Ferne.
Hans Geyer und seine Kameraden saßen auf harten, eng gestellten Holzbänken. Im Stundentakt standen sie kurz auf um Gelenke und Muskeln aufzulockern.
Obwohl die Reise in den Krieg zwei Tage dauerte, war bei diesem nervenraubenden Gerüttel an Schlaf kaum zu denken. Allein jugendlicher Übermut, der Glaube an einen glorreichen Sieg und die Vorfreude auf großartige Heldenfeiern bewahrte ihre gute Laune.
Kaum in den belgischen Ardennen angekommen, wurde ihnen ohne Aufenthalt befohlen, an die vom Kanonendonner bedrohlich herüber dröhnende französische Front an der Maas zu marschieren.
Der Krieg gewährte keinerlei „Einlernphase“. Schon die ersten Stunden in der durchnässten und dreckigen Stellung riss den Soldaten jegliche Romantik aus den verklärten Hirnen.
Todbringender, feindlicher Artilleriebeschuss, unvermittelter Befehl zum Gegenangriff mit aufgepflanztem Bajonett, heftiges Gewehrfeuer aus den gegnerischen Stellungen, überall Drahtfallen. In blutigem Nahkampf Feinde abstechen, schnell zurück, Minenfeldern und dem Beschuss durch ein tödlich ratterndes Maschinengewehr ausweichen, den schlammigen Morast aus Gesicht und von den Kampfkleidern reiben, kaum Zeit zum Luft holen, schrill um Hilfe bettelnde Verwundete und grausam entstellte Tote bergen, Gegenangriff zurück schlagen, Handgranaten werfen und schießen, Karabiner hektisch laden und wieder schießen. Im Flug heran heulendes, dumpf trommelndes Artilleriefeuer – so heftig hatten sie sich alle einen heroisch angekündigten Feldzug für Gott, Kaiser und Vaterland nicht vorgestellt.
Nicht die zu Hause mit üblen Texten als feige besungenen Franzmänner standen ihnen gegenüber, sondern mutig verteidigende, logistisch ausgeklügelt unterstützte, mit heißem Herzen um ihr Vaterland kämpfende Soldaten.
Bald darauf griffen unerschrocken englische Infanteristen an. Die deutschen Offiziere lästerten: „Die Tommis tragen auf ihren Köpfen umgedreht Blechteller.“ Doch die aus den Kolonialkriegen kampferfahrenen und gut ausgebildeten Engländer schienen die Sticheleien zu hören. Sie glichen ihre Strategien an neue Waffentechniken an und erhöhten den Wechsel zwischen Vorbereiten mit Geschützen und den darauffolgenden Angriffswellen der Kampfeinheiten.
Die ersten Doppeldeckerflugzeuge warfen Bomben vom unschuldigen Himmel, dicke Kanonenrohre und Mörser schickten den Tod über mehrere Kilometer und der als hehr gepriesene Kampf, Mann gegen Mann, wurde in tödlichen Eisensplittern ertränkt.
Um dem Überdruck der geschundenen Psyche ein Ventil zu geben wurde zunächst zögerlich und bald regelmäßig Feldpost zugelassen.
„Allen zur Kenntnisnahme: Briefe mit Geheimnissen, Sabotage durch Verrat und negative Frontmeldungen führen zu einer harten und gerechten Strafe vor dem Kriegsgericht!“ drohte der Kommandant.
Hans Geyer schrieb an seine Maria, im stickigen Schützengraben, nach zwölf Stunden umringt von Blut und Tod im rückwärtigen Ruheraum und später im Lazarett. Zunächst wirkte seine akkurate, gestochen scharfe Sütterlinschrift mit runden Kurven und steilen Spitzen sehr selbstsicher. Später wurde das Schriftbild ungleichmäßiger. Fahrig dahin gesetzt stiegen einzelne Worte in der Schrifthöhe ungelenk an und wurden unvermittelt wieder flach.
„Allerliebste Maria“, begann er jeden Brief und endete alle mit: „Ich komme bald zu Dir nach Hause.“
Die Texte dazwischen änderten sich von Brief zu Brief, waren zunächst noch sehr zuversichtlich:
„Die Frühjahrsoffensive bringt uns endgültig den Sieg!“
Oder: „Alle Kameraden sind frohen Mutes. Wir schlagen dieses Franzosenpack, allsbald!“
Wenig später: „Wir können vom Lärm der Mörser und Granaten, der Abschüsse und der Einschläge, dem Heulen während der Flugbahn kein Auge mehr zu tun. Nicht mal der hinter der Frontlinie tief in die Erde gegrabene Ruheraum verhilft uns zu etwas Schlaf. Ich schreib im Stehen und denk an Dich.“
Im nächsten Brief: „Nun hat es bereits die Hälfte der Kompanie erwischt, gefallen oder verwundet. Mit neuen, oft unerfahrenen, schnell ausgebildeten Soldaten werden wir auf Sollstärke aufgefüllt. Alle kommen sie immer von Heimatoffizieren willig und heiß gemacht. Für die unerbittlich tötende Front sind sie uns jedoch selten hilfreich.“
Danach: „Aus dem geplanten Marsch nach Paris, liebste Maria, wird so schnell nichts. Der Nachschub für Munition und Essensrationen funktioniert nur noch bedingt. Wir sitzen im dreckigen Schlamm des Stellungskrieges fest!“
Nach mehreren Monaten schrieb er ohne Rücksicht auf die Zensur:
„Der Feind und wir setzen nun den gelben Tod aus Gasgranaten ein. Wir haben Gasmasken ausgefasst. Das bedeutet aber auch, dass ich mich wegen der Dichtheit jeden Tag im Stellungsgraben rasieren muss.“
Kurze Zeit danach: „Das war ein höllisches Erlebnis. Nachts zuvor hatten sich in künstlich erzeugtem Nebel, leichtfüßig wie Katzen, dunkelhäutige Gestalten mit den flachen Helmen der Engländer bis wenige Meter vor unsere Stellung herangeschlichen. Es müssen Koloniesoldaten aus Afrika gewesen sein. Am Morgen folgten, mit enormem Getöse, unangreifbare Eisenungetüme. Diese fahren auf Eisenketten und schießen unaufhörlich. Man nennt sie Tanks. Überhaupt ist der Schlachtenlärm noch betäubender geworden, Artillerie mit immer größeren Kanonen schießt in beide Richtungen, bereitet die Angriffe der Infanterie vor. Diese Tanks reißen alles nieder, fahren über unseren gut zwei Meter tiefen Stellungsgraben, drehen darauf und versuchen uns zu verschütten. Unerwartet tauchen am Himmel wieder Flugmaschinen auf und werfen Bomben auf uns herab. Es ist die Hölle!
Gestern drehte neben unserer Stellung ein junger Soldat durch. Er riss sich die Uniformjacke vom Leib, warf den Helm weg, schrie „Aufhören! Aufhören!“ und lief auf die feindlichen Stellungen zu. Er wurde von mehreren Gewehrsalven nach zwanzig Metern tödlich getroffen. Der Inhalt seiner Gedärme ergoss sich über die Uniform. Er wimmerte über Stunden im Todeskampf. Wir konnten ihn wegen andauerndem Feindfeuer erst nach Einbruch der Dunkelheit bergen.“
Die Feldpost verriet nagende Verzweiflung: „Gestern hing ich fast machtlos in einem dieser ekelhaften Stacheldrahtzäune fest, mit denen neuerdings Stellungen abgesichert werden. Kameraden haben in höchster Not meine Uniform freigeschnitten, nun sehe ich zerrissen aus, wie ein Lump. Und amerikanische Soldaten greifen nun auch noch ein, über eine Million ausgeruhter Kämpfer sollen das sein.“
Und drei Monate später schrieb Hans mit schwer lesbarer, zittriger Schrift: „Ich bin seit zwei Wochen unterwegs in einem Lazarettzug. Sie sagen, es gehe Richtung Koblenz. Ich kann mit der Zunge kaum mehr den Tintenstift anfeuchten, das ganze Gesicht ist zugebunden, nur die Augen sind frei. Es riecht ekelig nach Urin, hoffentlich bekomme ich keine Infektion. Krankenschwestern füttern mich. Bekomme aber zu wenig Wasser. Ich hatte in einem Bombentrichter meine Feldflasche verloren und bin nun auf andere angewiesen, doch die dürsten selbst. Aber besser die Haut verbrannt als tot.
Zum Glück erlitt ich bei diesem hinterhältigen Brandangriff mit dem Flammenwerfer einen Schock. Das Feuer fraß meine Haut an Hals und Gesicht. Die Augenbrauen sengte es in Bruchteilen einer Sekunde restlos weg. Es riss mir den Sauerstoff aus Mund und Nase, bis ich bewusstlos zusammenbrach. Die Feinde hielten mich für tot und ließen mich liegen. Ein paar unserer Sanitäter, ich weiß nicht mehr wie viele, haben mich nach schier unerträglich langer Zeit geborgen. Danach bin ich, auf einer Transportbahre liegend, auf dem Verbandsplatz weit hinter der Front, zu mir gekommen. Die eigene verbrannte Haut reizte meine Schleimhäute zum Abhusten. Das stinkt scheußlich, als würde einem Pferd die glühenden Hufeisen angeschlagen.
Liebste Maria, glaube mir, ich bin nicht feige. Aber ich träume davon, mit Dir im Donaumoor zu liegen. Ich träume nicht nur, ich sehne mich danach. Nach dem betörend würzigen Duft des Bodens. Darüber klare Luft, der Vögel heller Gesang und wir beide. Alles dort war immer so friedlich.“