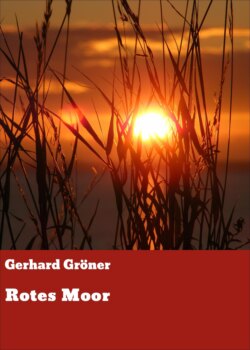Читать книгу Rotes Moor - Gerhard Gröner - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel
ОглавлениеBöse geschunden, mit kleinen Schritten schwer gehend, ab der Hüfte weit nach vorne gebeugt, ging Hans Geyer um die Mittagszeit durch Hattelfingen. Die einst stattliche Figur, die imposante Erscheinung schien um Jahre gealtert. Im Eichenrahmen der Haustür zum Kopfberghof blieb er tief atmend stehen.
Die Felduniform war mit ungelenker Hand ausgebessert, Nähte passten nicht übereinander und Blutreste und Dreck verdeckten die Flicken vom Knöchel bis zum Kragen. Der Stahlhelm hing mit tiefen Dellen und Schrammen übersät vom Gürtel herunter, die linke Hand baumelte ungelenk aus einer gebundenen Schlinge und schräg über die rechte Schulter hing das Gewehr. Nichts war geblieben vom großen, kräftigen Soldaten mit der polierten Gürtelschnalle und dem Lied auf den Lippen. Die dunklen Augen blickten fahrig, gehetzt, wie bei einem angeschlagenen Boxer.
„Keine glorreichen Zeiten für unser Deutsches Reich“, der Bauer drehte ohne ein Wort der Begrüßung ab, wie immer nach Arbeit suchend, „kannst gerne bei mir auf’m Hof wieder anfangen.“
„Danke Bauer, vergelt es ihnen Gott“, sagte Hans und schaute am Bauern vorbei. Sein Blick suchte Maria Renzer.
Sie hatte instinktiv die Ankunft von Hans erahnt und kam flugs aus der Mehlkammer gelaufen, wo sie das Speisemehl nach Motten durchsiebt hatte. Ein langer Seufzer verriet, wie sehr sie auf Hans gewartet hatte.
„Hans, mein Hans, du armer Soldat, endlich bist du wieder da“, sagte sie nur und schaute erschrocken in sein Gesicht, einem herben Gemenge aus verheilenden Brandnarben, rot-gelbem Jod und einem ungepflegten, durch dicke Krusten sprießenden Vollbart. Die kräftigen, schwarzen Kopfhaare, dachte Maria Renzer, die er immer so penibel scheitelte, haben sie ihm wie bei der Schafschur, grob und ungleich abgeschnitten.
„Oh Gott, für so viel sichtbares Elend, für diese Schmerzen“, Maria wollte nicht daran denken doch es zwang sich ihr auf, „für Millionen verwundeter und toter Männer, dafür hatte sogar die keinesfalls kriegsbegeisterte Kopfbergbäuerin ihren Schmuck aus Silber und Gold gespendet.“
Nach einem Aufruf des Kaisers war die Bäuerin aufs Rathaus gegangen um ihren wertvollen Erbschmuck gegen Billiggeschmeide aus Eisen zu tauschen: „Gold gabt ihr für Eisen“ und „Gold zur Wehr, Eisen zur Ehr“ waren das eingeprägte, magere Dankeschön im ehernen Ersatz.
„Sag Hans, was ist mit deinem linken Arm geschehen?“ fragte verschüchtert die zierliche Maria. Sie trat nahe an ihn heran und Hans fühlte ihre Hüfte.
„Wird bald wieder werden“, antwortete Hans, wegen den danebenstehenden Bauer und Bäuerin ausweichend, „das Schlimmste ist bereits vorüber, ehrlich.“
Die Kopfbergbäuerin hatte sich die ganze Zeit im Hintergrund gehalten, sagte nun aber bestimmend: „Hans, du solltest heute Abend ein Bad nehmen dürfen. Maria, hol vom Brunnen vier Eimer Wasser, mach hurtig ein Feuer in den Kessel und richte den Bottich her.“
Dieses Angebot kam überraschend. Hans stutzte zunächst, ließ dann seiner Freude freien Lauf: „Danke Bäuerin, das werd ich ihr nie vergessen. Hab mich seit Monaten nicht mehr richtig waschen können. Nun darf ich auch noch den ihrigen Zuber benutzen. Vielen Dank.“
Nicht nur das Bad streichelte die strapazierte Psyche von Hans. Die Nacht in Marias Kammer, die Kopfbergbauern wussten längst Bescheid, gaben Hans und Maria die von beiden lange herbeigesehnte Zweisamkeit. Ihr angenehm warmer Körper, die schmale Taille, ihre zarten Finger auf seiner Haut, Marias lange, vom Zopf befreiten Haare, ihre Küsse…
„Wie oft habe ich davon geträumt“, Hans schmerzte der Körper. Und doch, er wurde fast bewusstlos vor Glück.
Und zwischen den Liebkosungen fanden sie noch Zeit, die Seele frei zu reden:
„Maria, an was soll ich noch glauben, an den Kaiser, der ohne Not den Krieg herbei taktiert und uns Soldaten hinein befohlen hat? An blasierte, adelige Offiziere, die uns im zermürbenden Stellungskrieg verheizten? Oder etwa an den bis dato unvorstellbaren Vorgang streikender Matrosen in den Häfen im Norden? An die Revolutionäre, die nach unserer Niederlage die Gesellschaft neu aufteilen, den Bauern die Höfe wegnehmen und eine sogenannte Räterepublik wollen? Ich fühle mich unwohl zwischen enttäuschender Vergangenheit mit dem Adel und den neuen, mir nicht in der Gänze bekannten Ideologien.“
Maria antwortete ruhig: „Hans, noch bewegen wir uns nicht wie im gefährlichen Moor. Ich freu mich auf unsere gemeinsame Arbeit auf den Feldern. Es wird wieder so wie früher. Hans, es wird wieder gut. Streichle mich weiter, nicht nur am Kopf, bitte.“
„Ich hab noch gar keine Meinung“, sagte Hans. „Ich höre jede Nacht den dröhnenden Kanonendonner, die heulenden Artilleriegeschosse, spüre im Traum die Druckwelle, kann den ängstlichen Schreien der Kameraden nicht entkommen. So bald ich eine Kerze anzünde spüre ich die Hitze der Flammenwerfer auf meiner Haut. Wir sind eine dem Abgrund knapp entgangene Generation. Hoffentlich wirklich entgangen, hoffentlich kommt nichts mehr nach.“
Maria versuchte Hans aufzubauen: „Hans, deine Verletzungen verheilen. Die Kopfbergbauern sind froh, dass du einigermaßen arbeitsfähig zurück bist. Und ich freue mich auf dich, weil ich dich liebe!“
„Ich hatte Angst, mein Augenlicht zu verlieren, dann hätt ich nur noch zum Korbflechter oder Besenbinder getaugt.“
„Hans, mein Liebster, denke nicht über hätte oder würde nach. Du wirst bald genesen und die Albträume werden wir Nächtens gemeinsam vertreiben. Dein neckisches Muttermal am rechten Wangenknochen blieb mir ja erhalten.“
„Bitte drück mich, auch wenn der Arm noch schmerzt.“
„Ja gerne, Hans“, flüsterte sie in sein Ohr.
Maria Renzer streichelte ihn über Hals und Hände und sagte: „Nichts ist mehr wie vor Beginn des Krieges. Doch du hast überlebt und wir beide lieben uns noch. Ich sehne mich auf jeden gemeinsamen Abend. Vier einsame Jahre und die ständige Angst um dich, das will ich nie mehr erleben müssen!“
Noch war Hans Geyer jung genug um dem liebevollen Klang ihrer schmeichelnden Worte hinterher zu lauschen.
Wenige Tage nach der Rückkehr sagte der Bauer: „Hans, du hast heute Vormittag eine Nachricht erhalten, du musst am Montag nach Ulm und dich bei deiner Einheit melden. Du sollst Uniform und Gewehr zurückgeben.“
„Ich bekomme kaum Zeit zum Luft holen“, sagte Hans Geyer zu Maria, „montags in der Früh muss ich schon wieder loslaufen, zur Eselsburg Kaserne, es sind ja über zwanzig Kilometer.“
Noch in der Dämmerung rollte er seine Zivilkleider für den Rückweg aus der Kaserne zu einem Bündel, band einen Gurt darum, hing diese Rolle mit dem Gewehr über die Schulter und lief vier Stunden in seine Garnison.
Dort bekam Hans Geyer, völlig unerwartet, eine neue Ausgehuniform, ein Paar neu besohlte und genagelte Schuhe, ein frisches Hemd und eine Garnitur Unterwäsche ausgehändigt.
„Ich kann es kaum fassen, ich denke der Krieg ist aus. An der Front hätten wir solche warmen Kleider oft gebrauchen können“, sagte Hans zu einem ebenfalls angetretenen Kameraden.
„Verdammt, sei leise“, antwortete dieser, „wir haben noch keinen Friedensvertrag.“
„Geyer, wir sehen uns bald wieder!“ sagte in barschem Kommandoton der Kompanieführer und händigte nach handschriftlichem Eintrag in den Militärpass Fünfzig Mark Entlassungsgeld und Fünfzig Mark Marschgeld aus.
Diese Etappenhengste, dachte Hans Geyer, die glauben wohl die Erde wäre ein Abenteuerspielplatz, von wegen, wir sehen uns bald wieder!
Geknickt von der vierjährigen mörderischen Materialschlacht und den immer noch schmerzenden Verletzungen nahm er ohne jede Euphorie Uniform und Geld an. Eine mickrige Entschädigung, dachte er, dafür, dass ich in Frankreich hätte verrecken können!
„Im Mannschaftsquartier Nummer Drei kannst du dich umziehen, Soldat“, sagte der Offizier noch.
Hans wollte so schnell als möglich wieder nach Hause, auf den Hof, zu Maria.
Und doch, eine neue Ausgehuniform anziehen, eine neue Koppel umbinden, das hatte einen gewissen Reiz.
Er ging ins Mannschaftsquartier und sah in einen halbvollen Raum. Wie viele sind wohl gefallen, dachte er. Seine verbliebenen ehemaligen Frontkameraden zogen bereits die neue Uniform über.
Plötzlich sagte einer, Gotthilf Layrer hieß er, in das muntere Geplapper im Quartier, übertrieben laut und für alle hörbar: „He, Hattelfinger, geht’s dir wieder gut. Als du verletzt auf der Trage lagst hattest du die Uniform verpinkelt. Jetzt gibt’s eine neue.“
Hans Geyer wurde rot im Gesicht und spannte die Muskeln. Ein anderer Soldat kam einer Keilerei zuvor: „Halt dein blödes Mundwerk, Layrer! Wir hier im Raum haben das Schlamassel überlebt, da red keiner Blödsinn, auch du nicht, Layrer! Und schon gar nicht gegen uns selbst!“
„Dich merk ich mir, vergiss das nie“, sagte Hans Geyer noch, dann lehnte er sich auf der Holzbank sitzend zurück an die kahle Wand. Er schloss die Augen, sein Kopf fühlte sich wie betäubt. In der Pubertät hatte er bereits eine Phase, in der er ohne erkennbaren Grund das Bett nässte. Mal in einer kalten Winternacht, mal im Sommer. Warum auch immer, er konnte es sich nicht erklären und fühlte immer noch das nasse Schlafhemd. In ihm kroch das Gefühl der Angst wieder hoch, dass es jemand bemerken würde und die Schande auffallen würde.
Nie wieder wird mir etwas passieren was mich beschämt. Nie wieder! Das schwöre ich mir jetzt. Ich werd mich zukünftig eisern im Griff haben! Was immer auch geschehen mag.
Eine Weile noch schaute er auf den Boden, dann zog er die Uniform über. Erst zurückhaltend, langsam, dann immer schneller. Sein Gesicht verriet entschlossene Verbissenheit.
Und plötzlich: Aus Kriegsverlierern, aus geschlagenen Kämpfern, wurden innerhalb weniger Minuten, durch neues Tuch und Abzeichen, dünkelhafte, selbstbewusste Männer.
Die Ordonanz riss die Türe auf und der Kommandant trat ein. Er verlas die Namen fast aller Anwesenden und ließ sie antreten. Der Kommandant sprach laut vernehmbar:
„Soldaten, stillgestanden! Zuerst bekommen alle die im Kriege gegen die Feinde gekämpft haben, für Tapferkeit und Treue die Ehrenmedaille unseres Wilhelm König von Württemberg!“
Jeder bekam mit der silbernen Medaille einen kräftigen Händedruck. Nach einer Kunstpause fuhr er mit seiner Ansprache fort:
„Soldaten. Den Verwundeten in den Diensten des Vaterlandes wird heute als besondere Anerkennung ein neues Abzeichen verliehen. Es soll diejenigen auszeichnen, die im hehren Kampf für unser Vaterland verletzt wurden!“
Er heftete den angetretenen Männern eine schwarze Blechmedaille mit Eichenlaub und Stahlhelm an die linke Brusttasche, schlug die Haken zusammen und marschierte aus dem Mannschaftsquartier.
„Dieses Verwundetenabzeichen sieht verdammt gut aus. Eine kleine Entschädigung für unser im Feindesland zurück gelassenes Blut. Zu Hause kommen beide Abzeichen neben meinen Orden dran“, schrie einer durch den Raum und hielt Tapferkeitsmedaille und das Verwundetenabzeichen wie erstrebenswerte Trophäen in die Höhe. Ein andere fragte lautstark: „Ich hab mein Eisernes Kreuz dabei, wer heftet es mir an?“
„Wir treffen uns in den Fischerstuben, die haben das kräftigste Bier“, wurde als Losung ausgegeben.
Hans schaute in den Spiegel auf der Toilette und empfand, dass auch er gut aussehe. Aufrecht, mit stolz geschwellter Brust ging er aus der Kaserne.
Die Hundert Mark Entlassungsgeld wollte er sparen. Er marschierte, so schnell es seine Verletzungen zuließen, nach Hattelfingen zurück.
Er lief immer schneller, die Nachmittagssonne zeichnete bereits lange Schatten. Wenn schon eine neue Uniform, dann volle Breitseite der Anerkennung, sagte er zu sich. In Hattelfingen sollen sie mich bewundern. Ja, der Barbier soll meinen Bart schön rasieren. Besser ist, Sold für Barbier und nicht Sold für viel Bier, wie es die Kameraden in den Fischerstuben belieben, dachte Hans und freute ob dieser gelungenen Phrase.
Hans war nie ein ernsthafter Freund des Frisörs gewesen, der, weshalb auch immer, nicht zum Militär hatte einrücken müssen. Obwohl gerade im Feld, wegen der besseren Dichtigkeit der Gasmasken, ständig glatt rasierte Barthaare, und kurze Kopfhaare wegen der Läuse erforderlich waren. Drückeberger, dachte Hans Geyer. Man kannte sich im Dorf und man grüßte sich, nicht weniger aber auch nicht mehr.
Der Frisör war ihm zu sehr „Dorfquassler“, einer der über alles redete, über jede und jeden. Kein Kommentar war dem Haarschneider zu simpel, keine Plattheit zu primitiv. Darüber hinaus machte sich der Frisör überall wichtig, beim Gesangverein Germania legte er als Notenwart Texte, Partituren und Noten auf das Pult, allen Männern vom Kraftsport Verein durfte er vor Sportfesten die Haare schneiden und mit Rosenwasser einreiben und im neu gegründeten Fußballclub stand er bei jedem Heimspiel als Sanitäter an der Außenlinie.
Dies alles war Hans zu viel der Postenhascherei und dennoch, heute, dieses eine Mal, in eine neue Uniform gekleidet, wollte er sich seinen Bart akkurat vom Frisör stutzen lassen.
Wenn Eitelkeit neue Nahrung erhält, können helfen Uniformen vorhandene Aversionen überwinden. Dies zeigte sich auch in Hattelfingen.
„Soll ich neben dem Bart auch die Kopfhaare schneiden, Hans? Du hast wieder eine solch schöne Uniform, da muss auch deine Frisur dazu passen!“ fragte der Frisör in einer Stimmlage die nach Honig und Reifenschmiere klang.
„Frisör, du weißt, mein Lohn als Knecht ist nicht gerade üppig, doch heute, ja, heute ist ein besonderer Tag.“
Der geht wirklich behutsam zu Werke, dachte Hans. Er hatte für sich selbst ein schlechtes Gewissen. Kostet doch viel Geld, überlegte er weiter, während der Frisör sein ganzes Können in die Waagschale warf.
Vielleicht kommt Hans dann zukünftig öfter und schnippelt nicht jeden Sonntagmorgen selbst vorm Spiegel, dachte der Frisör. Ich könnt ja noch ein paar Kunden mehr bedienen.
„Gefällst du dir mit fein geschnittenen Haaren und glatt rasiertem Kinn?“, fragte er Hans.
„Ja, Frisör, das hast du gut gemacht. Passt wirklich alles.“ Hans schaute zufrieden in den Spiegel und schritt Sekunden später aufrecht, mit erhobenem Haupt durchs Dorf, die Uniformmütze kokett unter den Arm geklemmt.
Es sind deutlich weniger Leute auf der Straße wie seinerzeit als ich den Krieg zog und das ganze Dorf Spalier stand, stellte Hans enttäuscht fest. Einige entdeckten den stolzen Hans dann doch und grüßten den gutaussehenden Mann in seiner Uniform.
Zu Hause, in seiner Kammer holte er sein Eisernes Kreuz aus der Schatulle. Er betrachtete es sehr lange, die Vorderseite mit dem mittig angelegten großen W, dem Initial des Kaiser Wilhelms, dann die Rückseite mit Stiftungsjahr und Eichenzweig. Er streichelte liebevoll über den Silberrand. Vorsichtig heftete er sich den Orden an. Dann blickte er forsch in den Spiegel, bemerkte, dass er leicht schräg auf der linken Brusttasche über seinem Verwundetenabzeichen hing und legte noch mal neu an. „Wenn schon, dann akkurat“, sagte er leise aber bestimmt vor sich hin.
Wenig später stand er vor Maria und der Bäuerin: „Hei, Hans“, entfuhr es der Bäuerin, „bist wieder ein strammer Bursch“, und Maria war vor Bewunderung sprachlos.
Dass Selbstbewusstsein, das sich auf Äußerlichkeiten aufgebaut nie lange anhält, erfuhr umgehend auch Hans Geyer. Am nächsten Morgen, in den grob gewobenen, leinenen Arbeitskleidern des Knechtes, mit derben Stiefeln und blauen Arbeitsschurz, kamen Zweifel in ihm auf. Neue Uniform, schön, ja. Kriegsverlierer, nein! Knecht beim Kopfbergbauern oder doch Uniformierter? Hans Geyer war gespalten, Knecht oder Soldat? „Vielleicht werd ich selbst mal Bauer?“ wünschte er laut vor sich hin.
„Was ist ein für mich erreichbares Ziel, Bauer mit eigenem Hof oder Karriere als Soldat?“ fragte sich Hans Geyer weiter, ohne gleich eine Antwort zu suchen.
Von einer konkreten Lebensplanung hatte Knecht Hans noch nie gehört, er war froh und dankbar, dass ihm seine Mutter die Schule ermöglicht hatte. Sie hatte sich als unverheiratete Magd das Schulgeld für ihren Sohn vom Mund abgespart.
Hans Geyer kannte als einziger ihren langen und stets verheimlichten Leidensweg. Sie wurde als eines von vierzehn Kindern über Nacht von einem verarmten Schweizer Kleinbauern nach Deutschland geschickt um einen Esser weniger am Tisch zu haben. Schwabenkinder wurden sie genannt und in einem langen Zug mit anderen Kindern mussten sie in ihren klobigen Holzschuhen vom Graubündener Land über schlammige Bergpfade des Bregenzer Waldes außer Landes ins Oberschwäbische laufen.
Mit 12 Jahren, die Mädchen in Sonntagskleid und mit geblümten Sonntagshut, auf dem Rücken einen Sack mit festen Arbeitskleidern, wurde jedes einzelne der 20 Kinder den Bauern und Handwerkern vorgestellt, die sich billige Jungknechte, Zimmergehilfen oder Hütemädchen aussuchten, wie auf einem Kuh- oder Pferdemarkt.
Sie wurden von oben bis unten gemustert. Gefragt war die Arbeitskraft der Kinder, die ohne Lohn, nur gegen Kost und Logis arbeiten mussten. Hans Geyers Mutter trug bereits in jungen Jahren hartherzige Narben davon.
Und wer sein Vater war erfuhr Hans Geyer nie. Er konnte mit seiner Mutter mitfühlen und dennoch vermisste er immer ein Gefühl der Nähe, etwas das wie Liebe sein könnte. Deshalb war er überglücklich, von seinem Bauern gelobt zu werden, von Maria geliebt zu sein und nun in neuer Uniform wieder bewundert zu werden.
Drei sehr unterschiedliche Seelen schlugen unruhig in seiner aufgewühlten Brust. Eine schicke Soldatenuniform für den Gang zur Kirche und alle festlichen Gelegenheiten? Dagegen Lob vom Bauern für fleißige Hofarbeit als Knecht. Und daneben, so richtig werten wollte er nicht, die Liebe Marias, die er nach außen, in Hattelfingen auf der rauen Schwäbischen Alb, immer noch nicht offen erwidern konnte.
Irgendwie siegte die Uniform über die Routine des alltäglichen. Nur Monate nach dem verlorenen Weltkrieg trat Hans Geyer dem Kyffhäuserbund bei. In diesem Kriegerbund versammelten sich alle Reservisten, die noch gerne Soldat sein wollten oder immer noch alten Zielen nachhingen.
Kaum hatte er den Antrag auf Mitgliedschaft gestellt, wurde ihm durch eine dreiköpfige Abordnung in schwarzen Sonntagsanzügen, Krawatten und polierten Schuhen, Urkunde und eine Medaille aus Messing überbracht, als offen zu tragenden Zeichen der Angehörigen dieses Bundes. „Trag unser Abzeichen mit Stolz!“ wurde Hans Geyer mitgeteilt. Er streichelte die Plakette mit der Aufschrift lange und innig. Mit großen Augen las er:
Blank die Wehr
Rein die Ehr
Und auf der Rückseite den Spruch von Hindenburg:
Aufrecht und stolz
Gehen wir aus dem Kampf
Den wir über vier Jahre
Gegen eine Welt von Feinden bestanden
Für Treue im Weltkriege - Der Kyffhäuserbund
Hans Geyer hing auch diese Medaille behutsam an seine nach dem Krieg weiter gewachsene Ordensspange auf der Ausgehuniform.
Gleichwertig hing dieses Vereinsabzeichen nun zwischen dem für mutigen Kampfeinsatz verliehenen Eisernen Kreuz, der silbernen Treuemedaille des Württembergischen Königs für den Fronteinsatz und dem schwarzen Verwundetenabzeichen.
Direkt beim ersten Treffen, nach kurzer Vorstellung der Neumitglieder, verlas ein Offizier eine Mitteilung der ehemaligen Obersten Heeresleitung. In ihr wurde eine Verschwörungstheorie thematisiert, die noch viele Jahre in verwirrten Köpfen umhergeisterte. Sie bildete die Grundlage für alle nationalistischen Theorien:
„Wir deutschen Soldaten sind im Felde unbesiegt geblieben! Vaterlandslose Zivilisten, zumeist Sozialisten und Juden, haben uns von hinten einen Dolchstoß versetzt! Nun sollen wir in Versailles endgültig in die Knie gezwungen werden!“
Maria Geyer dagegen träumte von einer glücklichen Familie. Wenn sie in einer Arbeitspause lang ausgestreckt auf dem weichen Moorboden lag und den in lauer Luft langsam wie Daunenfedern vorbeiziehende Wolken hinterher sah, gab sie ihren Traum mit auf Reise: „Ich will keinen Helden an meiner Seite. Verschwiegene Stunden in dieser friedlichen Weite bedeuten mir alles. Ja alles.“
Die offen zu Tage getragene Rache in Form hoher Reparationsleistungen, manche Demütigung der Verbündeten gegen Österreich-Deutschland, die im Zorn das Wort Versöhnung vergaßen, förderte solche Theorien. Europa funktionierte nach dem Motto, schlägst du mir einen Zahn aus, schlag ich dir einen Zahn aus oder bringst du meinen Verwandten um, bringe ich deinen Verwandten um oder der letzte Krieg provoziert den nächsten Krieg.
Hans Geyer fühlte sich geehrt, dass die neue Umgebung ihm einen heroischen Kampf bestätigte und ihm sagte, du wurdest verletzt aber nicht besiegt. Selbst gewählte Politiker aller Parteien sprachen vom Diktat von Versailles und zunehmend davon, Schande und Fesseln von Versailles baldigst abschütteln zu müssen.
Andererseits fühlte Hans Geyer, dass er auf den Hof gehörte und nicht in eine Kaserne.
„Maria, willst du mit mir später einen Hof übernehmen, auch wenn wir dafür unsere ganze Kraft opfern müssen?“ fragte er eines Tages, als er frei von allen äußeren Einflüssen versuchte, über seine Zukunft nachzudenken.
„Hans, das ist dein Thema, es ist immer noch Männersache. Doch danke, dass du mich fragst. Ich folge dir überall hin. Am liebsten arbeite ich mit dir auf Äckern und Wiesen und ich bin genau so gerne bei dir wenn wir im Stall die Tiere füttern. Einen Hof unser Eigen zu nennen wäre wunderbar, für dieses Ziel könnte ich auf viel verzichten. Dagegen möchte ich nicht, dass du dich beim Militär weiter verpflichtest und eines Tages im blutigen Feld des Krieges bleibst. Wie du am eigenen Leib erlebt hast, entstehen Kriege nicht aus Vernunft.“
Die unruhigen ersten Nachkriegsjahre vergingen träge schleichend. Sie fühlten sich an wie die nassen Herbstnebel, die jeden November vom Donaumoor heraufzogen und das Atmen erschwerten. In Hattelfingen umso mehr, als hier alle Informationen über Umstürze, des Kaisers Asyl ins holländische Schloss Amerongen und der Kampf um das Überleben der Demokratie durch den ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert, erst Monate später als in den weit entfernten großen Zentren ankam.
Die politische Spannung der Veränderungen erhöhte sich in diesem abgeschiedenen Dorf fernab politischer Entscheidungen nur langsam. Dafür aber unaufhaltsam wie steigendes Hochwasser, dessen zerstörerische Kraft plötzlich über die Ufer schwappt.
Als der deutsche Reichsaußenminister Walther Rathenau von Rechtsextremisten ermordet wurde, weil er als verhasste Symbolfigur der Weimarer Republik galt, trafen sich Bauern und Knechte, geheim, in unterschiedlichen Gasthäusern.
Die Bauern bevorzugten die Hirschenbrauerei in der auch Essen zubereitet wurde, die Knechte trafen sich so oft es der Geldbeutel zuließ beim einfacher bestuhlten und einige Pfennige billigeren Festungswirt.
Die Bauern hatten Angst um Ihre Selbständigkeit, sprachen über das Verhindern der von Kommunisten angedrohten, verhassten Kolchosen. Die Knechte, den Mägden wurde noch kein politisches Stimmrecht zugebilligt, forderten dagegen baldigen Wandel: „Nur weil seit Menschengedenken der Hof per Erbrecht vom Vater auf den ersten Sohn übergeht, bedeutet das noch lange nicht, dass wir Knechte ein Leben lang schuften und die bäuerlichen Herrschaften auf unseren geschundenen Rücken ausgiebig Erntedankfest feiern dürfen!“
„Hans, hast du eine Meinung zu dem was die anderen Knechte schwätzen?“ fragte der Kopfbergbauer.
„Ja, Kopfbergbauer, ich höre es. Hab aber nichts zu meckern, bin gerne Knecht bei Ihm. Ich gebe aber zu, dass ich mir vielleicht später eine eigene Scholle kaufen möchte. Vielleicht ergibt sich diese Chance, später mal“, antwortete Hans.
Den Kopfbergbauern plagte diese Entwicklung ungemein. In seinem tiefen Inneren wollte er selbst etwas mehr Gerechtigkeit, konnte jedoch keinesfalls auf Land verzichten.
Nicht einen Quadratmeter könnte ich der Gerechtigkeit willen an andere geben, dachte er, diese Stückelung unseres kargen und steinigen Bodens wäre mehr als unwirtschaftlich, für alle Beteiligten. Und für eine Einheitskolchose werde ich weder Grundstücke noch mich selbst hergeben.
Der Kopfbergbauer litt unter seiner humanen Einstellung und den offensichtlich heraufziehenden Unruhen. Er litt so sehr darunter, dass er krank wurde.
Er ging ein letztes Mal zu einer Versammlung in die Hirschenbrauerei um sich für die nächsten Treffen abzumelden. Als die Versammlung vom Bürgermeister, der gleichzeitig Großbauer war, eröffnet wurde, störten plötzlich in den Saal rennende auswärtige Sozialisten.
„Die können doch weder in Ulm noch in Langenau wissen, dass wir uns hier besprechen wollen. Hinter diesem Verrat stecken doch unsere verdammten Knechte!“ schrie der Bürgermeister erregt in den Saal.
Zwei Tage später marschierten braun und schwarz Uniformierte in Rotten über Äcker und Wiesen im Hattelfinger Donaumoor. Sie traten mit schweren Stiefeln gezielt Knechte zusammen und schlugen mit Knüppeln auf sie ein. Blutrot färbten sich Gras, Flechten und Boden. Die Unschuld der Moorlandschaft war brutal zerschlagen.
Bereits am nächsten Tag trat die Kopfbergbäuerin unerwartet an Hans heran und schloss ihn in ihre Arme. Dies war noch nie geschehen und Knecht Hans fragte: „Bäuerin, wie geht es ihr wohl?“
„Mir geht’s gut. Doch du solltest wissen, den Kopfbergbauern verlassen die Kräfte. Wir brauchen dich hier, dringender denn je. Halt dich von den politischen Wirren fern, bitte. Folge nicht denen die Räterepublik und Kolchosen wollen und stehe uns auf dem Hof zur Seite.“
Die Bäuerin hatte selten mit Hans Geyer gesprochen. Das war Männersache, seit Generationen. Sie war ohnehin in sich gekehrt. Vielleicht auch, weil der Bauer ihr in jungen Jahren öfter vorwarf, dass sie ihm keinen Nachfolger, sondern „nur“ eine Tochter Friederike geboren hatte. Und Friederike, das tat der Kopfbergbäuerin noch mehr weh, fand keinen Gefallen am Hof und verhielt sich introvertiert wie sie selbst. Ein schwieriges Mutter-Tochter-Verhältnis in schwierigen Situationen.
Dennoch schrieb die Kopfbergbäuerin in das Poesiealbum ihrer Tochter Friederike: „Das Donaumoor ist Zeuge unseres Seins, es soll Deine Inspiration sein und Zukunft.“
Friederike las und schlug diese Seite nie mehr auf.
„Ich wollte doch im Alter vom Hof leben und etwas Kultur genießen, wie man es von Ulm oder Heidenheim herhören kann“, sprach die Bäuerin zaghaft vor sich hin. Aber darüber sprechen wollte die Kopfbergbäuerin mit niemand. Auch nicht mit ihrer Tochter.
„Kopfbergbäuerin“, sagte Hans mit fester Stimme, „ich stehe fest an eurer Seite. Wie Ihr wisst, bin ich dem Kyffhäuserbund beigetreten und der ist eher national und nicht sozialistisch.“
Aufrecht ging Hans an die Arbeit, während aus Friederikes Zimmer die leicht kratzende Musik einer Schellackplatte über den Messingtrichter des von Hand aufziehbaren Grammophons ertönte: „Zuckerlilli du bist süß, tanz mit mir ins Paradies…“
Die Kopfbergbäuerin bat Maria und Hans in die Wohnstube, stellte sich vor beide, breitete die Hände aus und sagte feierlich: „Ich geb die Verantwortung für alle Hofarbeiten in Eure Hände.“
Hans stand aufrecht und Maria hob den Kopf, wie nach einem Abendmahl zu Ostern. Unerwartet aber glücklich nahmen Knecht Hans und Magd Maria das Vertrauen entgegen.
Knecht Fritz arbeitete weiter wie seit Jahrzehnten mit stoischer Ruhe die einfacheren Handgriffe ab. Durch die neue Arbeitseinteilung bekam die Bäuerin mehr Zeit, sich intensiv um ihren kranken Mann zu kümmern. „Soll ich dir nicht einen Arzt aus Langenau kommen lassen? Ich könnt den Hans danach schicken? Unser Ross steht gesattelt im Stall“, fragte sie fast stündlich. Doch der Kopfbergbauer lehnte jedes Mal ab: „Bäuerin, ich brauch keinen Quacksalber. Hab mein Arbeitspensum vollbracht. Die neue Zeit ist nicht mehr meine Zeit.“
Er aß immer weniger, trank kaum noch und bald war allen klar, der Kopfbergbauer wollte nicht mehr leben.
Der Tod kam ruhig, zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang, als wäre er mit weit offenen Türen erwartet worden. Alle empfanden das Lebensende als Erlösung für den Bauer. Ein Makel nur blieb, mitten in der Ernte war Sterben eher unpassend.
Der Kopfbergbauer wurde von den beiden Klageweibern in Hattelfingen gewaschen, routiniert in den Sarg drapiert, die Hände über der Brust gefaltet, mit Blumen geschmückt und im Schlafzimmer aufgebahrt. Alle Bauern, ob groß oder mit nur wenige Morgen Land ausgestattet, empfanden es als Ehrensache, vor der Beerdigung in drei Tagen, in schwarzen Anzügen Abschied von Ihresgleichen zu nehmen. Er hatte zu ihnen gehört, war nie aufgebracht und immer ehrlich gewesen.
Die Kopfbergbäuerin schlief eine Woche lang auf dem ausgesessenen Sofa in der Wohnstube und musste die ungewohnte Schlaflage mit langanhaltenden Rückenschmerzen büßen.
Zur Beerdigung spielte die Hattelfinger Blaskapelle piano und tragend einen Trauermarsch. Die Bäuerinnen gingen als Gruppe gemeinsam demütig geBürgt. Sie trugen zu ihrer Tracht schwarze Hüte mit schwarzem Gesichtsschleier. Ihre Hände verbargen sie in ihren verdeckt eingenähten Rocktaschen.
Die sechs Sargträger behielten ihre Zylinder und die Musiker ihre schwarzen, breitkrempigen Hüte auch in der Sommerhitze auf dem Kopf. In die oben eingedrückte Hutfalte steckten die Bläser als gemeinsames Zeichen ein Taschentuch, ein weißes zu Hochzeiten, ein dunkles nun zur Beerdigung. Dazu wurde zu diesem traurigen Anlass eine schwarze Armbinde am rechten Arm getragen, Jahre später dann ein Schwarzes Band am Jackenaufschlag.
Erst als der Sarg nach der Predigt abgesenkt wurde nahmen die Männer die Hüte vom Kopf und die Frauen schluchzten leise.
Das Wehklagen der zwei alten Klageweiber, die bei jeder Beerdigung für einen Vesperteller mit Blut- und Leberwurst anwesend waren, hallte laut über die Kirchhofmauern.
Die Bestattung einte überraschend das ganze Dorf. Ausnahmslos alle unterbrachen die Feldarbeit für einen halben Tag. Selbst die Seilernachbarn, deren Hof auf der Rückseite der Scheune angrenzte und mit denen die Kopfbergbauern sprachlos nebeneinander her lebten, weil sich keiner mehr an die Ursache des Streits entsinnen konnte, aber Generationen wussten, dass man nicht miteinander sprechen kann, selbst diese Nachbarn kamen zum Trauergottesdienst. Die Gräben schienen für ein paar Stunden geebnet und alle trauerten aufrichtig um den angesehenen Kopfbergbauern.
„Hans“, sagte noch auf dem Kirchhof der Bürgermeister und klopfte ihm auf die Schulter, „nun kannst du beweisen wie gut du bist!“
Dieses Vertrauen war ein wirkungsvoller Ansporn. Hans Geyer wollte in ein paar Jahren ohnehin einen Bauernhof führen und so entlastete er die Kopfbergbäuerin und die bei der harten Hofarbeit etwas linkisch und ungeschickt zulangende Tochter Friederike von allen Tätigkeiten, die sonst der Bauer durchführte.
Sonntag morgens gegen Elf, zwei Wochen nach der Beerdigung des Kopfbergbauers, als die Bäuerin gerade vom Kirchgang zurückkehrte, bat sie Hans in die Wohnstube: „Hans, kannst du mir beim Führen des Erntebuches helfen?“
Hans Geyer trat erschrocken einen Schritt zurück. „Ich helfe gerne, Bäuerin, hab das aber noch nie gemacht. Sollten wir nicht Friederike oder Maria dazu nehmen, die gingen doch auch zur Schule?“
„Das ist ein guter Einfall. Rechnen ist nicht nur Männersache. Ich hol beide dazu“, sagte die Kopfbergbäuerin und rief Magd und Tochter. Zu viert saßen sie eng nebeneinander um den alten Schreibsekretär und hatten vor dem dunkelblauen Tintenfass, Tintenfüller mit vergoldeter Feder, Fließpapierhalter und tiefschwarz polierter, schwerer Basalt-Stiftschale das große Buchjournal ausgebreitet.
Zur Einstimmung sagte die Kopfbergbäuerin: „Wir essen heute etwas später, wir sollten zusammen die Zahlen auf den neusten Stand bringen. Es ist unüblich, dies im großen Rahmen zu tun doch die Situation zwingt mich dazu. Aber bitte: Kein Wort darüber zu den anderen Leut im Dorf!“
In die kaufmännische Arbeit hatte der Kopfbergbauer ein Leben lang niemand Einblick gewähren lassen. Diese Geheimniskrämerei erschwerte dann auch das Führen des Buchhaltungsjournals. Mühsam entdeckten sie, wo Kauf von Saatgut oder Verkauf von Gerste an die Mälzerei eingetragen werden musste. Der Bäuerin war dieses Zahlenspiel in festgelegten Reihen suspekt, Friederike mochte Rechnen ohnehin nicht. Nur Hans und Maria arbeiteten sich eifrig in das Thema ein. Nach gut einer Stunde ging die Bäuerin in die Küche: „Zum Essen könnt ihr mir die Zahlen ja vorlegen.“
Irgendwie bekamen Hans und Maria das Thema in den Griff und Hans flüsterte über den Tisch zu Maria: „Heuer kostet uns die Rechnerei noch Kraft, morgen benötigen wir diese Erfahrung hoffentlich für uns selbst. Und noch was, Maria, die hochwohlgeborene Bauernschaft ist auch nicht gescheiter als wir.“
Maria Renzer und Hans Geyer arbeiteten tagsüber Hand in Hand und auch lange Nächte führten sie immer enger zusammen. Doch eine nur hauchdünne, hellhörige Wand trennte sie von der Schlafstube von Knecht Fritz. Alles musste leise geschehen.
Allein die Müdigkeit nach großem Arbeitspensum verzögerte noch den Wunsch nach einer gemeinsamen Familie.
Die Arbeit auf dem Hof ging ohne Einbruch ihren Gang. Hans und Maria hatten nun das doppelte Tagewerk zu erledigen aber sie sahen dies nicht als Last, sondern als wichtige Prüfung für ihr weiteres Leben.
Friederike erstand sich vom fahrenden Händler eine bunt bemalte Schachtel mit einer Spielzeug-Laterna magica. Ein Blechgehäuse, mit Einstellplatz für eine Kerze, hinter der ein Hohlspiegel den Lichtstrahl nach vorne bündelte. Der Spiegel schickte das Kerzenlicht durch ein Rohr mit optischer Linse an die gegenüber liegende Wand. In einem seitlichen Bildeinschub wurden auf Glas gemalte Bilder eingesteckt. Drei Bildmotive gehörten zum Set, zwei Märchenbilder und ein religiöses Motiv mit Adam und Eva im Garten Eden.
Durch das flackernde Licht der Kerze wurden die Bilder unruhig an die Wand projektiert und wirkten immer, als wären sie in Bewegung. In den Abendstunden stellte Friederike zwischen Laterna magica und die gekalkte Wand noch eine zweite Kerze, das minderte etwas von der Lichtausbeute aus dem Bildprojektor, setzte aber durch die flimmernde Luft die Bilder noch mehr in Bewegung.
Friederike schien mit Grammophon und Laterna magica glücklich zu sein. Unterhaltungen mit der Mutter, gar mit Magd oder Knechten, vermisste sie offenbar nicht. „Das Kind wird zur Einzelgängerin, wenn es den lieben langen Tag in ihrer Kammer vor diesen Geräten sitzt. Soll das die neue Jugend sein?“ Flüsterte die Bäuerin ohne es ändern zu wollen.
Im September, nachdem die Frucht gedroschen war, ging die Kopfbergbäuerin zu ihrem Pflaumenbaum in die Halde hinaus. Sie wollte, wie jedes Jahr, zweimal ernten. Die erste Ernte für einen Pflaumenkuchen, die größere zweite, eine Woche später, um Dörrpflaumen im Ofenrohr zu trocknen.
Während sie den Kalksteinweg aus Hattelfingen hinaus ging attackierten sie unangenehme, ungleichmäßige aber kräftigen Hitzewallungen. Entweder die Wechseljahre plagen mich immer noch oder das schwüle Wetter drückt hinterhältig auf meinen Kreislauf, spürte sie. Der Übergang vom Sommer in den dunkleren und feuchten Herbst quält meinen Körper. Jedes Jahr aufs Neue überfallen mich Rheuma und Hitzewallungen.
Auf dem Rückweg rollten ihr plötzlich alle Pflaumen aus dem prall gefüllten Küchenschurz. Die Kopfbergbäuerin stürzte zu Boden und starb mit einem leisen Seufzer, ohne Zeugen, ohne dass ihr jemand die Hand gehalten hätte, gefunden erst nach zwei Stunden auf dem staubigen Kalksteinweg.
Wie bereits vor Wochen beim Kopfbergbauern versammelte sich auch hinter dem Sarg seiner Frau ganz Hattelfingen. Der Tod bildete aufs Neue die stärkste Klammer der Dorfgemeinschaft in dieser herben Landschaft.
Der Pfarrer redete von ihrem stillen und liebreizenden Wesen das jetzt den ewigen Schlaf finde, und wieder etwas von Erde zu Erde und die bäuerlichen Blasmusiker spielten, immer noch in Übung, den Trauermarsch in b-Moll von Frederic Chopin.
Es gehörte sich, den Glocken zur Beerdigung zu folgen, selbst wenn einige nur von der Vorfreude auf einen Leichenschmaus getrieben wurden. Die ausrichtende Familie durfte sich nie lumpen lassen, das hätte gegen die Ehre verstoßen und überhaupt, das Ansehen innerhalb der knapp achthundert Seelen im Dorf hing real vom Umfang des Leichenschmauses ab.
Hans Geyer ließ ein ausgewachsenes, sechs Zentner schweres Schwein schlachten und der Wirt vom Hirschenbräu machte eine deftige Schlachtplatte mit Sauerkraut und Bratkartoffeln. Friederike war froh, dass Hans ihr alle Arbeiten zur Beerdigung abnahm. Selbst den Gang zum Rathaus und Pfarrei, die ihm als Knecht in der dörflichen Hierarchie nicht zustanden. So konnte sie allein und still in ihrer Kammer um ihre geliebte Mutter trauern.
Eine Person fehlte, was selbstverständlich alle anderen Trauergäste gleich bemerkten. Denn auch beim Trauern wurde, versteckt zwar, doch nicht weniger neugierig, in die Runde geschaut. Maria fehlte. Ihr war am Morgen speiübel geworden. Sie übergab sich fast ohne Unterbrechung und ahnte erschrocken, auch ängstlich, was die Ursache sein könnte.
Liebe hatte zu dieser Zeit fast immer Konsequenzen, zumal die Baderin, die alte Kopfbergbäuerin hatte immer „Stübnerin“ gesagt, mit ihren routiniert durchgeführten Abtreibungen ausschließlich verheirateten Frauen „behandeln“ durfte.
Mitten am Tag, für alle sichtbar, hatte der Pfarrer vor Jahren die Baderin in ihrer nach markigen Wiesenkräutern duftenden Badestube im rückseitigen Anbau der Molkerei besucht und ihr unmissverständlich mitgeteilt:
„Baderin, ich will, dass du deine reichliche Erfahrung aus den Jahren deiner Wanderschaft quer über die Alb beim Wundheilen nutzt oder beim Ausschneiden eingewachsener Zehennägel oder beim Zahnziehen mit deiner großen Universalzange. Ansonsten, ich rede von Abtreibungen bei ledigen Weibern, werde ich von der Kanzel über dein verwerfliches Tun predigen!“
„Pfaffe, sakrischer,“ fluchte die Baderin als sie die dicke Haustür hinter dem Pfarrer geschlossen hatte, „halt er lieber seine Triebe im Zaun als mir anzuraten, ledigen Frauen in Not zu helfen.“
Maria war bewusst, dass ihre Monatsblutungen ausgeblieben waren, sie hatte dieses als unrein geltende Thema wegen der intensiven Hof- und Feldarbeit jedoch verdrängt. Nun ging sie einen Tag nach der Beerdigung der Kopfbergbäuerin zur Hebamme.
„Babette“, sagte sie, „ich spür, ich bekomm ein Kind.“
„Brauchst mich nicht so angstvoll an zu schauen, Maria, heb deinen Rock hoch und zieh deine Unterhose aus...“
Der Minutenzeiger an der Wanduhr, einem geschnitzeten Regulator mit Messingpendel hatte kaum eine viertel Stunde weiter getickt, da sagte die Hebamme: „Ja, Maria, du bist schwanger. Schone dich ein wenig. Wasche dich immer, aber nicht zu heiß und nicht zu kalt und komme in vier Wochen wieder. Alles Gute für dich und Hans und dem Mädchen oder Jungen, was immer es auch sein wird.“
Im fünften Monat holte die Hebamme ihr gedrechseltes Holzstethoskop aus dem runden Lederkoffer mit dem großen Metallbügel, untersuchte Maria erneut und sagte:
„Maria, der Doktor Sengler aus Langenau hat sich ein gebrauchtes Automobil gekauft. Einen schweren Horch. Er kommt zukünftig jeden ersten Montag des Monats nach Hattelfingen und hält Sprechstunde im Rathaus. Da gehst du zwingend hin. Hast du gehört! Er kommt auch zur Niederkunft. Ich möchte dies gerade für dich so geregelt sehen, denn“, Babette legte eine Kunstpause ein, „du wirst dich freuen können, Maria, auf diesen für dich so wichtigen Moment...“
Babette strahlte, als würde sie selbst die glückliche Schwangere sein: „Ja, es geschieht etwas ganz Besonderes! Maria, das gab's bei uns in Hattelfingen schon viele Jahre nicht mehr: Maria, du bekommst Zwillinge.“
Babettes Fröhlichkeit zu der lebensverändernden Prognose „Zwillinge“ löste die ängstliche Zurückhaltung bei Maria. Ja, dachte sie, das kann Babette. Sie freut sich offen, geradezu euphorisch über das neue Menschenkind, egal ob männlich oder weiblich, ob wunderschön oder grottenhässlich, ob sympathische Eltern oder ekelige, ob verheiratete Mutter oder wie ich selbst immer noch ledige.
Zum Abschied sagte Babette: „Freu dich auf die Entbindung, es wird ein wunderbares, ein einschneidendes Erlebnis für dich werden.“