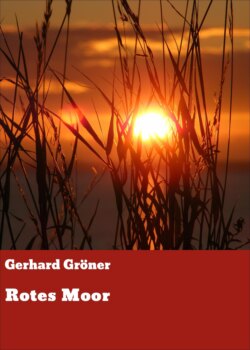Читать книгу Rotes Moor - Gerhard Gröner - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Kapitel
ОглавлениеNoch ein drittes Ereignis in diesem Jahr führte alle Hattelfinger zusammen. Die Bauern beschlossen, ein eindrucksvolles Kriegerdenkmal für ihre ehrenvoll als Helden gefallenen Söhne erstellen zu lassen. Mitten im Dorf solle es auf massivem Sockel thronen, so dass jeder Gang zum Rathaus oder zur Kirche zwangsläufig daran vorbeiführte.
Eine über Generationen als Steinmetze bekannte Familie im nahen Stotzingen, an der -ingen-Endung wie Hattelfingen als alemannische Gründung erkennbar, sollte wegen eines monumentalen Ehrenmals angefragt werden.
„Die Stotzinger Steinbildhauer können das hervorragend. Die bearbeiten in vier oder fünf Ortschaften die Grabsteine“, vergaben kurz entschlossen Bürgermeister und Großbauern den Auftrag.
Die staubige Steinmetz-Werkstatt neben dem kleinen Wasserschloss am Rande des Dorfes, ernährte die Großfamilie, mal mehr, mal weniger gut. Eine andere Arbeit als die Nachfolge des Vaters anzutreten wurde jedoch zumindest bei den ersten beiden Söhnen niemals in Erwägung gezogen und so freuten sie sich auf den neuen Auftrag. „Allemal besser als immer nur als Grabsteine behauen“, sagten sie mit strahlenden Gesichtern.
Eine uralte, weit ausladende, über viele Jahrzehnte achtvoll verehrte Versammlungslinde vor dem Hattelfinger Rathaus sollte den Platz für das kolossale Denkmal räumen. So wollten es die Großbauern. Manches gerechte, für die Gemeinschaft wertvolle Schiedsurteil war unter ihren kräftigen Ästen schon gesprochen worden und mancher Freudentanz zu Erntedank ließ ihre Wurzeln mitschwingen.
Auf diese natürlich gewachsene, in der Abenddämmerung mystisch wirkende Landmarke, hieben bald wuchtige Axtschläge ein und das Werk einer Zweimannsäge mit langem Blatt ließ sie traurig langsam zur Seite kippen.
Das Brennholz des geschichtsträchtigen Baums wurde nach hitzigen Diskussionen, als ein von jedermann tragbaren Kompromiss, dem Herrn Pfarrer zum Heizen der Kirche zuerkannt.
„Oh, könntet ihr nur hören, was sie uns zu erzählen gehabt hätte“, sagte ein alter Greis, den jedoch keiner im Dorf mehr ernst nehmen wollte, „ihr würdet vor Achtung auf die Knie fallen.“
Nicht die hohe, gleichmäßig gewachsene Linde, unter der in sechs Generationen viele besonnene Schiedsurteile gesprochen wurden, durfte den ehrenvollen Platz zwischen Rathaus und Kirche einnehmen, ein steinernes Andenken an Krieg und Heldentod sollte so schnell als möglich das Zentrum schmücken. Der Steinmetzfamilie kam der Auftrag gerade recht. Es war gerade keine Sterbenszeit und alle saßen ohnehin zu lange um den großen Tisch in der Küche um Karten zu spielen.
Seit Jahrzehnten wurden in dieser Gegend den armen Bediensteten aus Höfen und Handwerksbetrieben, vom Schreiner gefertigte, günstige Kreuze aus schnell vergänglichem Fichtenholz aufs Grab gestellt. In einigen Gemeinden wie Hattelfingen, gedachten die betuchten Bauern ihrer Verstorbenen vor Eisenkreuzen und nur die Nachkommen besonders reicher Großbauern, Händler oder Gemeindeschreiber leisteten sich einen Grabstein. Sehr selten waren Familiengrabstätte die von den Steinmetzen als Mausoleum aufgebaut wurden.
Ständig auf einen reichen Toten warten war nicht nach dem Sinn der Stotzinger Steinmetze, zumal sie genau wussten, dass Aufträge in trockenen Sommern und Wintern und bei bestimmten Konstellationen von Mond und Sternen nur spärlich eintrudelten. Die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Tod drückte ihnen immer wieder aufs Gemüt.
Manchmal, immer seltener in diesen Nachkriegsjahren, gab es noch einen Fenstersims auszubessern oder eine Türwange am zierlichen Wasserschlösschen. Doch auch die adeligen Herrschaften begannen nach dem Untergang der Monarchie intensiv zu sparen.
Ansonsten warteten sie darauf, dass sie ein Bauer rief, wenn die Treppe aus Muschelkalk zum Haus hinauf nach jahrelanger Benutzung abgelaufen war. Meist sagten die Bauern: „Dreh mir einfach die einzelnen Stufen um, dann ist das Abgelaufene unten und nicht mehr sichtbar.“
„Mist“, fluchte der Steinmetz, „diese Aufträge schinden nur den Rücken und der Lohn wird zumeist in Naturalien, Kartoffeln oder Mehl ausbezahlt.“
Etwas lohnender waren Aufträge bei Bauern, deren Treppenstufen bereits vor Jahren umgedreht wurden und die nun neue Stufen benötigten. Bei solchen Aufträgen blieb wenigstens etwas Materialverdienst in der Kasse.
Nun jedoch rief der Vater seine Söhne: „Schnell, hurtig, kommt her: Diese Ehrendenkmal fordert von uns alles was unsere Berufsehre als Steinmetze hergibt und verlangt unseren Werkzeugen nahezu Wunder ab.“
Nachdem der gefällig gezeichnete Entwurf mit Stahlhelm, gekreuzten Gewehren und ausladendem Lorbeerkranz genehmigt war, schickte die Steinmetze schwer belastbare Pferdekarren in den Schwarzwald um blockige Quader aus rotem Sandstein zu holen. Ohne Verzögerung wurde gehämmert bis die Meißel fast glühten, Details ausgeformt, die Namen der im Krieg „gebliebenen“ Söhne fein eingeschnitten und das von allen gewünschte Motto in den Kopfstein unter den Stahlhelm gehauen:
+ Blank die Wehr +
+ Rein die Ehr +
Nach zwei Monaten, an einem warmen Sonntagmorgen, standen die Steinmetze aufrecht, stolz, mit hoch gekrempelten Hemdsärmeln und neuen Lederschürzen vor dem Kriegerdenkmal. Feierlich wurde von den Hauptspendern, den vier Großbauern die weiße Stoffbahn abzogen. Der Bürgermeister legte wortlos, nur lautstark die Hacken zusammenschlagend, einen Kranz nieder und der Pfarrer bat die Hände zum Gebet zu falten.
Wieder spielte die Blasmusik was die Lungen hergaben. Uniformierte des Kyffhäuserbundes und einer Schützengilde gaben den Toten Ehrengeleit, der Pfarrer sprach würdevoll, Ehrensalven wurden abgeschossen und gemeinsam wurde mit einem Gebet der Helden im Kampf um das „Gütig Vaterland“ gedacht.
Hans Geyer hatte aus Hochachtung vor den erst vor wenigen Wochen gestorbenen Kopfbergbauern seine Uniform nicht angezogen, dafür ein breites, schwarzes, seidenes Trauerband am rechten Arm angelegt. Maria hakte sich, obwohl immer noch nicht verheiratet, bei ihm unter. Zur Zurückhaltung bestand keine Veranlassung mehr. Babette, die geschwätzige Hebamme, hatte das freudige Ereignis bereits im Dorf verbreitet und der Bauch trat unter Marias bestickter Trachtenjacke unübersehbar hervor.
Und noch etwas fiel den flinken Augen in der Runde auf: Friederike, die Erbin des Kopfberg-Bauernhofes stand die ganze Zeremonie nicht standesgemäß bei den Grundbesitzern, sondern neben Knecht Hans und Magd Maria. Sie hielt mit gefasster Mine die ganze Zeremonie durch, ohne hin und her zu gehen, ohne ungeduldig nach Ablenkung zu suchen und sagte dann völlig unerwartet zu Hans und Maria:
„Wenn ihr beiden heiraten wollt verkaufe ich euch den Kopfberghof. Ihr müsst euch noch nicht entscheiden. Aber euch beiden zusammen schenke ich das Vertrauen, den Hof meiner Vorfahren weiter zu bewirtschaften. Ihr habt nach dem Tod meiner Eltern alles richtig gemacht. Ich kann mir niemand anderes als neue Kopfbergbauern vorstellen.
Ich möchte in die Stadt ziehen. Nicht nach Ulm, das ist auch nur Provinz, auch nicht nach Berlin, da lachen mich die Preußen wegen meinem Dialekt aus, wahrscheinlich nach Stuttgart.“
„Maria“, bat Hans auf dem Rückweg von der Denkmalenthüllung, „hinterfrag bitte die Ernsthaftigkeit von Friederikes Ansinnen. Diese Chance ist für uns eine grandiose. Wir müssen sie nutzen, wir kennen jeden Winkel im Hof, jeden Acker, jedes Stück im Moor, jedes Tier, auch Stallknecht Fritz wird vermutlich bei uns bleiben und wir kennen die Zahlen. Ich will nicht enttäuscht werden, rede bitte du mit ihr, von Frau zu Frau.“
Noch am selben Abend setzten sich Maria und Friederike in der Wohnstube zusammen und flüsterten vorsichtig über den Verkauf des Hofes.
„Willst du ernsthaft verkaufen, Friederike?“
„Oh Maria, ich fühle als lebe ich zum zweiten Mal hier auf diesem öden Flecken Erde, so langweilig können Jahre sein. Vielleicht find ich den Strahl Licht, auf dem ich in die Zukunft wandern kann.“
„Friederike“, fragte Maria weiter, „hast du schon Ziele, in Stuttgart?“
„Ja, Maria“, Friederike lehnte sich weit zurück und schloss die Augen, „ja, Träume habe ich. Mein Ziel ist die Reise. Ich hätte es meinem Vater nie recht machen können. Ich wollte mich auch nicht in Hattelfingen verheiraten lassen, meine Mutter hat mir bei diesem Thema sehr viel Verständnis entgegengebracht. Ich passe nicht hierher in dieses gottverlassene Nest, nicht aufs Land und schon gar nicht auf die mich schon als Kind abweisende, steinige und ausgetrocknete Alb.“
„Aber wir, der Hans und ich, wir sind stets gut mit dir ausgekommen, oder?“
„Ja, Maria, das stimmt sehr wohl, ihr seid lieb. Doch auch ihr kennt nicht meine Gefühle. Wenn ich mir nachts die Frage stelle, warum ich gerne unser Haus, die Zimmer, unsere Scheune, ja alles, in tiefem Dunkelblau anstreichen möchte. Wenn ich morgens aufwache und mich frage, welche Wirkung die Farben von samtigem Rot oder aggressivem Grün oder leuchtendem Orange auf unsere Entscheidungen und unser Wohlbefinden haben.
Schau jetzt nicht so erschrocken, Maria, genau das bin ich. Und nicht das, was man von mir erwartet. Man ist wie man ist, ist nicht diejenige, die das Dorf haben will! Und Maria, das fühle ich nagend in mir, es würde meine Seele verschleißen, wenn ich den langen Weg der Anpassung gehen müsste, deshalb geh ich weg.“
„Wann würdest du denn verkaufen, noch heuer?“
„Gleich, Maria, gleich in den nächsten Wochen. Aufschieben hieße meinen Weg verlassen. Rede mit Hans, fragt euch ob der Hof eure Zukunft sein kann und leitet anschließend alle Gespräche mit den Ämtern ein.“
„Ja, Hans, der Wille zum Verkauf ist bei Friederike nicht mehr auf zu halten, wir beide müssen uns nun einig sein“, berichtete Maria. Sie saßen nebeneinander auf der Bank und das Flackern einer Kerze spiegelte sich in ihren ernsten Gesichtern. Gedankenverloren öffnete Maria das Ende ihres Zopfes und band ihn wieder neu, sie schaute Hans tief in die Augen, um dann leise weiter zu reden:
„Aber, Hans, ich möchte mit dir zuerst darüber reden ob wir nicht heiraten. Wir lieben uns doch und ich möchte nicht, dass unsere Kinder ledig auf die Welt kommen. Sie sollen nicht Renzer sondern Geyer heißen.“
„Maria“, antwortete Hans ruhig, „diese einmalige Gelegenheit, die wir uns beide lange herbeigesehnt haben, müssen wir nun beim Schopfe packen.“
„Du hast recht, Hans, dies ist unsere große Chance einen Bauernhof zu erwerben. Ich glaube auch, dass wir mit dem Kopfberghof nichts falsch machen können. Er ist nicht zu groß und nicht zu klein. Wir beide und unsere Kinder könnten gut davon leben. Dennoch, wir sollten noch eine Nacht drüber schlafen.“
Nach einer vor Aufregung schlaflosen Nacht, noch vor dem Gang in den Stall, nahm Maria das Thema wieder auf:
„Hans, ich möchte das offen ansprechen. Ich würde gerne am Hof beteiligt sein. Du brauchst bestimmt auch mein Erspartes und ich will, dass unsere Kinder später den Hof von uns beiden bekommen, nicht von einem Elternteil. Wie oft schon hat das Bauernfamilien zerstört, wenn egoistisch das ICH und MEIN im Vordergrund standen. Ich hätte gerne, dass wir immer WIR und UNSER sagen können.
Und noch ein wichtiges Thema: Wenn wir vor der notariellen Beglaubigung heiraten, muss nicht später mein Nachname und der unserer Kinder umgeschrieben werden. Das kostet dann ein zweites Mal Geld.“
Hans war zunächst sprachlos. In einer Zeit, in der erst vor wenigen Jahren das Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde, fand er Marias flammende Ansprache mutig. Gleichzeitig auch bewundernswert.
„Lass mich überlegen, Maria“, Hans Geyer hielt die Hand an die Stirn, „also gut. Wir teilen uns die Aufgaben, du organisierst den Hochzeitstermin und ich finde einen Termin mit Friederike, Notar und Bürgermeister. Ich muss ohnehin vorher auf die Raiffeisenkasse nach Langenau um die Finanzierung zu klären.“
Hans Geyer überlegte weiter: „Ein anderes Thema, Maria, soll ich mit Fritz sprechen oder willst du ihn fragen?“
„Frag du ihn, Hans. Der Fritz ist noch von der alten Sorte, der will nicht von einer Frau angesprochen werden und wir brauchen ihn. Er hat die Stallarbeit sicher im Griff, von morgens um sechs bis über den Sonnenuntergang hinaus. Und er ist genügsam.“
Hans ging über den Hof direkt zu Fritz, der gerade Rüben zu Futter zerhackte und fragte: „Fritz, du kannst es dir vielleicht denken. Wir, also Maria und ich, haben Interesse daran, den Kopfberghof zu übernehmen. Würdest Du auch für uns arbeiten?“
Aus dem als redefaul bekannten Stallknecht Fritz brach es unvermittelt heraus:
„Glaubt ihr vielleicht ich wäre blind und taub. Es ist gut, dass du zu mir kommst, Hans. Ich hab schon darauf gewartet. Das ganze Dorf weiß doch von Babette, dass ihr Zwillinge bekommt und die junge Bäuerin, die Friederike wollt schon als Kind von hier weglaufen. Und du und Maria, ihr habt ja auch immer fleißig gespart.“
Hans Geyer atmete erleichtert auf.
„Also“, sprach Knecht Fritz weiter, „in meinem Alter wechselt man nicht mehr den Hof. Ich will bei euch bleiben, kenne ja alles in- und auswendig. Und die Rosl kalbt in zwei Monaten, das ist meine Lieblingskuh, da muss ich ohnehin dabei sein.
Ich wünsche dir und Maria viel Glück und uns eine ruhige Zusammenarbeit.“
„Danke, Fritz“, sagte Hans nachdem er sich von den unüblich langen, wohl vorab überlegten Sätzen beeindrucken ließ, „danke. Wir ergänzen uns und passen prima zusammen.“
Als würde der alte Kopfbergbauer noch den Takt vorgeben fügte Hans Geyer dann hinzu: „Also, dann lass uns wieder an die Arbeit gehen.“
Obwohl Schreiben nicht unbedingt zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählte, setzte Hans noch am gleichen Abend einen Brief an die Bank auf, mit der Bitte um einen Termin für ein Kreditgespräch.
Prompt kam die Antwort mit einer Einladung für ein klärendes Sondierungsgespräch am nächsten Dienstag.
Hans zog seine Sonntagskleider an und sagte zu Maria: „Drück uns beide Daumen, heute entscheidet sich unser zukünftiges Leben.“
„Ich drück uns selbstverständlich die Daumen. Doch eines ist auch klar, Hans, unser Leben hängt nicht alleine vom Eigentum ab. Es gibt noch wichtigeres…“
Hans war bereits ungeduldig zu Tür hinausgerannt. Die volle Konzentration galt nun dem entscheidenden Gespräch: Kredit oder kein Kredit, Hof oder nicht Hof, Bauer oder weiterhin Knecht.
Wie benommen stand er kurze Zeit später im kleinen Kassenraum mit glanzlackierter Holzbarriere und halbhoher Glasscheibe mit satinierten Jugendstilelementen. Hans Geyer fühlte sich in dieser Umgebung sichtlich unwohl, verschämt schaute er sich um. Unruhig trat er von einem Bein aufs andere.
„Kommen sie bitte durch“, sagte ein älterer Mann mit akkurat gescheitelten grauen Haaren, weißem Hemd, einem Binder am Hals und an den Unterarmen graue Ärmelschoner. Er begleitete ihn, bis sie vor einer gepolsterten Tür stehen blieben, deren polierte Messingbeschläge durch den ganzen Korridor strahlten.
Nach fast zaghaftem Klopfen des Angestellten am Türrahmen und der unendlich erscheinenden Wartezeit durfte Hans eintreten.
„Guten Tag, Herr Geyer. Setzen sie sich bitte“, der Mann im dunklen Anzug wirkte seriös und sympathisch.
Hans starrte auf den riesigen Schreibtisch aus dunkel gebeizter Eiche. Die Eckpfosten waren gedrechselt wie klassische Palastsäulen: quadratischer Fuß, lang hoch gezogener Schaft und geschnitztes Kopfteil. In der Platte spiegelte sich das Fensterkreuz und in der Mitte des Schreibtisches thronte eine Bronzeskulptur, ein Fels mit einem Adler, der elegant die weiten Schwingen ausbreitete. Die bronzene Tischlampe mit einem Schirm aus bunten Glasperlen beleuchtete die Szene.
„Nun erzählen sie mal Herr Geyer: Was möchten sie gerne mit mir besprechen. Und wie wollen sie den Kauf des Kopfberghofes bewerkstelligen.“
Hans Geyer erklärte die Kaufabsicht, gemeinsam mit Maria Renzer, die er bald zu ehelichen gedachte. Er legte mit vor Aufregung schweißnassen Händen einen Brief des Bürgermeisters vor, in dem dieser das Anwesen, Haus, Scheune, Stall und den Grund des Kopfberghofes beschrieben und bewertet hatte.
Nach gut einer Stunde war alles geklärt. Hans atmete tief durch, leichter als ich dachte, sagte er sich und der Chef der Raiffeisenbank, der schnell erkannte, dass das Risiko durch Grundbesitz abgedeckt war und hier ein neuer, zukünftig solventer Kunde vor ihm saß, betonte zum Abschied:
„Also, Herr Geyer, reden sie mit dem Fräulein Friederike. Sie beide als zukünftiges Ehepaar Geyer bekommen den Kredit. Doch es wird für alle Beteiligten leichter, wenn Fräulein Friederike einer Zahlung in drei Raten zustimmt, die erste nach dem Kaufabschluss beim Notar, die zweite ein Quartal später und die dritte nach einem weiteren Quartal. Dann haben sie auch bereits einige Äcker abernten können.“
Beim Hinausgehen sagte er noch: „Und denken sie an den Termin mit dem Notar.“
„Maria“, Hans Geyer hielt ihren Arm und flüsterte. Er wollte nicht, dass die hallenden Wände seine Worte weitertrugen und Missverständnisse im Dorf entstehen könnten, „wir bekommen vom Hof-Darlehen ein paar Reichsmark auf die Seite. Für einen neuen Anstrich des Kopfberghofes. Der alte Kalkanstrich bröselt überall ab und alle in Hattelfingen dürfen sehen, dass Veränderungen den Kopfberghof aufhellen.“
Hans war glücklich und ebenso Maria: „Das hast du fein gemacht, Hans. Aber denk nicht nur an den Notartermin, sondern auch an unseren Hochzeitstermin.“
„Hast ja recht, nun reden wir beide zunächst mit Friederike, dann vereinbaren wir die Termine. Zuerst mit dem Pfarrer, dann mit dem Notar.“
Unruhige, hektische Wochen folgten. Nur als Ehepaar könne er ihnen so viel Geld leihen hatte doch der Mann von der Bank nachdrücklich gesagt und das Aufgebot war noch nicht bestellt.
Die Arbeit auf dem Hof und in den Büchern, die volle Verantwortung kostete Konzentration und Zeit. „Im Winter, in der stillen Zeit, wäre heiraten einfacher“, dachte Hans Geyer. Aber bald fand der Bürgermeister einen Weg, das Aufgebot zu beschleunigen. Es vergingen nur noch wenige Wochen bis zur Hochzeit.
Hans wollte an den Feierlichkeiten sparen, Maria dagegen sagte: „Aber Hans, mein Lieber, keine einfache Schnellhochzeit, wie Urlaubshochzeiten mitten im Krieg. Einige dieser Ehen haben, sicherlich aus unterschiedlichen Gründen, nicht lange gehalten. Manche leben noch zusammen, sind jedoch kein Ehepaar mehr, höchstens Essensgemeinschaften. Und noch ein anderer Aspekt, Hans, wir sind bald nicht mehr Magd und Knecht, das sollten wir ganz gewiss bei der Hochzeit zeigen.“
Hans Geyer versuchte zu reduzieren: „Maria, werd nicht aushausig. Es müsste auch reichen, wenn die Blasmusik als Zeichen nicht ihre schwarzen Handschuhe wie bei Beerdigungen, sondern weiße trägt.“
„Also Hans, ein bisschen feierlich möchte ich unsere Hochzeit schon gestalten. Es soll eine Hochzeitsfeier werden und kein Gedenktag.“
„Aber keine dreitägige Bauernhochzeit. Im Frühjahr brauchen wir Geld für die Saat.“
Sie einigten sich auf eine vergnügliche Hochzeit im Hirschen. Selbstverständlich mit Hochzeitseinladern, mit Blasmusik von der Kirche zur Brauereigaststätte, mit Spiel und Gesang den ganzen Nachmittag und Tanz bis weit in die Nacht hinein. Eben nur, für einen Tag.
Einlader, das waren zu dieser Zeit in jedem Dorf auf der Schwäbischen Alb zwei oder drei Männer mittleren Alters, selbst verheiratet, dass keine Missverständnisse aufkommen konnten, die in gesungener Gedichtform die einzelnen Familien einluden. Doch nach dem Krieg hatten die stark reduzierten Männer keine Zeit, vor allem keine Muse mehr für lustige, hintersinnige Einladereime und so ging diese Aufgabe automatisch, ohne dass es jemand wollte, an die zwei alten Weiber über, die sonst bei Beerdigungen als Klageweiber auftraten.
Die zwei Frauen in Schwarz durften alle Bauern, den Schmied, den Schreiner, die als fleißig bekannten Bediensteten und natürlich die Respektspersonen Bürgermeister, Pfarrer und Lehrer einladen. Danach liefen sie nach Buchenfelden und luden am Geburtsort von Maria alle ein, die den Namen Renzer trugen.
Plötzlich sprach Friederike das zukünftige Ehepaar an:
„Hör mal Hans, ich schlachte gerne ein Schwein fürs Hochzeitsessen und geb euch ein Dutzend Schöpfkellen Mehl und Eier für den Bäcker, damit er euch Brot und Kuchen backen kann. Das ist mein Hochzeitsgeschenk. Und dir, Maria, dir will ich gerne beim Herrichten helfen, zum Beispiel beim Anziehen und Frisieren.“
Friederike flocht mit flinken Fingern aus Marias normalen Zopf einen weich geschwungenen Bauernzopf und steckte ihr einen kleinen Kranz aus Immergrün ins braune Haar. Zum Trachtenkleid hatte Maria neue schwarze Schuhe mit einem kleinen Absatz gekauft.
„Mein Hans ist so groß“, sagte sie dem Schumacher, „da darf ich wenigstens zur Hochzeit drei Zentimeter zulegen.“
Den weißen Trachtenschurz mit Klöppelspitzen aus Plauen im Vogtland, musste sie zwei Nummern größer wählen und die Bändel daran selbst verlängern, die Zwillinge unter ihrem Herzen forderten erheblichen Raum.
Das Hirschenbräu platzte aus allen Nähten und die Blaskapelle lief zu Hochform auf. Endlich mal wieder lustige Lieder, dachte der Dirigent und schwang den Taktstock als wäre er gelernter Tänzer und nicht das ganze Jahr über Bauer.
Am Nachmittag kam der Auftritt von Friederike. Vorsichtig löste sie den Kranz aus Marias Haaren und setzte ihr die schwarze Trachtenhaube der Verheirateten auf. Die ringsum bestickte Haube lief spitz nach hinten zu und von dort aus schwangen sich breite, leicht gekräuselte Bänder bis zu den Kniekehlen herunter.
„Alles Gute, viel Glück, ein Hurra auf euch beide“, riefen alle im Saal.
Danach verband Friederike die Augen Marias mit einem dichten Tuch. Maria Geyer, nicht mehr Maria Renzer, musste nun, rückwärtsgewandt zu allen Ledigen aus der Hochzeitsgesellschaft, die sich im Halbrund aufgestellt hatten, ihren Kranz aus Immergrün werfen.
Die Blaskapelle spielte einen lauten Tusch und Maria sagte laut: „Unser aller Wunsch heute ist, dass du, der du vom Hochzeitskranze getroffen wirst, als nächster oder als nächste vor den Traualtar trittst. Dieser Hochzeitskranz wird euch, so Gott will, den wohlverdienten Segen bringen“.
Der immergrüne Kranz flog in hohem Bogen rückwärts über den Kopf Marias. Gespannte Ruhe, flinke Phantasien und mancher versteckte Wunsch begleiteten ihn. Zwei, maximal drei Sekunden verblieben den wartenden für heimlich schwebende Sehnsüchte.
Er traf, völlig unerwartet, den Schäfer, der kurzfristig in seinem Geburtsort Hattelfingen eingetroffen war und die Schafe auf die Heimatställe verteilt hatte. Er hatte sich unbemerkt unter die jungen Paare eingereiht.
„Gerade den trifft Maria“, tuschelten die zwei Einladerinnen, „der heiratet nie. Und eingeladen war der auch nicht richtig, eher nur für nach dem Abendessen. Der ist doch am liebsten mit seiner Herde und seinem Schäferkarren im Unterland unterwegs.“
„Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, der war als Kind schon völlig daneben…“, war die Antwort.
„Weiß auch nicht, Marie. Ich mag es kaum aussprechen, aber zum Glück können Tiere keine Samen von dummen Menschen empfangen...“