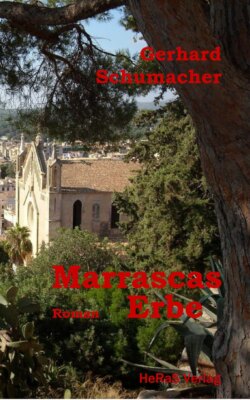Читать книгу Marrascas Erbe - Gerhard Schumacher - Страница 10
sechs / sis
ОглавлениеTrotz der Empörung über die Maßnahmen des bisbe in Palma war uns allen drei klar, daß wir in der Angelegenheit nur weiter kamen, wenn wir Sachverhalte entdeckten, die uns der Aufklärung verschiedener Ungereimtheiten näher brachten. In dieser Hinsicht hatten wir allerdings recht wenig Konkretes vorzuweisen, an dem wir angreifen konnten.
Mir selbst blieb die große Haushaltskladde, die ich zu bearbeiten schon begonnen hatte und ansonsten wartete ich auf die briefliche Antwort meiner Mutter, die frühestens in zwei bis drei Wochen eintreffen konnte. Die Arbeit an der Kladde war nun nicht gerade aufregend zu nennen und ich versprach mir nach den schon bearbeiteten Jahrgängen keine großen Erkenntnisse davon. Aber untätig herumsitzen und auf den Brief meiner Mutter warten wollte und konnte ich auch nicht. Also fügte ich mich in mein Schicksal und tröstete mich mit den abendlichen Zusammenkünften der beiden capellàs, die zunehmend einen rituellen Charakter anzunehmen schienen, was durchaus positiv gemeint und uns auch allen bewußt war.
Parallel zu meinen Nachforschungen im Haushaltsbuch der Marrascas wollten Don Remigio und Don Basilio in ihren jeweiligen Kirchenbüchern und den sonstigen Aufzeichnungen der Gemeinden nach Besonderheiten oder Auffälligkeiten, die in einem Zusammenhang mit den Marrascas oder meinem Erbe stehen konnten, recherchieren. Mehr konnten wir im Moment nicht tun, sagten wir uns. Auf jeden Fall fiel uns gegenwärtig nicht mehr ein, das traf die Situation weitaus besser, wie sich in der Folge herausstellen sollte.
Zeile um Zeile, Seite um Seite ging ich die Kladde durch, las von Mehl, Bohnen, Erbsen, Schweine-, Lamm- und Ziegenfleisch, das die Marrascas eingekauft hatten und das längst den Weg alles Irdischen genommen hatte, ebenso wie die Marrascas selbst, fügte ich sarkastisch in meinen Gedanken an. Es war ermüdend und nicht gerade aufbauend, so manche zusätzliche Flasche Wein aus dem Kellerverschlag half mir nur unzulänglich über die Eintönigkeit der Aufgabe hinweg.
Während der abendlichen Treffen in der Bar El Ultim tauschten wir die Erkenntnisse aus, zu denen wir tagsüber gekommen waren, doch allzuviel war es nicht, was des Tauschens wert gewesen wäre.
Weder Don Remigio noch sein Amtsbruder Don Basilio fanden verwertbare Hinweise auf unsere Sache und auch ich konnte nicht mehr zum Fortschritt der Aufklärung beitragen, als daß in dem einen Jahr einige Säcke Kartoffeln oder Reis mehr eingekauft worden waren als in dem Jahr zuvor oder dem danach. Nichts Auffälliges, nichts, das die Normalität des Einerleis durchbrochen, nichts, das mehr als einen müden Augenaufschlag verdient hätte.
Durch Vermittlung Pablos, dessen Onkel beim ayuntament arbeitete, konnten wir sogar die amtlichen Akten einsehen. Aber auch hier fanden sich keinerlei in unserem Sinne verwertbare Hinweise oder Spuren.
Es war wirklich zum Verzweifeln.
Und dennoch ermunterte mich das Schreiben Don Xaviers geradezu, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen und lockte mit mehr oder weniger versteckten Hinweisen, die angeblich im Laufe der Zeit zu entdecken waren und mir Richtschnur und Anleitung zum Handeln sein sollten.
Abends haderten wir mit uns selbst. Was hatten wir übersehen? Es mußte irgend etwas geben, ein winziges Detail vielleicht, das offen vor unseren Augen lag, nur, daß wir mit der sprichwörtlichen Blindheit geschlagen waren und es nicht sahen. Dieser Vorwurf traf in erster Linie mich selbst und keinen anderen.
Zwar sprach es niemand von uns aus, aber der Gedanke schwebte, unsichtbar gewiß und dennoch zum Greifen nahe, über unseren Treffen: wir waren eindeutig überfordert. Es gab nur zwei Möglichkeiten, die ernsthaft in Betracht zu ziehen waren. Entweder wir bastelten uns eine völlig aus der Luft gegriffene Verschwörungstheorie zusammen, die jeglicher Grundlage entbehrte und nur in unseren Köpfen herumspukte. Wenn dem so war, handelte es sich bei der Botschaft Don Xaviers, den Fotografien mit meinem Großvater und überhaupt meinem ganzen Erbe um eine Anhäufung von Zufällen, die zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich war. Es soll in der Geschichte schon ganz andere Geschicke gegeben haben, die das Gefüge der Welt gehörig durcheinander brachten. Gegen diese Annahme allerdings sprach das unverhohlen gezeigte Interesse des Episkopats und die offen ausgesprochene Drohung an die Adresse Don Remigios.
Oder aber Don Xavier und wer sonst noch dahinter stecken mochte, hatten die Angelegenheit mit einer Schläue und Raffinesse eingefädelt, der wir uns, zumindest bisher, nicht gewachsen zeigten. Träfe diese Annahme zu, gäbe es wiederum zwei Möglichkeiten: entweder wir dachten zu einfach, oder wir dachten zu kompliziert.
Bis zu diesem Punkt der Einschätzung waren wir drei uns einig. Während allerdings die beiden frare davon ausgingen, wir hätten es uns zu einfach gemacht, neigte ich eher zu der gegenteiligen Ansicht.
Übereinstimmend beurteilten wir hingegen unsere Herangehensweise. Bisher hatten wir nach Dingen gesucht, von denen wir ausgingen, sie seien vorhanden und wir müßten sie lediglich erkennen. Das war insofern schwierig, da wir keinerlei Vorstellungen davon hatten, nach was wir eigentlich suchten.
Als Konsequenz daraus mußten wir unsere Nachforschungen auf die Dinge konzentrieren, von denen wir eine Vorstellung hatten, die aber nicht da waren, so daß wir sie auch gar nicht erkennen konnten. Die Frage war also: was fehlte?
Da war zunächst einmal das Fehlen jeglichen Hinweises, und sei er noch so unscheinbar, auf die finanziellen Einnahmen Don Xaviers, von denen er seine umfangreichen Ausgaben bestritt. Wo kam das Geld her, mit denen die Marrascas ihren Lebensunterhalt bezahlten, mit dem sie ihre Reisen finanzierten, auf denen sie, wie entsprechende Einträge in der Kladde bewiesen, zwar nicht in Saus und Braus aber doch in angemessenem Komfort recht ordentlich lebten.
Wir waren uns im Klaren, daß wir der Lösung des Geheimnisses um ein gutes Stück näher gekommen waren, sollte es uns gelingen, diesen Punkt zu enträtseln. Es war geradezu unwahrscheinlich, daß nicht irgendwo ein Fingerzeig, eine Andeutung aufzufinden war, die vielleicht der Anfang einer Spur sein könnte. Niemand war so perfekt, einen nicht unwesentlichen Teil seines Lebens hermetisch vor der Umwelt abzuschirmen und geheim zu halten, ohne daß ihm nicht an irgendeiner Stelle ein kleiner Fehler, ein Versehen oder einfach nur das Übersehen eines Schnipselchens unterlief. Auch nicht Xavier Marrasca, so sorgfältig, genau und gerissen er immer gewesen sein mag. Da war ich mir sicher.
Es war durchaus möglich, daß der Ursprung des Vermögens in der Vergangenheit Don Xaviers, eventuell sogar in seinem Heimatort, zu finden war. Dann mußten wir seinen Weg vom ersten Auftauchen in Artà zurück in die Berge der Serra de Tramuntana verfolgen und sehen, ob wir dort fündig wurden. Dabei war es eher unwahrscheinlich einen lebenden Menschen aufzutreiben, der Don Xavier noch persönlich gekannt haben und sich klaren Kopfes auch daran erinnern konnte. Aber vielleicht gab es andere Anhaltspunkte.
Wir saßen zusammen auf meiner Dachterrasse, die beiden capellas und ich, schauten in die Strahlen der untergehenden Abendsonne, die sich in unseren Gläsern brach und den Wein zum Funkeln verleitete. Einen Moment lang sprach keiner von uns, ein jeder hing seinen Gedanken nach, die sich indes alle um dasselbe Thema wanden. Wer war Xavier Marrasca, womit hat er sein Geld verdient?
Don Basilio machte sich auf den Weg nach unten, weil ein gewisses Bedürfnis ihn zwang, das lavabo aufzusuchen. Als er nach einer Weile wieder auf der Terrasse erschien, wirkte er noch etwas nachdenklicher als vordem.
„Die Bücher“, sagte er dann zu uns, „die Bücher“, wiederholte er und hielt mitten im Satz inne.
„Basilio sprich nicht in Rätseln, ich bitte dich. Was ist mit den Büchern?“, antwortete Don Remigio und sah ihn fragend an.
„Na, um ins lavabo zu kommen, muß ich durch die Bibliothek. Zweimal, um genau zu sein. Einmal auf dem Hinweg und einmal beim Zurückkommen. Und bei Letzterem fiel mir auf, daß Don Xavier jede noch so kleine Ausgabe in dieser vermaledeiten Kladde da verzeichnet hat. Auf all den vielen Seiten aber findet sich keine einzige Eintragung über den Kauf eines Buches. Nicht eine, Don Diego hat alles gewissenhaft durchforscht, Zeile für Zeile, Blatt um Blatt. Das ist doch merkwürdig. Da unten in der Bibliothek stehen schätzungsweise 2000 Bücher, alte und neue, und für keins davon kann ein Kaufnachweis geführt werden. Sicher, vielleicht hat sein Schwiegervater schon ein paar Bücher sein eigen genannt, aber viele können es nicht gewesen sein, denn der alte Campillo war zwar nicht auf den Kopf gefallen, seine Interessen orientierten sich indes mehr an den praktischen Seiten des Lebens. In, nun ich will mal sagen, jeder Hinsicht. Statt in einem Buch zu blättern, entblätterte er lieber die weichen Begehrlichkeiten der einen oder anderen Senyoreta. Er wußte, was ihm wichtiger war.
Da man Bücher nicht irgendwo im Straßengraben findet, muß er sie doch irgendwo gekauft haben, der gute Senyor Marrasca. Da es hier in Artà keinen Buchladen gibt, hat er sie sich vermutlich aus Palma kommen lassen. Barcelona käme auch noch infrage. Wenn die Büchersendungen mit der Post gekommen sind, ist das nachprüfbar, ich werde gleich Morgen ins oficina de correus gehen und schauen, was ich darüber herausbekomme. Von seinen Reisen wird Don Xavier nur wenige Bücher mitgebracht haben können, alles andere wäre zu umständlich gewesen.
In jedem Fall hat das alles viel Geld gekostet. Warum sind die Bücher und deren Transport nicht unter den Ausgaben aufgeführt? Er, der jede einzelne Bohne verzeichnet hat, jedes Reiskorn, jede Kartoffel, vergißt vergleichsweise hohe Posten aufzuschreiben? Das glaubt ihr ja wohl selbst nicht, oder?“
Nach dieser langen Rede, die er, noch in der Tür stehend, an uns richtete, setzte sich Don Basilio endlich wieder an den Tisch und blickte uns herausfordernd an. Es machte ganz den Eindruck, als sei er nicht wenig stolz auf seine Entdeckung und den Gedankengang, der ihn dahin geführt hatte.
„Caram!“, antwortete Don Remigio, „darauf hätte ich selbst kommen müssen, du hast recht, die Bücher. Daran hat keiner von uns gedacht. Aber was nützt uns dieses Wissen?“
„Wir sollten die Bibliothek einmal genauer unter die Lupe nehmen“, mischte ich mich jetzt auch in das Gespräch ein, „ich habe sie bisher nur oberflächlich betrachtet, hier und da mal ein Buch genommen, ein wenig geblättert, mehr nicht. Aber Don Basilio hat natürlich recht, es ist schon merkwürdig, daß nirgendwo der Kauf eines Buches vermerkt ist. Vielleicht finden wir in den Büchern irgendeinen Hinweis, der uns weiterbringt. Es könnten auch Botschaften oder Nachrichten zwischen den Seiten auf ihre Entdeckung warten.“
„Vorsicht“, warnte mich Don Basilio, „zuviel Optimismus scheint mir nicht angebracht. Ich habe lediglich von einer Möglichkeit gesprochen, inwieweit sie in unserem Sinne wirklich etwas bringt, gilt es abzuwarten. Versprechen Sie sich nicht allzu viel davon, Don Diego, denken Sie an die Haushaltskladde, die hat auch nichts gebracht.“
„No Senyor“, fuchtelte Don Remigio dazwischen, „das ist nicht richtig. Die Kladde hat dich immerhin auf die Idee mit den Büchern gebracht, denn weil in ihr nichts über deren Kauf verzeichnet ist, bist du erst darauf gekommen. Alles, was recht ist.“
Dennoch wäre ich am liebsten sofort in die Bibliothek hinabgestiegen und hätte mit der Suche begonnen. Aber meine beiden Mitstreiter winkten ab. Inzwischen war die Sonne untergegangen und sie hatten rechtschaffen Hunger. Morgen sei bekanntlich auch noch ein Tag und überdies hätte Bienvenida für heute Abend pollastre in Knoblauchsoße angekündigt und das wollten sie nicht versäumen, was ich nach kurzer Überlegung durchaus nachvollziehen konnte.
Also verschoben wir den Bibliotheksbesuch und begaben uns hungrig in die Bar El Ultim, in der Consuela längst unseren Tisch eingedeckt hatte.
So ausgezeichnet das Essen war, so wohlschmeckend der Wein und so anregend die Gesellschaft der beiden Freunde, ich konnte es kaum erwarten, die Bibliothek in Augenschein zu nehmen und zappelte innerlich vor mich hin wie ein aufgeregtes Kind kurz vor der Bescherung am Weihnachtsabend.
Die beiden pares aber ließen sich Zeit mit ihren Betrachtungen von der Welt, kabbelten sich freundschaftlich um Nebensächlichkeiten und schienen ein Amüsement daran zu haben, den Abend ohne anderen Grund als den, sich gegenseitig ins Bockshorn zu jagen, mehr und mehr in die Länge zu ziehen. Das Geplänkel der beiden, obwohl nicht ohne Humor und Augenzwinkern vorgetragen, begann mich zu langweilen, denn meine Sinne drängten immer intensiver nach einer Begutachtung der Bibliothek. Alles, was mich davon abhielt, sah ich in diesem Moment als vergeudete Zeit an und überlegte krampfhaft, wie ich den Heimweg antreten konnte, ohne meine beiden Gefährten zu kränken.
Während ich noch darüber nachdachte, mich schnell aus der zechenden Runde zurückziehen zu können, kam mir der Chauffeur Álvaro unverhofft aber höchst willkommen zur Hilfe. Er hatte sich im Laufe des Nachmittags vor der Küchentür zu seiner Angebeteten wieder einmal in eine Art Liebesrausch getrunken, der ihm die kühnsten Schwüre, und die wüstesten Drohungen, vermeintliche Nebenbuhler Bienvenidas betreffend, über die Lippen kommen ließ. Das wäre nun schon seit Wochen nichts Bemerkenswertes, wandte sich Consuela an mich, wenn nicht die Lautstärke von Schwüren und Drohungen heute Abend ein Maß übersteigen würde, das sie, und vor allen Dingen el cap, sie zeigte auf ihren Mann Pablo, nicht mehr akzeptieren könnten. Die anderen Gäste fühlten sich durch das abwechselnde Geschrei und Gejammer des verrückten xofer belästigt. Sie bat mich doch inständig, ihn zur Räson zu bringen, sonst würde ihr Mann ihn vor die Tür setzen und das ginge erfahrungsgemäß nicht ohne größere Blessuren, Kopfschmerzen und sonstige Unannehmlichkeiten für den Hinausgeworfenen vonstatten.
Ungeachtet der Tatsache, daß außer uns dreien kein anderer Gast in der Bar El Ultim anwesend war, der sich hätte belästigt fühlen können, ergriff ich natürlich sofort den mir gereichten Strohhalm zum Ausstieg aus der Abendrunde, hakte den trunkenen Álvaro unter und verabschiedete mich Richtung Heimstatt, was Don Remigio und Don Basilio zwar mit Murren aber ohne eine Möglichkeit des Eingreifens billigen mußten.
Froh über die unerwartete Unterstützung zerrte ich Álvaro ohne Zögern ins Freie, stolperte mit ihm recht unansehnlich schwankend die Straße hinunter und ließ ihn irgendwann, ich weiß heute nicht mehr genau, wie ich es geschafft hatte, denn der Chauffeur war gut anderthalbe Köpfe größer als ich selbst, in sein Bett fallen, wo er sich nach anfänglichem Sträuben schließlich heiser schnarchend erst in die Kissen und dann in sein Schicksal fügte.
Ich verschloß die Haus- und auch die Gartentür, legte die Riegel vor, entnahm dem Kellerverschlag einen Gran Reserva der Tempranillo-Traube, etwas Besonderes mußte es schon sein zu dieser besonderen Stunde, löschte die Lichter und begab mich schließlich in die dritte Etage des Häuschens, in der die Bibliothek untergekommen war.
Vom Stockwerk darunter klang das heisere Schnarchen Álvaros in allerlei Variationen herauf. Nie zuvor hatte ich bemerkt, wie nuancenreich das Schnarchen sein kann, es deckte, wenn auch in einer ungewöhnlichen Skala, alles ab, was der musikalische Laie sich an Tönen so vorzustellen vermag. Aus wohltuender Erfahrung wußte ich, daß der Chauffeur nach ungefähr 20 Minuten das Schnarchen einstellte und in einen geräuschlosen Schlaf verfiel, aus dem nur ab und zu ein unterdrückter Schrei oder ein unverständlich gestammeltes Wort von seinen Träumen Auskunft gab.
Ich verzichtete darauf, das elektrische Licht anzumachen, entzündete nur einige Kerzen, die ihr warmes Licht über die Regale mit den Büchern flackerten, schob den Ledersessel in die Mitte des Raumes und setzte mich hinein.
Mit der Erwähnung der Bibliothek am frühen Abend hatte Don Basilio ihr in meinem Bewußtsein plötzlich einen völlig anderen Stellenwert zugewiesen, als das zuvor der Fall gewesen war. Bisher hatte ich sie unachtsam durchquert, wenn ich zur Dachterrasse wollte oder umgekehrt. Sicher, ab und zu habe ich den Regalen ein Buch entnommen, kurz darin geblättert und es dann wieder an seinen Platz zurückgestellt. Der erste intensivere Kontakt fand mit der Entdeckung des Unterschranks und den zwei Schubladen, die sowohl die Kladde als auch die Fotografien beherbergten, statt. Seit der Bemerkung des pare hingegen, den Kauf der Bücher betreffend, ging mir die Bibliothek nicht mehr aus dem Kopf und so war ich froh, endlich die störende Umwelt hinter mir gelassen zu haben (Don Remigio und Don Basilio mögen mir die harschen Worte verzeihen, sie wissen, wie angenehm ich ihre Gesellschaft empfinde und auch, daß ich es keinesfalls persönlich meine), und ganz alleine in dem bisher von mir noch unentdecktem Reich sein zu können. Selbst Álvaro hatte ein Einsehen und das Schnarchen erwartungsgemäß inzwischen eingestellt. Es herrschte, wenn auch nicht absolute, so doch immerhin ausreichende Stille, die Eigenheit des Ortes zu spüren. Ich will das nun nicht verallgemeinern, aber in diesem Moment vermeinte zumindest ich, sie zu spüren. Eine andere Person war ja auch nicht da, die mir mein Gefühl hätte bestätigen können.
Andächtig also saß ich inmitten der Bibliothek und blickte um mich herum. Der Raum war rechteckig und seine Wände vom Boden bis zur Decke mit Regalen verstellt. Diese wiederum steckten dicht an dicht voller Bücher. Die keinen Platz mehr stehend in den Fachböden gefunden hatten, lagen quer auf ihresgleichen oder aber schräg übereinander. Die Türe zum Rest des Hauses, Ein- und Auslaß gewährend, war, auch oberhalb des Sturzes, eingerahmt von den vollgestellten Regalen und wirkte aus meiner Sicht im ledernen Sessel mehr wie ein störender Fremdkörper, der das symmetrische Gefüge, die stille Erhabenheit des auf Papier gedruckten und dann in edle Tierhaut gebundenen Wortes, störte. Selbst die beiden Fenster zur Straße waren mit Büchern zugestellt, was mir, ich gestehe es beschämt, bisher überhaupt noch nicht aufgefallen war.
Keine Ahnung, wie lange ich so dagesessen bin, eine Stunde, vielleicht auch zwei oder aber auch nur eine halbe. Das Gefühl für Zeit hatte mich verlassen und war einem mir bis dahin unbekannten Zustand der Schwerelosigkeit, sowohl des Geistes als auch des Körpers, gewichen. Ich ließ nur die vielen hundert Buchrücken drum herum, stehend, liegend, zur Seite gekippt, nicht im Einzelnen, sondern in ihrer geballten Masse aus den Regalen auf mich einwirken. Als ich aus meiner Trance erwachte, war gut die Hälfte des Weins getrunken, obwohl ich mich weder dessen noch daran nicht erinnern konnte, überhaupt das Glas gefüllt zu haben.
Dann aber war der Rausch, ebenso unerwartet wie er mich überfallen hatte, auch wieder verschwunden und übrig blieb die Wärme des Kerzenlichts, sein flackernder Tanz über die Bünde der Buchrücken und die Schatten, die sich an der Decke wanden. Ich stand aus meinem Sessel auf und schritt langsam die Buchgestelle ab, suchte ein System, eine Ordnung oder einfach nur ein Prinzip zu erkennen, nach dem die gebundenen Schriften sortiert sein konnten.
Die oberen Regalfächer waren in erster Linie mit einer erstaunlichen Anzahl Lexika, kunsthistorischen Bänden und sonstigen Nachschlagwerken über die Erde, die Kontinente und Länder sowie deren Fauna und Flora gefüllt.
Eine ganze Regalseite rechts neben der Tür war vollständig meist großformatigen Werken der Ägyptologie vorbehalten. Selbst ein Handwörterbuch fand sich an, in dem der Versuch unternommen wurde, ägyptische Hieroglyphen in kastilisches Spanisch zu transkribieren. Ich nahm mir vor, mich mit diesem exotisch anmutenden Buch in nächster Zeit einmal intensiver zu beschäftigen. Es interessierte mich ob seiner Fremdartigkeit.
Ein weiteres Regal war ausschließlich mit Reisebeschreibungen und den Schilderungen von Expeditionen in ferne Länder bestückt.
Dann stieß ich auf eine erste Merkwürdigkeit, die mich in nicht geringes Erstaunen versetzte. Es handelte sich um drei großformatige dicke Lederbände ohne Rückenschilder oder sonstige Titelprägung, die mit jeweils einer metallenen Buchschließe verschlagen waren. Auch die Ecken waren mit einem ziselierten Metallschutz verziert. Die Bände riefen einen ehrfurchtsvollen Eindruck bei mir hervor, so wie es, trotz meiner freigeistigen Einstellung, zum Beispiel eine alte Familienbibel täte. Als ich die Schließen aufschlug, war ich deshalb um so erstaunter, drei vollständig gebundene Jahrgänge der deutschen Zeitschrift Die Gartenlaube vorzufinden. Es handelte sich um die Jahrgänge 1875 bis 1877 und so weit ich es auf den ersten Blick beurteilen konnte, befanden sie sich in allerbestem Zustand. Derartiges hatte ich nun nicht erwartet. Sofort kam mir die Frage in den Sinn, ob Senyor Marrasca vielleicht sogar der deutschen Sprache mächtig war, obwohl weder Don Remigio noch sein Kollege Don Basilio etwas dergleichen angedeutet hatten.
Andererseits aber konnten die Folianten durch tausendundeinen Grund in die Bibliothek verschlagen worden sein, es ließ sich durch ihre Existenz hier kaum zwingend auf das fremdsprachliche Vermögen des Raben schließen.
Davon abgesehen war ich zunächst einmal erfreut, einige Bücher in der Sprache meiner Heimat zu entdecken und blätterte sogleich in den einzelnen Ausgaben des ersten Bandes hin und her, bis ich in Heft 40 aus dem Jahr 1875 auf folgende Notiz stieß:
Noch einmal „Ein Verbrecher unter den Fischen“.
Seitdem mein Artikel über den chinesischen Großflosser (Macropodias) in der Gartenlaube erschienen ist, haben sowohl die Redaktion dieses Blattes wie auch ich zahlreiche Aufragen aus Deutschland erhalten, wie man sich den Fisch für Aquarien verschaffen könne? Diesen geehrten Herren Korrespondenten diene zur gemeinsamen Antwort, daß sie sich an Monsieur Carbonnier, Pisciculteur, 20 Quai du Louvre in Paris, wenden mögen. Der Fisch verträgt, meines Erachtens, die Versendung nach den entferntesten Gegenden, da er selbst in schlechtem, stinkendem Wasser ganz vergnüglich lebt. Da ich Herrn Carbonnier im Anfange October in Paris zu sehen gedenke, so wird es mir ein Vergnügen sein, ihn auf die Bestellungen aus Deutschland aufmerksam zu machen und die nöthigen Vorsichtsmaßregeln mit ihm zu besprechen.
Roscoff (Departement du Finistère), den 15. Sept. 1875.
Carl Vogt.
Die kleine Notiz war mir aus zwei Gründen aufgefallen. Zum einen hatte die Bindung einen Bruch, wie er entsteht, wenn die Seiten an ein und derselben Stelle häufig aufgeschlagen und auseinandergedrückt werden, so daß sie sich beim flüchtigen Durchblättern quasi von selbst an dieser Passage öffnen. Zum anderen fiel mir die Notiz sofort ins Auge, weil jemand mit einem rotfarbenen Stift rechts und links von ihr mehrere dicke Striche auf das Papier gezogen hatte.
Weder in diesem noch in den anderen beiden Bänden fand ich trotz mehrfacher Durchsicht eine ähnliche Markierung eines Textes. Im Gegenteil, die übrigen Ausgaben der Gartenlaube machten einen ungelesenen, fast druckfrischen Eindruck auf mich. Lediglich die oberen Ränder waren, wahrscheinlich durch entsprechenden Lichteinfall, mäßig angegilbt.
Aus dem Text selbst wurde ich nun rein gar nicht schlau, demzufolge konnte ich mir nicht den geringsten Grund vorstellen, warum wer auch immer, ihn durch die auffälligen Anstreichungen mit rotem Stift hervorgehoben hatte.
Der Fund, mußte ich noch im Augenblick seiner Entdeckung mir eingestehen, sorgte eher für zusätzliche Verwirrung, als er zur Klärung der ohnehin schon verzwickten Lage beigetragen hätte. Ich hielt es für sehr unwahrscheinlich, daß Don Xavier den Umgang mit Zierfischen und deren Aufzucht und Pflege in Aquarien zu seiner bevorzugten Freizeitbeschäftigung zählte. In seinem Haus, das ich jetzt bewohnte, fanden sich jedenfalls keinerlei Hinweise darauf. Außerdem wäre ein solches Steckenpferd in dem Umfeld eines kleinen Ortes wie Artà nicht unbemerkt, und vor allen Dingen, durch die Öffentlichkeit nicht unkommentiert geblieben, so daß Don Basilio mit Sicherheit davon berichtet hätte.
Aber es war ja auch nicht klar, ob der Rabe die Hervorhebung der Notiz vorgenommen hatte oder irgendein Unbekannter. Es war ja nicht einmal klar, ob er sie überhaupt lesen konnte, die Wahrscheinlichkeit sprach eher dagegen. Was aber suchten dann drei Jahrgänge einer deutschen Zeitung in seiner Bibliothek und wie sind sie dahin gekommen?
Artà war ein kleines Städtchen auf Mallorca, einer Insel im Mittelmeer und selbst auf dieser eigentlich recht abseits gelegen. In Palma oder vielleicht noch in Manacor konnte ich mir das Auftauchen derartiger bibliophiler Exoten angelegentlich einer besonderen Fügung gerade so vorstellen, aber daß sich ein solcher Zufall ausgerechnet nach Artà verflogen haben sollte, kam mir dann doch zu unwahrscheinlich vor.
Was aber hatte Senyor Marrasca mit einem Fischzüchter in der französischen Hauptstadt zu tun? Oder wenn nicht mit diesem, dann mit dem Verfasser der Zeilen, einem gewissen Carl Vogt? Ich nahm mir vor, über beide Erkundigungen einzuholen, vielleicht gab es ja Berührungspunkte mit dem Raben.
Die Kerzen waren in der Zwischenzeit fast runtergebrannt, der Wein geleert. Allmählich forderte auch die Müdigkeit ihren Tribut. Ein Blick auf die Uhr bestätigte ihr Drängen, es war früher Morgen, die Vögel lärmten bereits durch das Geäst. Irgendwo krähte ein Hahn, ein zweiter antwortete ihm lautstark. Die Räder eines Karrens rumpelten auf dem Pflaster der Carrer Major, ein Wasserstrahl säuberte die Kopfsteine des schmalen Gehsteigs vom Dreck, den die Nacht hinterlassen hatte. Es waren dies alles Geräusche, die ich bei meinem normalen Tagesablauf nicht zur Kenntnis nehmen konnte, weil ich um diese frühe Stunde gewöhnlich noch schlief.
Schließlich legte ich die Folianten zurück in das Buchregal, löschte die Kerzen und stieg hinauf zur Dachterrasse. Ein leichter Wind wehte von Canyamel herüber. Der Tag begann verheißungsvoll, viel zu schade, um ihn im Bett zu verschlafen. Allerdings, ohne einige Stunden Schlaf, das war mir klar, würde ich ihn nicht durchstehen können. Eine Alternative zum Bett fand sich in der Hängematte, als Kompromiß sozusagen und dankbar, wenigstens zu diesem Problem eine Lösung gefunden zu haben, ließ ich mich so wie ich war hineinfallen.
Der letzte Gedanke, den ich in meinem Gedächtnis speicherte, bevor ich einschlief, war die Feststellung, daß die ganze Angelegenheit immer komplizierter und undurchsichtiger wurde, je tiefer ich in sie eindrang. Mit dem Gefühl, mich mehr von der Klärung zu entfernen, als mich ihr zu nähern, versank ich in gnädigem Dunkel.