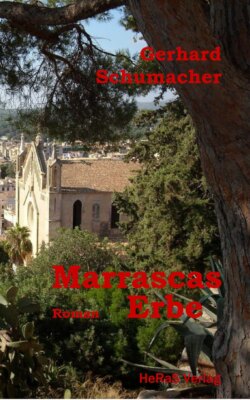Читать книгу Marrascas Erbe - Gerhard Schumacher - Страница 6
zwei / dues
ОглавлениеNachdem ich das Schreiben des Senyor Marrasca ein zweites und schließlich ein drittes Mal gelesen hatte, war die Kerze heruntergebrannt. Mit einem kaum hörbaren Zischen ging das Licht am Docht aus, dessen Ende nur noch wenig glimmte bis es ebenso erlosch.
Im Halbdunkel saß ich da, hatte die Augen geschlossen und versuchte, das soeben mehrmals Gelesene zu verarbeiten, zu deuten, zu verstehen. Wenn ich alle Mutmaßungen und Spekulationen einmal außer Acht ließ, blieben eigentlich nur drei Gegebenheiten übrig, die auf mich als Adressaten des Schreibens hinwiesen.
Zum einen war da die Anrede mit meinem Vornamen Diego. Auch wenn es sich um die spanische Variante handelte, Jakob bleibt Jakob, egal in welcher Sprache. Andererseits war Diego ein sehr geläufiger Namen und die Übereinstimmung konnte durchaus Zufall sein.
Schwerer wog schon Don Xaviers Hinweis auf meine deutsche Herkunft. Aber sicherlich war ich nicht der einzige Deutsche, der Jakob hieß und jemals in Artà gewesen war. Obwohl ich an diesem Punkt schon nicht mehr so recht überzeugt von meiner eigenen Argumentation war.
Der dritte Punkt betraf den Hinweis auf die Vermietung des Zimmers an mich. Das Zimmer hatte mir Dona Maria vor sieben Jahren vermietet. Da war ihr Mann schon 25 Jahre tot. Den Brief konnte er logischerweise nur vor seinem Tod geschrieben haben. Wie aber sollte er damals schon von der Vermietung des Zimmers gewußt haben?
Zwar konnte es sich auch hier um eine Zufälligkeit, um verschlungene Fügungen handeln, aber wenn ich alle drei Hinweise zusammen betrachtete, war es mir doch zu gewagt, sie als Zufall zu deuten.
Ich konnte die Angelegenheit drehen und wenden wie ich wollte, es blieb dabei, ich selbst war derjenige, den Senyor Marrasca angeschrieben, dem Senyora Marrasca das Zimmer Ihres espos vermietet hatte, dem beide ihr Haus und eine als „ausreichend bemessen“ deklarierte Summe Geldes hinterlassen hatten. Über die Identität des von den beiden Gemeinten gab es nicht den geringsten Zweifel. Ich war gemeint, kein anderer.
Diese Erkenntnis, die als eine unumstößliche anzunehmen ich mich gezwungen sah, löste bei mir Unsicherheit und Zweifel aus. Statt mich meines Erbes zu erfreuen, stürzte ich von einem auf den anderen Moment in Verzweiflung und Depression. In einer ersten Reaktion wollte ich meine wenigen Sachen, die ich aus Deutschland mitgebracht hatte, für die sofortige Abreise packen. Der Chauffeur mußte noch in der Stadt sein, ich hatte sein Automobil auf der Placa d’ Espanya gesehen, er konnte mich ohne Verzögerung zurück nach Palma bringen, wo es sicher nicht schwierig war, eine Passage nach Barcelona zu buchen. Ich riß den Koffer aus dem Schrank und warf wahllos Hemden, Hosen und Unterzeug hinein. Nach Minuten hektischer Aktivität hielt ich dann doch inne. Mir wurde klar, daß ich vor den Gegebenheiten nicht davonlaufen konnte. Ob ich nun hier in Artà war oder im fernen Berlin, änderte nichts an den Tatsachen und der, zugegeben, unheimlichen Gewißheit, die ich nach der Lektüre von Don Xaviers Schreiben erlangte. Zurück nach Berlin zu gehen wäre nichts anderes als eine Flucht vor diesen Tatsachen, sie würden mich dorthin verfolgen und letztendlich auch einholen. Ein normales, unbeschwertes Leben war dann nicht mehr möglich.
Der einzige Weg, der mir blieb, war, mich der Herausforderung zu stellen und durch ihre Bewältigung der ganzen rätselhaften Angelegenheit auf den Grund zu gehen, vielleicht sogar eine Lösung zu finden.
Als ich mir darüber klar war, fiel die Schwere von mir ab, die mich bedrückt hatte, ich schöpfte wieder Hoffnung und Zuversicht. Mit Don Remigio hatte ich einen Verbündeten, der mir überdies von Senyor Marrasca selbst vorgeschlagen worden war. Wenn ich nicht mehr weiter wußte, würde er mir helfen.
Es war klar, mein Platz war nicht auf der Flucht im fernen Berlin, sondern hier offensiv vor Ort in Artà.
Wie sich noch am Abend herausstellte, wäre eine sofortige Abreise sowieso nicht möglich gewesen. Zwar war das Automobil samt seines fahrkundigen Lenkers noch in der Stadt, allerdings machte dieser zum Zeitpunkt meiner Erwägungen in der Bar El Ultim sehr zum Mißfallen des Wirtes Pablo, dessen Schwester eher mehr denn weniger aufdringlich den Hof und befand sich in einem derart trunkenen Zustand, der ihn zum Fahren nicht mehr befähigte. Eben die Schwester Pablos übrigens war der Grund seines mehrwöchigen Aufenthalts in Artà, der arme Mann hatte sich hoffnungslos verliebt und kämpfte mit allerlei Mitteln um sein Lebensglück.
Mir aber war diese Gegebenheit Bestätigung genug, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben, zeigte er doch, daß sich das Schicksal doppelt abgesichert hatte. Don Remigio, dem ich am späten Abend noch davon berichtete, beurteilte den Begleitumstand ähnlich, nur nannte er Fügung, was ich Schicksal titulierte.
Abends, etwa zur neunten Stunde, betrat ich die Bar El Ultimo. Der pare saß bereits an seinem angestammten Platz, vor sich eine Schale mit Oliven und eine Karaffe Rotwein. Er wartete offenbar ungeduldig auf mein Erscheinen und machte einen angespannten Eindruck. Als ich mich ihm gegenüber an den Tisch setzte, schaute er mich fragenden Blickes an. Natürlich ahnte ich, daß er meine Entscheidung erwartete, aus Gründen der Höflichkeit aber nicht gleich danach fragen wollte. Ich spannte ihn nicht lange auf die Folter und sagte nur:
„Sein Sie unbesorgt, ich bleibe.“
Don Remigio nickte und ich vermeinte, unter seinem dichten Bartwuchs ein Lächeln zu erkennen.
Diesen Abend verbrachten wir im Wissen um die momentan nicht zu klärende Wirrnis, die uns miteinander verband. Wir sparten das Thema aus, verloren uns in Beiläufigkeiten, tauschten höfliche Floskeln und genossen in erster Linie das Essen, das uns Consuela auftischte und mit diesem natürlich den roten Wein.
Álvaro, der Fahrer, der mich in seinem Automobil hergebracht hatte, saß an einem der kleinen Tische und ersäufte seine Liebeskrankheit mittels einiger botellas Wein. Zwar war es keineswegs ausgemacht, daß Bienvenida, die Schwester des Wirts, seiner Werbung ablehnend gegenüberstand, einige Anzeichen deuteten eher auf das Gegenteil hin. Nur war sie so geschickt oder raffiniert, wie man es auch immer deuten wollte, den guten Álvaro über ihre eigenen Absichten im Unklaren zu halten. Einerseits machte sie ihm Hoffnungen, dann wieder wies sie ihn mit einer schroffen Bemerkung in die Schranken. Dieses Verhalten wiederum brachte ihren Bruder Pablo auf die Palme, denn der war sehr harmoniebedürftig und wünschte sich nichts mehr als klare Verhältnisse. Er hatte nichts gegen den Chauffeur, indes wollte er lediglich wissen, woran er war. Sobald er dies als geklärt ansehen konnte, würde er sich auf die Situation einstellen und mit ihr umgehen können. Auf den Nenner gebracht wollte Pablo nichts anderes als klare Verhältnisse. Und dies ohne große Verzögerungen und launenbedingtem Hin und Her.
In diesem Punkt ging es ihm nicht anders als Don Remigio und mir, wenn auch die Gründe andere waren.
Als er seine Sinne noch einigermaßen beisammen hatte, fragte mich Álvaro, ob er gegen entsprechendes Entgelt meine Gastfreundschaft auf absehbare Zeit noch weiter in Anspruch nehmen dürfte, bis er seine Angelegenheiten einem Abschluß entgegengeführt hätte. Lachend sagte ich sofort zu, eigentlich froh darüber, in meinem neuen Domizil, zumindest in der Anfangszeit, nicht alleine wohnen zu müssen. Auf einen Mietzins verzichtete ich. Über soviel Großzügigkeit kamen dem Chauffeur die Tränen und er versprach mir, mich mit seinem Automobil überall dorthin zu transportieren, wohin die Notwendigkeit es verlangte oder mein Wunsch mich hinbestellen würden. Ich solle es ihm bei Bedarf nur mitteilen, er halte sich jederzeit bereit. Dann wandte er sich wieder seinem Weinglas zu, denn Bienvenida hatte in der Küche zu tun, zu der ihm Pablo den Zutritt mit Nachdruck untersagt hatte.
Während der Chauffeur weiterhin seine Hormone betäubte, verabschiedete ich mich von Don Remigio und dieser von mir in die Nachtruhe.
Am Vormittag des nächsten Tags trafen wir uns in der Kanzlei Don Jaramagos, dem advocat der Stadt, bei dem Dona Maria ihre letzten Verfügungen hinterlegt hatte. Der las sie uns ohne weitere Verzögerung vor, ich unterschrieb die notwendigen Papiere und war nun rechtsgültiger Besitzer all dessen, was vorher Eigentum von Xavier Marrasca und seiner Frau Maria gewesen war. Nachdem ich mich zudem schriftlich verpflichtete, mindestens sechs Monate des Jahres im Winter das Haus in Artà zu bewohnen, erhielt ich aus den Händen des advocat die erste der in dem Schreiben von Don Xavier avisierten vierteljährigen Geldanweisungen über 30.000 Peseten, zu ziehen auf die Caixa de Balears, eine Summe von umgerechnet etwa 10.000 Reichsmark, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht auszumalen gewagt hätte. Das bedeutete, ich hatte im Monat allein aus der Erbschaft mehr als 3.000 Reichsmark zur Verfügung. Zusammen mit meinen eigenen pekuniären Mitteln, die allerdings an diese Summe bei Weitem nicht heranreichten, war ich über Nacht ein wohlhabender Mann geworden, zumal die Kosten für die Lebenshaltung hier auf der Insel wesentlich geringer waren als in meiner deutschen Heimat.
Die anderen Bedingungen, die ich zu akzeptieren hatte, um das Erbe antreten zu können, waren Nebensächlichkeiten, die mich nicht weiter berührten, wie das Untersagen aller baulicher Veränderungen, die für den Erhalt des Hauses nicht unbedingt notwendig waren und die Verfügung, daß ich Immobilie und Mobilie weder verpachten noch veräußern, sondern lediglich meinen Nachkommen vererben durfte. Sollte ich, genau wie die beiden Marrascas, keine Nachkommen haben, war ich verpflichtet, einen geeigneten Erben zu finden, der die Hinterlassenschaft im Sinne des ersten Besitzers weiterführte, anderenfalls es der Kirche zugeschlagen wurde. Zwar konnte ich mir allenfalls verschwommen vorstellen, was es heißt, die Hinterlassenschaft im Sinne des ersten Besitzers weiterzuführen, aber das besorgte mich in diesem Moment auch nicht sonderlich.
Nach Rücksprache mit dem Wirt Pablo, verpflichtete ich seine Frau Consuela gegen ein angemessenes Entgelt, das Haus zweimal wöchentlich gründlich zu reinigen. Ihre Schwägerin Bienvenida stellte ich zu ähnlichen Bedingungen zur Pflege des Gartens ein.
Dann betrat ich das Haus erstmals als sein in alle Rechte und Pflichten eingesetzter Besitzer. Mein Haus.
Es hatte insgesamt vier Wohnebenen von denen zuunterst ein Verschlag, kein eigentlicher Keller, mehr ein flacher Unterstand von etwa eineinhalb Metern Höhe, in den felsigen Boden gehauen war. An den Wänden waren Regale befestigt, in denen neben konserviertem Gemüse in großen Gläsern auch ansehnliche Weinvorräte und allerlei Haus-, Küchen- und Gartengerät lagerte. Obwohl es hier angenehm kühl war, hielt ich mich in diesem Unterstand nur so lange wie nötig auf, etwa um eine Flasche Wein oder ein Glas Eingemachtes zu holen, denn ich mußte immer halb gebückt mit eingezogenem Kopf dort drinnen stehen, was ich als äußerst beschwerlich empfand. Zudem stieß ich mir trotz aller Vorsicht ständig den Kopf an den harten Lehmkanten der Decke. Im Erdgeschoß befand sich die Küche und direkt in diese übergehend ein großes Zimmer, das den Marrascas als Wohn- und Eßzimmer gedient haben mochte.
Hinter der Küche, vom schmalen Flur begehbar, gleich neben der Tür zum Vorratsunterstand, befand sich ein Abort, dem sich eine Art Badestube mit einem zinkenen Zuber und Wasserreservoir samt Kohleofen anschloß.
Eine schmale Treppe führte ins erste Stockwerk, in dem sich insgesamt drei Zimmer befanden. Das ehemalige der Dona Maria, in dem nun der Chauffeur Álvaro seinen liebeskummerbedingten Rausch ausschlief, und jenes, das Don Xavier als Arbeitszimmer genutzt hatte, welches ich nun bewohnte. Beide Räume waren in etwa gleich groß und zeigten, nebeneinander liegend und mit jeweils zwei Fenstern versehen, zur Straße hinaus. Über den Treppenabsatz war das dritte Zimmer erreichbar, das sowohl begehbarer Kleiderschrank als auch An- und Umkleidezimmer gewesen sein mochte, denn an die Wände waren Schränke eingepaßt, die eine beträchtliche Anzahl von Kleidungsstücken, für Mann und Frau getrennt, enthielten, gleichwohl deren Zuschnitt auf ein älteres Entstehungsdatum schließen ließ und keinesfalls den derzeit aktuellen modischen Gepflogenheiten entsprach.
In Fortsetzung der schon erwähnten Treppe gelangte man in die über der ersten liegende Etage, deren drei Zimmer eine fast gleiche Größe aufwiesen. Zwei davon waren offensichtlich als Gästezimmer gedacht gewesen, denn sie enthielten neben Tisch und Stuhl auch jeweils Bett und Schrank. Der dritte Raum aber beherbergte eine recht umfangreiche Bibliothek, in die ich mich sofort verliebte und die zu erforschen ich mir als vordringlich vermerkte. Neben den Buchregalen, die jede freie Wandfläche, sogar den Platz über der Zimmertür, bedeckten, gab es einen ledernen Sessel, der bequem und behaglich daher kam und seitlich davor ein gediegenes Rauchertischchen, gerade groß genug, ein Glas Wein und den Aschenbecher für eine gute Zigarre darauf abzustellen.
Über einen weiteren Treppenabschnitt gelangte man dann auf die Dachterrasse, die mit einer hüfthohen Brüstung versehen war. Ringsum hatte Dona Maria tönerne Schalen und Amphoren unterschiedlicher Größe aufgestellt, die mit prachtvollen Exemplaren der heimisch mediterranen Flora bepflanzt waren. Eine erdbraune Steinbank und ein ebensolcher Tisch luden zum Verweilen. Gleichzeitig schützten die Pflanzen vor den Blicken allzu neugieriger Nachbarn, gaben aber dennoch genügend freie Sicht auf die Dächer der Stadt, Don Remigios nahe Kirche Transformaciò del Senyor und dem etwas höher gelegenen Santuari. Eine Therme fing das Regenwasser auf und leitete es bei Bedarf in die Badestube im Erdgeschoß.
Als ich die Dachfläche betrat, wußte ich sofort, noch bevor ich zum ersten Mal auf der steinernen Bank gesessen hatte, daß sie, neben der Bibliothek ein Stockwerk tiefer, mein bevorzugter Aufenthaltsort im Haus, beziehungsweise außerhalb desselben sein würde.
Allmählich fand ich wieder in meinen alten Trott, die neu getroffenen Arrangements mit Consuela und Bienvenida spielten sich nach den üblichen Anfangsschwierigkeiten im Lauf der Zeit ein.
Vormittags begab ich mich auf Erkundungstour in die nahe Umgebung, ohne allerdings planvoll und mit einem bestimmten Ziel vorzugehen. Ich ließ mich einfach treiben und träumte vor mich hin. Mittags, wenn die Hitze am Größten war, trank ich in der Bar El Ultim meinen Kaffee, um anschließend in meinem kühlen Heim ein erfrischendes Schläfchen zu halten. Nachmittags begab ich mich auf die schattige Dachterrasse, trank kalten rosado und schmökerte in einem Buch aus der Bibliothek. Abends schließlich traf ich mich mit Don Remigio zum Nachtessen im El Ultim und abwechselnd leisteten uns auch Don Basilio, der advocat, der alcalde oder der metge Gesellschaft.
Es waren, je nach dem, besinnliche oder feucht fröhliche Abende, die sich oft bis in die frühen Morgenstunden hinzogen und nicht selten kam es vor, daß Don Remigio oder auch Don Basilio in meinen Gästezimmern nächtigten, weil ihnen in ihrem Zustand der Heimweg hügelaufwärts mit den steilen Treppenstufen zu mühselig erschien. Eine vernünftige Einschätzung, die sicherlich zutraf und in ihrer Weisheit dazu beitrug, Verletzungen von Körper, Geist und Ansehen der beiden Geistlichen auf ein Minimum zu reduzieren.
Eines Tages, mir stand der Sinn nach einem kleinen Ausflug über die Insel, ließ ich mich von Álvaro über Pollenca nach Sóller, von dort weiter über den Coll de Sóller nach Deia und schließlich bis nach Valldemossa fahren. Da ich ihn immer wieder anzuhalten hieß, damit ich mir in Ruhe die wilde klippenreiche Landschaft ansehen konnte, gelangten wir erst abends am Zielort an, und waren gezwungen, in der Herberge Can Mario Zimmer zu nehmen, um dort die Nacht zu verbringen. Das paßte Álvaro nun rein gar nicht, konnte er doch den Abend nicht in der Nähe seiner großen Liebe Bienvenida verbringen. Nach einer Weile aber sah er ein, daß eine Rückfahrt in der Dunkelheit zu gefährlich war und fügte sich seinem Schicksal.
Wir verlebten einen angenehmen Abend mit gutem Essen und viel Wein, während wir uns angeregt unterhielten.
Ich schlief tief und fest in der frischen Luft, die das Meer herüberschickte und erwachte am anderen Morgen ausgeruht und guter Dinge.
Anderntags besuchten wir noch die Einsiedelei mit der Kartause, in der Frédéric Chopin und George Sand einige Zeit verbracht hatten, schlenderten ein wenig durch die Gassen des malerischen Örtchens Valdemossa und begaben uns mittags auf die Heimfahrt. Ohne Zwischenfälle erreichten wir am frühen Abend Artà und Álvaro eilte zielstrebig in die Bar El Ultim, um seiner Angebeteten Bericht zu erstatten und seine Abwesenheit am Abend zuvor zu erklären.
Ich selbst aber begab mich in den kühlen Schatten meiner Dachterrasse und ließ den Besuch auf dem Coll de Sóller und in der Einsiedelei von Valldemossa im Geiste nochmals Revue passieren.
Natürlich hatte sich mein Erbe schnell im Städtchen herumgesprochen, ebenso wie die vierteljährlichen Zuwendungen, über deren Höhe zwar niemand genau Bescheid wußte, über die aber, dessen ungeachtet, abenteuerliche Gerüchte in Umlauf waren. Die Leute tuschelten und überboten sich gegenseitig in Vermutungen und Unterstellungen, wie das in jeder Kleinstadt dieser Größenordnung der Fall gewesen wäre. Man lebte eben nicht anonym und unerkannt als einer unter vielen gleich Unbekannten. Man lebte hier mittendrin in der Gemeinschaft und bekam das auch tagtäglich zu spüren. Aber mich scherte der Klatsch der Leute auf dem Markt wenig, zumal er sofort verstummte, sobald ich in Hörweite vorbeiging.
Die Leute wußten außerdem um meine Freundschaft zu den beiden pares und den anderen Honoratioren des Ortes und waren daher vorsichtig genug, es sich mit diesen durch allzu gewagte Äußerungen nicht zu verscherzen, zumal an meinem Lebenswandel nun wahrlich nichts auszusetzen war.
Nach und nach verstummten dann auch die Gerüchte und die Alltagsgespräche der Menschen nahmen ihren Verlauf, auch wenn ich hinzukam, denn sie hatten die ewig gleichen Themen zum Inhalt, das Wetter, die Orangenpreise und die verfehlte Politik der Zentralregierung.
Mein Erbe, die Umstände, wie ich es erlangt hatte und die Höhe der Zuwendungen gehörten nicht mehr dazu.
„Bon dia, com va?“ Bald schon war ich als einer der ihren akzeptiert, von den Alten auf der Placa d’ Espanya respektvoll mit Don Diego angesprochen, wenngleich sie mich hinter meinem Rücken unter sich nur el alemany nannten. Aber, erklärte mir Don Remigio, daran sollte ich mich nicht stören, sondern diesen Beinamen vielmehr als Ausdruck höchster Wertschätzung verstehen. Ich verstand in diesem Sinne.
Zuerst nur vereinzelt, dann vermehrt erhielt ich an den Wochenenden Einladungen zu der einen oder anderen festa auf einer finca in der nahen Umgebung oder einem menjar a l’aire lliure, einer Art Picknick auf einer Wiese vor der Stadt oder an der Küste. Dabei hatte ich stets den Eindruck, man behandelte mich wie einen Ehrengast, was mir zunehmend peinlich war. Nicht nur, daß mir immer irgendeine Tochter des Gastgebers herausgeputzt an die Seite gesetzt wurde, war ich durch deren Mutter und oft auch noch der Großmutter argen verbalen Prüfungen und Befragungen ausgesetzt, bis mich der patro dann unter seine Fittiche nahm und das gleiche Spiel, diesmal aus männlicher Perspektive, von vorne begann.
Dazwischen wurde ausgiebig getrunken und gegessen, jedoch hatte ich immer häufiger das Gefühl, die anderen Gäste wären nur als schmückende Ergänzung eingeladen. Es bedurfte nicht nur einer geraumen Zeitspanne, sondern auch des dezenten Hinweises Don Remigios, bis ich endlich mitbekam, daß mich die angesehenen Familien der Stadt als eine gute Partie für ihre Töchter auserkoren hatten und diese ganzen Festivitäten nur als Vorwand dienten, festzustellen, ob ich ihren Ansprüchen genügen würde oder nicht.
Als ich das endlich begriffen hatte, nahm ich die Angelegenheit mit Humor und fügte mich meinem Schicksal. Den Einladungen selbst war kaum zu entgehen. Wenn ich eine annahm, mußte ich auch die anderen annehmen. Eine Ablehnung der Einladungen ohne triftigen Grund aber wäre einer nicht wieder gutzumachenden Beleidigung des Gastgebers gleichgekommen und hätte mich außerhalb der Gemeinschaft des Ortes gestellt.
Also machte ich eine gute Miene zum nicht böse gemeinten Spiel, zumal die Kandidatinnen in ihrer Mehrzahl durchaus wohltuend anzusehen und die festas fraglos kurzweilig waren. Allerdings fand ich die Richtige, jedenfalls aus meiner Sicht, lange Zeit nicht unter den Aspirantinnen.
Es war eine angenehme Zeit, die ich verbrachte, mit mehr als ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet, ohne große Verpflichtungen, genau genommen, in den Tag hinein zu leben. Immer seltener dachte ich an das Schreiben Don Xaviers das eigentlich nicht möglich sein konnte, und die näheren Umstände, die mich zum Erben gemacht hatten. Immerhin besuchte ich regelmäßig die Grabstätte der Familie Marrasca, auf der auch Don Xavier einen Gedenkstein hatte, obwohl seine sterblichen Überreste nicht dort lagen. Er war aus schwarzem Marmor, auf dem im unteren Drittel schlicht „el corb“ und darüber ein stilisierter Rabe eingemeißelt waren. Außerdem hatte ich zwei darauf spezialisierte Senyoras mit der Pflege des Grabes beauftragt.
Doch die Ruhe und Beschaulichkeit, in der ich mich wähnte, waren trügerisch, wie sich schon bald herausstellen sollte.