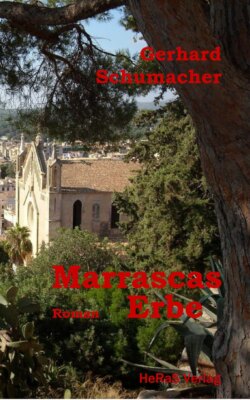Читать книгу Marrascas Erbe - Gerhard Schumacher - Страница 11
sieben / set
ОглавлениеEs war heute einer der beiden Tage der Woche, an denen Consuela das Haus saubermachte. Sie hatte die Angewohnheit, dabei aus voller Herzenslust katalanische Liebeslieder zu singen, viele traurige, wenige fröhliche, denen allen aber eins gemeinsam war, ihre Lautstärke. Und das alles ungeachtet der Tatsache, daß sie nicht im Geringsten des Gesangs mächtig war und die Trefferquote der korrekt erfaßten Töne gegen null tendierte. Da ich meist, um nicht im Weg zu sein, die Flucht ergriff, wenn sie mit Eimer, Lappen und Besen auftauchte, störte mich ihre musikalische Passion nicht sonderlich. Heute rissen mich ihre herzzerreißenden aber grundfalschen Töne allerdings aus den Tiefen des Schlafs.
Es war Mittag, die Sonne brannte unbarmherzig auf mich nieder, ich war durchgeschwitzt und meine Kleider klebten mir am ganzen Körper. Jedenfalls kam es mir so vor. Mühsam rollte ich mich aus der Hängematte und trollte mich an Consuela vorbei in das Badezimmer, wo ich mich gründlich wusch und frische Kleidung anzog. Danach kam ich mir wieder frisch und munter vor.
In der Bar El Ultim trank ich Kaffee und aß ein Stückchen tortell. Als Álvaro auf der Bildfläche erschien, kam mir der Einfall, er könne mich nach Palma zur Universität fahren, in deren Bibliothek ich mir nähere Informationen über den Verfasser des Fischtextes, Carl Vogt, und den darin erwähnten französischen Fischzüchter Carbonnier erhoffte. Ich hatte erwartet, Álvaro würde wieder maulen, weil ich ihn dadurch für einige Stunden von seiner Geliebten trennte, aber er zeigte sich sogleich einverstanden, da er die Zeit, die ich in der Universität verbrachte, für einige persönliche Erledigungen nutzen wollte. Also fuhren wir ohne weitere Verzögerungen los und erreichten am frühen Nachmittag die Hauptstadt der Insel, wo Álvaro mich vor der Universität absetzte und in etwa zwei Stunden wieder aufzunehmen versprach. Dann steuerte er sein Automobil in das Verkehrsgewühl zurück.
Es war nicht schwierig, Einlaß in die heiligen Hallen zu finden, nachdem ich mein Anliegen ausführlich dargelegt hatte. Man wies mir in der Bibliothek einen Platz zu und schon nach kurzer Zeit brachte mir ein schweigsamer Hausdiener eine Reihe von Nachschlagwerken, die die von mir gewünschten Informationen enthalten sollten. Jedenfalls soweit sie hier an der Universität zugänglich waren.
Zwar fand ich Einträge sowohl zu Vogt als auch zu Carbonnier, doch weder brachten sie mich in meiner Angelegenheit weiter, noch offenbarten sie irgendeine Querverbindung zu Senyor Marrasca.
Bei Carl Vogt handelte es sich um einen deutsch-schweizerischen Naturwissenschaftler, der unter anderem über Amphibien und Fische geforscht hatte. Das erklärte zumindest seinen kurzen Artikel in der Gartenlaube. Zusätzlich betätigte er sich als demokratischer Politiker, wurde von Karl Marx des Agententums für Napoleon III. bezichtigt und verstarb schließlich 1895, knapp 80 jährig, in Genf.
Pierre Carbonnier war einer der angesehensten Fischzüchter seiner Zeit, der 1864 ein grundlegendes Werk, den Guide practique du pisciculteur, in Paris herausgegeben hatte, was wiederum die Verbindung zu Vogt erklärte, mehr aber auch nicht.
Der angestrichene Text in der deutschen Zeitung hingegen blieb nach wie vor ohne Zusammenhang zu den Dingen, die mich und mein Leben in Artà betrafen.
Enttäuscht klappte ich die Bücher zu, brachte sie zur Ausgabe zurück und verabschiedete mich dankend mit einer angemessenen Spende für die Erweiterung und den Erhalt des Bestands. Der Bibliothekar brachte mich persönlich zum Ausgang und versicherte mir mehrmals, wie sehr er sich freuen würde, mich erneut begrüßen zu dürfen. Ich glaubte ihm unbesehen.
Kaum eine Stunde benötigte ich, um zu der Erkenntnis zu gelangen, nichts Neues aufgedeckt zu haben. Und bin so schlau als wie zuvor, kam es mir in den Sinn, den armen Tor hatte ich gedanklich verdrängt, aufgeben wollte ich indes nicht. Natürlich war Álvaro noch nicht wieder aufgetaucht, mich abzuholen. Also schlenderte ich ein wenig durch die angrenzenden Straßen von Ciutat de Mallorca, wie Palma auf català genannt wird.
In einem café trank ich Schokolade und aß einen vorzüglichen Mandelkuchen, der mir ausgezeichnet schmeckte und meine Laune beträchtlich hob. Durch die Schaufensterscheibe betrachtete ich nun schon sehr viel vergnügter das Treiben auf der Straße, als es mir noch kurz zuvor möglich gewesen wäre.
Die Leute gingen einkaufen oder trugen Waren aus, Kinder und Hunde sprangen zwischen ihnen herum und lärmten fröhlich. Ein Mann mit einem Fahrrad transportierte auf seinem rückwärtigen Gepäckträger ein kleines Schwein, das sich laut quiekend über die Behandlung beschwerte. Halbwüchsige trugen die Nachmittagszeitungen aus, schrieen lauthals die Schlagzeilen vor sich her in das Gewusel der Straße. Bauern aus dem Umland luden Kisten mit Obst von einem Karren und unterhielten sich, aus voller Kehle lachend. Schräg gegenüber saßen zwei ältere Senyores auf Klappstühlen mitten auf dem Pflaster des Gehsteigs, rauchten Zigarrenstummel und waren offensichtlich in ein kritisches Gespräch über Gott, die Welt oder beides vertieft. Frauen mit Körben voller Gemüse, Obst und anderen Dingen für das Essen am Abend schlenderten schwatzend nach Hause. Nur in eine nasse Zeitung gewickelt, trug ein Junge einen Fisch auf den Schultern, der fast größer war als er selbst. Hunde jagten sich kläffend, drehten Kurven, schlugen Haken und rannten den Leuten zwischen den Beinen herum. Sorgsam bedacht, nirgendwo anzustoßen, balancierte eine junge Frau eine Kiepe mit Eiern durch das Gedränge, eine andere versuchte auf ihrem Kopf einen Korb mit Auberginen im Gleichgewicht zu halten.
Die Luft roch nach gebratenem Fleisch, gesottenem Fisch, Knoblauch und vielerlei anderen Gewürzen und Ingredienzien, exotisch wie aus Tausend und einer Nacht. Über allem lag der fröhliche Lärm der unbeschwerten Lebensweise, die dem Menschenschlag hier eigen war, obwohl die Sorgen und Nöte sicher nicht geringer waren als anderswo.
Es war ein monumentales, barock anmutendes Gemälde, das sich da vor dem Fenster der pastisseria abzeichnete, bunt, chaotisch und mit kräftigem, weithin hör- und spürbarem Dröhnen in der Luft, ich konnte mich nicht satt daran sehen, meine Ohren wollten den Lärm einsaugen, meine Nase die wunderbaren Gerüche inhalieren.
Trotz aller Merkwürdigkeiten, die mir in den letzten Wochen untergekommen waren, befand ich mich in diesem Augenblick in einem geradezu euphorischen Zustand. Vor meinen Augen liefen die bunten Bilder ab wie auf der Leinwand im Filmpalast und ich hatte in diesem Moment nur einen intensiven Gedanken: Das Leben ist schön.
Dann sah ich die beiden Männer, die eiligen Schritts die Straße entlang liefen. In all der unaufgeregten Ruhe des Menschengewirrs schlugen sie ein wesentlich höheres Tempo an und hasteten gegen den Strom der sie Umgebenden. Nur dadurch fielen sie mir überhaupt erst auf, denn mit ihrer nervösen Eile wirkten sie wie ein Fremdkörper in einer ansonsten homogenen Masse. Einer der beiden trug einen Pappkarton, dessen Inhalt offensichtlich von einigem Gewicht sein mußte, denn er wechselte die Kiste alle paar Meter vom rechten unter den linken Arm und dann wieder zurück. Es war Álvaro, der schwer an dem Karton trug. Neben ihm ging ein capellà in einer schwarzen Soutane, den Oberkörper halb zum Chauffeur gewendet, auf den er, mit beiden Armen gestikulierend, heftig einredete.
Das Auftauchen der beiden hatte mich dermaßen überrascht, daß ich erst zu reagieren vermochte, da sie längst im Gewühl der Straße untergetaucht, meinen Blicken entzogen waren. Als ich mich endlich einigermaßen von meiner Verwirrung erholt hatte, war es bereits zu spät. Ich hätte sie nicht mehr wiedergefunden, sie konnten in eine der kleinen Seitengassen eingebogen oder in der nächstbesten Toreinfahrt verschwunden sein.
Eben noch war ich von der Schönheit der Welt ergriffen, nur einige Wimpernschläge später fiel diese schöne Welt in sich zusammen wie das oft zitierte Kartenhaus. Ich blieb starr wie in Stein gehauen auf meinem Stuhl sitzen. Das Blut mußte mir aus dem Gesicht gewichen, der Oberkörper zusammengesunken sein. Die Bedienung kam zögernd an den Tisch und erkundigte sich vorsichtig nach meinem Befinden. Erst nachdem sie sich zweimal wiederholt hatte, verstand ich ihre Worte und bedankte mich mit einer schwachen, wahrscheinlich wenig überzeugenden Geste für ihre Fürsorge. Dann kramte ich einige Münzen aus der Jackentasche, warf sie auf den Tisch, stand auf und verließ das café. Mechanisch schlug ich den Weg zur Universität ein, dem mit Álvaro vereinbarten Treffpunkt.
Natürlich war ich ihm nie persönlich begegnet, wie wäre das auch möglich gewesen? Und dennoch, in diesem Augenblick hätte ich Stein und Bein geschworen, in dem redseligen Begleiter Álvaros gegen jede Vernunft und Realität Don Xavier Marrasca erkannt zu haben. Logischerweise war das nicht möglich, konnte nicht sein. Der Rabe war tot, vor fast dreiunddreißig Jahren an der Küste von Canyamel in stürmischer Flut ertrunken. Die zerschlagenen Überreste seines Bootes legten unwiderlegbar Zeugnis davon ab.
Als ich vor der Universität ankam, wartete Álvaro bereits in seinem Automobil auf mich. Ich setzte mich neben ihn auf den Beifahrersitz und bemerkte beim Einsteigen, den braunen Pappkarton, an dem er so schwer geschleppt hatte, auf den Rücksitzen. Álvaro mußte meinen Blick mitbekommen haben, denn ohne eine Frage meinerseits abzuwarten, erklärte er mir, er habe einige dringend benötigte Sachen aus seinem Zimmer hier in Palma abgeholt, da er in Artà bestimmte Verwendung für sie habe.
Die Rückfahrt verlief dann in einer eigenartig angespannt unsicheren Atmosphäre. Ich selbst hatte mich zwar soweit von meinem Schrecken erholt, daß ich glaubte, rein äußerlich einen normalen Eindruck zu hinterlassen, innerlich aber war ich, man kann es sich vorstellen, aufs Trefflichste zerrissen und aufgewühlt. Mein Körper muß unbewußt entsprechende Signale an die Umgebung ausgeschickt haben, denn Álvaro merkte sehr wohl, daß irgend etwas mit mir nicht stimmte, mein Verhalten ein anderes war als gewöhnlich. Ebenso mußte er gefühlt haben, daß dieses Irgend etwas mit seiner Person in Verbindung stand, traute sich indes aber nicht, mich danach zu fragen. So tauschten wir nur hin und wieder unverfängliche Floskeln und schwiegen uns ansonsten an. Bevor ich Álvaro auf die Person, in deren Begleitung ich ihn in Palma gesehen hatte, ansprach, wollte ich unter allen Umständen zuerst Rücksprache mit meinen beiden Verbündeten, Don Remigio und seinem Amtsbruder Basilio, halten, auch, wenn ich damit ihrem Verdacht, Álvaro sei der Verräter, der dem bisbe unsere Gespräche hintertrage, Vorschub oder gar Bestätigung leisten würde.
Nachdem wir Artà erreicht hatten, es war inzwischen Abend geworden, begab ich mich ohne Umweg über mein Haus sofort in die Bar El Ultim zum Essen mit meinen beiden Gefährten, denn ich brannte darauf, ihnen von den Neuigkeiten der vergangenen Stunden zu berichten und ihre Meinungen einzuholen.
Álvaro hingegen hantierte umständlich mit dem Pappkarton herum, den er erst im Haus verstaut haben wollte, ehe er auch in die Bar zu kommen versprach.
Unter normalen Umständen hätte er nach den Stunden der Trennung von seiner Angebeteten den Karton das sein lassen, was er war, ein Karton, noch dazu auf dem Rücksitz seines cotxe und wäre unverzüglich auf seinen Stammplatz nahe der Küchentür in die Bar gestürmt, von dem er sich freiwillig erst dann wieder wegbewegt hätte, wenn Pablo ihn, ganz so wie jeden Abend, Tag für Tag, hinauswerfen mußte, damit er endlich in sein Bett fand. So kannte ich ihn, immerhin wohnten wir schon einige Wochen zusammen.
Nachdenklich schaute ich ihm nach, als er die schwere Kiste zum Haus trug und nach einigen vergeblichen Versuchen, die Pforte zu öffnen, schließlich samt seiner Last darin verschwand. Es dauerte dann etwa die Hälfte einer Stunde, bis Álvaro in der Bar erschien und wie gewohnt seinen Platz nahe der Tür zu Bienvenidas Wirkungsstätte in Besitz nahm. Obwohl ich es mir zunächst nicht eingestehen wollte, muß ich zugeben, daß die leisen Zweifel an seiner Loyalität, die nach dem Verdacht der Gefährten in mir aufgekommen waren, inzwischen unüberhörbar in meiner Brust rumorten und mir echtes Kopfzerbrechen bereiteten. Doch wenn ich in diesem Land Spanien, speziell auf dieser Insel Mallorca und ganz besonders in diesem Ort Artà eines gelernt hatte, dann war das, nichts zu überstürzen. Mit diesem Grundsatz bin ich immer gut gefahren, ich habe ihn mir zu eigen gemacht und bis ins hohe Alter nicht bereut.
Wie ich es erwartet hatte, saßen die beiden pares schon an dem Tisch, den Consuela nun ständig zu unserer Verfügung frei hielt und warteten ungeduldig auf mein Erscheinen. Sie wußten ja weder von der Nacht, die ich in der Bibliothek verbracht hatte, noch konnten sie wissen, warum ich mit Álvaro nach Palma gefahren, wie lange ich mich dort aufhalten und wann ich zurückkommen würde. Schon gar nichts wußten sie über den Grund der Fahrt, meine Enttäuschung über den geringen Erfolg oder die merkwürdige Erscheinung, die ich durchs Schaufenster der pastisseria beobachtet hatte.
War es die Realität gewesen, die ich sah, oder eine unwirkliche Erscheinung? Projizierte ich die Vorstellungen, die sich in meinem Gehirn zusammenbrauten, ohne daß ich diesen Vorgängen willentlich Einhalt gebieten konnte, nun schon auf das Geschehen um mich herum? Sah ich eine Welt fern jeder Realität, nur, weil ich sie so sehen wollte? Hatte ich vielleicht den harmlosen capellà einer der unzähligen Kirchen Palmas in meinem Kopf zur Wiedergeburt einer Phantasie meiner Gedanken erklärt? Wollte ich all das? Mit Sicherheit nicht. Wenn ich es aber nicht wollte, wer oder was wollte es dann? Wenn es nicht mein eigener Wille war, dem ich unterlag, wem gehorchte ich dann? Ich befürchtete, langsam den Überblick zu verlieren und war froh, am Tisch die Freunde zu sehen, denen ich mich in meiner Verwirrung offenbaren, die ich um Rat und Beistand angehen konnte.
Ein Glas Wein stand schon für mich bereit, ich kippte es, ganz gegen meine Gewohnheit und ohne Respekt vor der Kunst des Winzers, mit einem Zug in mich hinein, goß mir ein zweites Glas voll und tat es ihm gleich. Ich spürte, wie ich allmählich ruhiger wurde, das Zittern der Hände, das mich die ganze Fahrt von Palma herauf begleitet hatte, ließ nach, mein Herz schlug wieder in gleichmäßigem Takt. Schon als ich glaubte, die Schwäche überstanden zu haben, überkam es mich erneut und ich mußte meinen Kopf auf beide Hände stützen, damit er nicht auf die Tischplatte polterte. Eine derartige Situation hatte ich in meinen bisherigen zweiunddreißig Lebensjahren noch nicht durchstehen müssen. Meine beiden Tischgenossen schauten einigermaßen verunsichert drein, als wüßten sie nicht, wie sie sich verhalten sollten. Don Remigio faßte über den Tisch hinweg meine Schultern und sagte:
„Was ist mit Ihnen widerfahren, Don Diego, Sie schauen so verzweifelt, als wäre Ihnen der Leibhaftige begegnet.“
Er konnte nicht ahnen, wie nahe er der Wahrheit kam. Es war eine Situation entstanden, die nicht wenig Skurrilität in sich trug und als ich mir dessen bewußt wurde, mußte ich plötzlich so laut lachen, daß mir die Tränen über die Wangen liefen. Nun waren die Freunde endgültig desorientiert und schauten mich noch verwirrter an. Offensichtlich dachten sie, ich sei verrückt geworden und wiederum ahnten sie nicht, wie nahe sie damit meinem tatsächlichen Zustand kamen. Aber ich konnte ihnen ihr kritisches Urteil nicht verübeln, denn in der Tat mußte ein Außenstehender mein Verhalten mehr als merkwürdig bewerten.
Nachdem ich mich wieder beruhigt hatte, erzählte ich den Gefährten meine Erlebnisse seit unserem letzten Zusammentreffen. Angefangen bei der vergangenen Nacht, die ich in der Bibliothek zugebracht hatte, meinen Fund von drei gebundenen Jahrgängen der deutschen Zeitung Die Gartenlaube und dem von Sinn her in diesem Zusammenhang unverständlichen Fischartikel, der dick mit dem Rotstift angestrichen war. Ich berichtete ihnen von meiner Fahrt nach Palma, den Nachforschungen nach Carl Vogt und Pierre Carbonnier in der Universitätsbibliothek, die Enttäuschung, außer einigen biographischen Anmerkungen nichts Wesentliches herausgefunden zu haben und dem anschließenden Besuch in der pastisseria.
An dieser Stelle meines Berichts erschien Álvaro in der Bar, grüßte kurz zu unserem Tisch hinüber und begab sich dann an den seinen nahe der Küchentür. Es war nun schwierig für mich, weiterzuerzählen, denn von seinem Platz aus konnte Álvaro ohne allzu große Anstrengung alles mithören, was zwischen uns gesprochen wurde, wenn er es denn darauf anlegte. Das konnte ich nicht riskieren. Würden wir hingegen die Köpfe zusammenstecken und zu flüstern beginnen, wäre dieses Verhalten genauso auffällig, denn bisher hatten wir uns immer offen und ohne Rücksicht auf die Lautstärke miteinander unterhalten.
Natürlich waren die Freunde gespannt, die Fortsetzung meiner Geschichte zu hören, zumal bis zu dieser Stelle noch nichts allzu Aufregendes passiert war, sieht man einmal von dem Fischartikel ab. Das bis dahin Geschehene rechtfertigte jedenfalls nicht meine Verwirrung und den desolaten nervlichen Zustand, den ich nach Eintritt in die Bar gezeigt hatte. Ich machte mit den Fingern Zeichen, bedeutete ihnen, den Bericht nach dem Essen in meinem Hause zu Ende zu bringen, doch sie verstanden die Kreise, Haken und Pfeile nicht, die ich auf die Tischplatte malte und hielten sie wohl für kryptische Zuckungen eines Nervenkranken. Um nun vor den beiden capellàs nicht als kompletter Idiot dazustehen, nestelte ich einen Stift aus meiner Jackentasche, kramte nach einem Stückchen Papier und schrieb eine kurze Nachricht über das, was ich mit meiner Hände Gestik nicht verständlich auszudrücken vermochte.
Wir wechselten also in ein unverfängliches Gesprächsthema, Don Basilio, ein passionierter Blumenfreund, erzählte irgend etwas von seinen letzten Züchtungserfolgen, ich hörte nicht richtig zu oder erinnere mich wenigstens nicht mehr daran. Dann brachte Consuela das Essen, auch hieran fehlt mir jegliche Erinnerung, ich konnte schon eine Stunde später nicht mehr sagen, was ich zur Nacht gegessen hatte. Das kennzeichnet meinen Zustand wohl besser als es alles Beschreibende tun könnte. Endlich waren wir fertig, zahlten und gingen durch die nur schwach erleuchtete Carrer zu meinem Haus, wo wir uns in der Bibliothek zusammenfanden.
Hier nun konnte ich zu guter Letzt meine Geschichte zu Ende erzählen und entnahm den Mienen meiner beiden Zuhörer die nachträgliche Bestätigung meiner eigenen Konfusion.
Als ich geendet hatte, trat zunächst einmal Stille ein, die nur ab und an durch das Zischen eines Kerzendochts unterbrochen wurde.
Dann fragte mich Don Remigio, ob ich mir meiner Sache ganz sicher sei oder doch eventuell die Möglichkeit in Erwägung zog, einer Verwechslung oder einer Sinnestäuschung aufgelaufen zu sein.
„So etwas kommt häufiger vor, als man gemeinhin annimmt, besonders bei den Temperaturen, die hier auf der Insel herrschen. Sie sollten keine falsche Scham haben, sich eine derartige Trugwahrnehmung einzugestehen Don Diego, denken Sie noch einmal genau darüber nach, ich bitte Sie.“
Er versuchte mir, eine Brücke zu bauen, aber ich schüttelte den Kopf.
„Nein, Don Remigio, ich denke seit Stunden darüber nach und bin mir völlig sicher, der capellà, den ich zusammen mir Álvaro auf der Straße ausgemacht habe, war dem Raben, wie ich ihn von den Fotos her kenne, so ähnlich, daß man denken mußte, er selbst in höchst eigener Person wäre es gewesen. Älter selbstverständlich als auf den Bildern, aber es waren unverwechselbar dieselben markanten Gesichtszüge. Glauben Sie mir, Senyores, ich bin mir so sicher, wie man es nur sein kann. Absolut.
Natürlich weiß auch ich, daß es nicht Don Xavier gewesen sein kann, den ich gesehen habe. Dann war es eben ein Zwillingsbruder, von dessen Existenz wir bislang noch nichts wußten oder sonst ein naher Verwandter, was weiß denn ich? Bei den Bildern, die ich Ihnen zeigte, dachten Sie zunächst ja ebenfalls, ich wäre darauf abgebildet, in Wirklichkeit handelte es sich um meinen Großvater. Vermutlich jedenfalls. Aber die Ähnlichkeit mit meiner Person verblüffte Sie doch schon, geben Sie es ruhig zu. Warum sollte der capellà, den ich in Begleitung Álvaros gesehen habe, nicht ein naher Verwandter des Raben gewesen sein?“
„Das Einfachste wäre natürlich, Álvaro zu befragen, mit wem er denn in Palma ein so intensives Gespräch geführt hat“, warf Don Basilio ein, „allerdings birgt diese Befragung ein gewisses Risiko in sich. Vielleicht ist alles ganz harmlos und klärt sich nach wenigen Sätzen in Wohlgefallen auf. Vielleicht aber ist unser Verdacht, bei Álvaro handele es sich um einen Spion des bisbe, berechtigt. Dann haben wir einen Trumpf zu früh ausgespielt, er verpufft, die Gegenseite ist gewarnt und kann entsprechende Maßnahmen gegen uns ergreifen. Oder für ihre Sache, ganz wie Sie wollen.“
„Basilio hat recht, auch wenn ich es ungern zugebe“, sagte Don Remigio, „Álvaro mag zwar etwas ahnen, aber er weiß nicht, was wir wissen. Das macht ihn unsicher und wer unsicher ist, begeht früher oder später unweigerlich einen Fehler. Lassen Sie uns überlegen, was wir unternehmen können, um die Identität des Unbekannten festzustellen und was der Chauffeur nun tatsächlich mit der ganzen Angelegenheit zu tun hat. Du, Basilio, hast doch eine persönliche Verbindung zum bischöflichen Palais, deren du dich immer rühmst, wenn du einen über den Durst getrunken hast. Laß uns doch mal herausbekommen, was dieser Kontakt wirklich wert ist.“
„Ein Studienkollege aus meiner Zeit in Barcelona“, erklärte der Angesprochene, „er hat Karriere gemacht und bekleidet jetzt eine höhere Position im Sekretariat des bisbe. Wir verstehen uns gut, ich werde ihn unter einem Vorwand in Palma aufsuchen. Wenn er etwas weiß, wird er es mir sagen. Andererseits würde ich mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Wißt ihr eigentlich, wie viele Kirchen es auf unserer Insel gibt und wie viele pares dort die Glocken läuten oder sonstwie ihr Wesen treiben? Die kann man beim besten Willen nicht alle von Angesicht kennen. Aber, zugegeben, ein Versuch ist es allemal wert.
Im Übrigen war ich heute Vormittag, wie verabredet, im oficina de correus und habe mich einmal nach größeren Sendungen für die Marrascas erkundigt. Der Vorsteher schuldet mir noch den ein oder anderen Gefallen und war bereit, während der migdiada einmal in die alten Bücher zu schauen. Und tatsächlich, der Rabe hat bis zu seinem Tod etwa zweimal pro Jahr eine größere Sendung bekommen, deren Absender die Buchhandlung Iniesta i fill in Palma war. Nach seinem Tod hat seine Witwe Dona Maria weiterhin Bücher aus dieser Buchhandlung bezogen, allerdings in deutlich geringerem Umfang und nur noch unregelmäßig, nämlich höchstens alle zwei Jahre einmal. Seit etwa fünf Jahren kam dann gar nichts mehr. Da ich nun schon einmal auf dem Postamt war, habe ich versucht, bei der Buchhandlung in Palma anzurufen, was trotz mehrerer Versuche aber leider nicht gelungen ist, denn sie existiert nicht mehr, ist vor eben diesen fünf Jahren geschlossen worden. Immerhin wissen wir jetzt mit einiger Sicherheit, woher der Rabe seine Bücher bezogen hat. Was wir nicht wissen ist, warum er die Ausgaben dafür nicht auch als solche aufgeführt hat, wo er doch sonst so penibel in seinen Aufzeichnungen war.“
„Nun gut, ich denke, wir sind zu keiner Zeit davon ausgegangen, daß Don Xavier die Bücher gestohlen hatte. Das wissen wir jetzt mit einiger Wahrscheinlichkeit. Mehr aber auch nicht. Also sind wir mit der Auskunft auch nicht wesentlich weiter gekommen. Interessant wäre es zu wissen, auf welchem Weg er sie bezahlt hat. Aber auch in diesem Punkt kommen wir nicht weiter. Die Buchhandlung existiert nicht mehr, einen Nachkommen des Buchhändlers Iniesta, der sich zudem noch daran erinnern kann, werden wir kaum auftreiben. Diese Strecke müssen wir wohl abhaken, sie hat uns nichts gebracht“, sagte ich enttäuscht.
Doch Don Basilio schüttelte den Kopf.
„Geben Sie nicht so schnell auf, Don Diego. Auch wenn es harmlos daherkommt, welche Gefahr geht schon von Büchern aus, bleibt immer noch die Frage offen, wie er sie bezahlt hat, mit welchem Geld und woher er es hatte, das Geld. Ich spüre, daß an dieser Stelle etwas nicht so ist, wie es zu sein hat.“
„Ehe wir uns die Köpfe über derzeit nicht zu klärende Dinge zerbrechen, sollten wir uns vielmehr an das halten, was direkt vor unseren Nasen steht: an die Bücher nämlich. Sie haben in der letzten Nacht ja schon mit dem Werk begonnen, Don Diego. Auch, wenn die Ausbeute mit dem Fischartikel ein bißchen mager ausgefallen ist, der Weg war der richtige. Also lassen Sie uns doch die Bibliothek gründlich unter die Lupe nehmen. Irgendwo muß ein Hinweis herumliegen. Sechs wache Augen sehen mehr als zwei müde, das ist ein Naturgesetz. Wer immer auch dafür verantwortlich zeichnet.“
Also sprach Don Remigio und wir machten uns an die Arbeit.
Während ich dort weitersuchte, wo ich in der Nacht zuvor aufgehört hatte, nämlich bei den gebundenen Ausgaben der Gartenlaube, nahm sich Don Remigio das darauf folgende Regal und sein pare das dann nächste vor. Eine ganze Weile waren keine anderen Geräusche zu hören als jene, die Bücher machen, wenn sie aus ihrem angestammten Platz im Regal gezogen, ihr befreites Ächzen, wenn sie nach endlos langer Zeit der Ruhe wieder aufgeschlagen und durchblättert, sowie der enttäuschte Hall der Buchdeckel, wenn sie nach kurzer Durchsicht wieder zugeklappt werden. Der Staub unzähliger Jahreszeiten hatte sich auf den Schnittkanten niedergelassen und tanzte nun aufgeschreckt im Kerzenlicht umher.
Mir war, als röche es nach betagtem Papier, Leder, ausgetrocknetem Leim, Druckfarbe und der Kunstfertigkeit einstiger Buchmacher. Diese Gerüche waren mir bisher nie aufgefallen, wenn ich mich in der Bibliothek aufgehalten hatte und es war deshalb gut möglich, daß ich sie mir nur einbildete. Aber was spielte es für eine Rolle, ob diese Ausdünstungen, die meine Sinne zu spüren meinten, in der Realität oder nur in meiner Vorstellung vorhanden waren? Es zählten ausschließlich der Augenblick und die Stimmung, die er hervorrief. Ein Glas Wein vor der malerischen Kulisse eines Sonnenuntergangs in angenehmer Begleitung genossen schmeckt ja bekanntlich auch anders als bei Schnee und Regen in einem grauen Zimmer, obwohl es der gleiche Wein ist.
Als ich die Schilder der Buchrücken überflog, mußte ich mir eingestehen, einen Großteil der Verfasser nicht einmal dem Namen nach zu kennen. Natürlich waren hier überwiegend spanische Autoren versammelt und unter diesen lag der Schwerpunkt wiederum bei denen, die ihre Texte in katalanischer Sprache verfaßt hatten. Namen wie Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover, Miquel dels Sants oder Gabriel Alomar hatte ich bewußt noch nie gehört und ich nahm mir deshalb fest vor, mich in naher Zukunft mit ihnen oder besser, mit ihren Werken zu beschäftigen. Ich betrachtete es einfach als eine Frage der Achtung und des Anstands, sich mit der Kultur des Landes zu befassen, in dem man lebte. Ganz besonders, wenn es nicht das Land der eigenen Herkunft, das Land, in dem man geboren wurde, war. Und wo schlagen sich Wesen und Leben eines Volkes besser nieder als in seiner Literatur?
Dann stieß ich auf Santiago Rusinol, den großen katalanischen Schriftsteller, Maler und Theaterautor, den ich kannte und von dessen Tod ich vor Kurzem in der Zeitung gelesen hatte. Obwohl kein Mallorquiner, hat er der Insel mit seinem Buch L’illa de la calma, Insel der Ruhe, eine wunderbare Hommage geschrieben, die ich während meines ersten Aufenthalts auf Mallorca gelesen hatte. Einigermaßen getröstet, wenigsten einen Namen unter den vielen Unbekannten identifizieren zu können, zog ich die Erstausgabe dieses Werkes von 1922 aus dem Regal und blätterte darin, als in meinem Rücken Don Basilios einen erstaunten Ausruf ausstieß.
„Es ist nicht zu glauben, was ich gerade aus dem Regal gezogen habe. Hört zu, Freunde, das ist eine dieser heiligen Augenblicke, wie man sie im ganzen Leben nur ein-, höchstens zweimal erleben darf. Remigio, alter Spötter, weißt du, was ich hier in den Händen halte? Bevor du auf die ordinärste aller Antworten: ein Buch, zurückgreifst, will ich dir sagen, um welches Buch es sich handelt und du wirst vor Ehrfurcht das Knie beugen und dein Haupt senken.
Ich sage nur: Vida y Hechos Del Ingenioso Cavallero Don Quixote de la Mancha des größten Dichters aller Zeiten, Miguel de Cervantes Saavedra, in einer Ausgabe von 1719, die bei Henrico y Cornelio Verdussen in Amberes, Amsterdam, erschienen ist. Was sagst du nun?“
Stolz schwenkte er den braunen Lederband durch die Luft und hüpfte dabei abwechselnd mit den Füßen auf dem Boden herum als hätte er soeben eine Ader puren Goldes in seinem Garten entdeckt.
Don Remigio aber schaute ungläubig und schien das gerade Gesagte erst verdauen zu müssen. Er war sichtlich beeindruckt von der Verkündung seines Kollegen, die Augen verfolgten das Buch durch die Luft, er mußte sich offensichtlich angestrengt konzentrieren, nicht danach zu greifen. Dann steckten die beiden ihre Köpfe zusammen, bestaunten das Buch und durchblätterten ehrfürchtig Seite um Seite. Ich kam in ihrer Wahrnehmung offensichtlich nicht mehr vor, der Ritter von der traurigen Gestalt hatte ihre Aufmerksamkeit vollständig in Beschlag genommen.
In meinen Händen hielt ich immer noch das Mallorca-Buch des Santiago Rusinol, das ich just wieder an seinen Platz im Regal zurückstellen wollte, als ich auf dem Fußboden einen Zettel bemerkte, der wahrscheinlich nur aus dem Buch gefallen sein konnte, als ich beim Blättern vom Aufschrei Don Basilios gestört wurde. Ich hob das Papier auf, faltete es auseinander und las einige Zeilen, die eindeutig von der Hand Don Xaviers auf das Papier gebracht worden war:
… per aquesta angoixa d’anar de pressai arribas allà on no tenim feina…
Es handelte sich um die Einführung, die Rusinol zu seinem Buch geschrieben hatte und lautete übersetzt in die deutsche Sprache etwa:
… wenn die rastlose Eile dich ermüdet, die uns ständig antreibt, noch schneller an Orte zu gelangen, an denen wir eigentlich nichts verloren haben…
Der Rabe hatte diese Sequenz aus dem Buch auf einen Zettel geschrieben und dieses Papier dann wieder zurück in das Buch gelegt, ein Verhalten, das ich nicht verstand und ohne zu zögern sofort als durchaus merkwürdig empfand.
Aus eigenem Erleben weiß ich, wie schwer es ist, seine Aufmerksamkeit von einem Buch abzuwenden, das ein Faszinosum ausübt, weil man lange davon geträumt hat, es einmal in der Hand zu halten, ganz besonders, wenn es sich um ein altes Buch handelt. Für einen Spanier trifft das verstärkt zu, wenn es sich bei dem Buch um eine alte Ausgabe des Don Quixote handelt, auch wenn es nicht die Erstausgabe von 1605 ist, denn Cervantes gilt seinen Landsleuten, nicht völlig zu Unrecht, als heilig, ist unantastbar und sein Ritter sakrosankt. So benötigte ich geraume Zeit, die Aufmerksamkeit der beiden capellàs auf dieses Papier zu lenken, das ich in einer Ausgabe gefunden hatte, die lediglich profane zehn Jahre alt war.
Ich mußte sie erst daran erinnern, zu welchem Zweck wir die Bücher der Bibliothek untersuchten, ehe sie unwillig von dem Don Quixote abließen und sich meinem Papier zuwandten, das sie mehrmals lasen, hin und wieder her wendeten, als stünde in irgendeiner Ecke noch eine geheime Botschaft und dann auf das Tischchen legten. Zwar konnten sie den Text lesen, verstanden die Worte, aber genauso wenig, wie ich wußten, weder Don Remigio noch sein Kollege sie zu deuten.
„Sind Sie sicher, daß der Zettel mit dem Text von Rusinol auch aus dem Buch von Rusinol gefallen ist? Das ergibt doch wenig Sinn, einige Zeilen abzuschreiben und dann dort wieder einzustecken, wo sie ohnehin schon gedruckt zu finden sind“, fragte mich Don Basilio nun schon zum zweiten Mal.
„Selbst gesehen habe ich es nicht, wie er rausgefallen ist“, gestand ich ein, „als Sie aus vollem Hals die Entdeckung des Cervantes verkündeten, bin ich zu Ihnen herumgefahren, und als ich den Rusinol wieder ins Regal stellen wollte, lag der Zettel auf dem Boden. Da er vorher, da bin ich mir sicher, nicht dort gelegen hatte, kann er nur aus dem Buch gefallen sein. Woher sollte er sonst kommen?“
„An der Logik ist was dran“, gestand Don Remigio mir zu, „aber zwingend ist sie auch nicht. Was, wenn der Zettel an der Stelle im Regal gelegen hat und Sie ihn beim Rausziehen des Buches mit rausgezogen haben?“
„Nun schön, diese Möglichkeit besteht natürlich. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, welche Erkenntnis hätten wir dadurch gewonnen?“, sagte ich.
Don Remigio zuckte mit den Schultern, ging zu der Stelle wo das Buch Rusinols stand, nahm es aus dem Regal und spähte in die entstandene Lücke. Dann zog er noch weitere Bücher heraus, leuchtete mit einer Kerze in den freien Zwischenraum und räumte schließlich das komplette Regalfach leer. Seine Hände tasteten an der Rückwand entlang und auf einmal klappte mit dem leisen Klicken eines Federverschlusses der mittlere Teil der rückwärtigen Holzkassette auf und gab ein Fach von etwa 30 cm Breite und 15 cm Höhe frei.
Don Remigio trat einen Schritt zurück, zeigte auf den versteckten Tresor und sagte:
„Das haben wir gewonnen. Das Papier, wo immer es nun gesteckt haben mag, im Buch oder darunter, war lediglich ein Hinweis darauf am richtigen Ort zu suchen. Bitte sehr Don Diego, es ist Ihr Haus, Ihre Bibliothek, Ihr Geheimfach und auch was darinnen liegen mag gehört Ihnen. Nehmen Sie es in Besitz und, wenn ich diese bescheidene Bitte äußern darf, seien Sie so freundlich, die Kenntnis des Inhalts mit Ihren unwürdigen Helfern zu teilen. Sie haben es sich verdient. Besonders der, der den Schatz durch sein überlegtes Handeln erst zugänglich gemacht hat. Wohlan denn.“
Sowohl Don Basilio als auch ich selbst mußten bei diesen spöttischen, aber nichtsdestotrotz im ernsthaften Tonfall vorgetragenen Worten lachen.
Ich griff in das Fach und holte hervor, was sich darin befand. Es war eine in dunkelblaues Leder eingeschlagene Mappe, die seit was weiß ich wie vielen Jahren, Jahrzehnten vielleicht, zum ersten Mal wieder in vor Anspannung zittrigen Händen, den meinen nämlich, gehalten wurde. In der Mappe befanden sich mehrere Blätter (später, als die erste Aufregung abgeklungen war, zählte ich sieben Blätter), die auf beiden Seiten in der für Don Xavier typischen Handschrift eng beschrieben waren. Es war eine Auflistung oder auch eine Tabelle, pro Seite in drei Spalten unterteilt, die uns, wie sollte es auch anders sein, wiederum vor ein Rätsel stellte. Auf der linken Seite jeder Spalte standen einzelne Großbuchstaben, manchmal zwei, maximal drei zusammengefaßt. Nach einem angemessenen Zwischenraum kam eine Zahl und hinter dieser hatte der Rabe ein kleines q geschrieben, alles fein säuberlich untereinander. Diese Art der Spalte wiederholte sich dann, freilich mit anderem Inhalt, zweimal, so daß insgesamt drei Spalten mit den merkwürdigen Auflistungen auf jeder Seite notiert waren. Bei der ersten schnellen Durchsicht der Blätter meinte ich festzustellen, daß die niedrigste Zahl die 4, die höchste die 700 war. Einige der Zahlen waren unterstrichen, andere wiederum nicht. Das Ganze sah in etwa so aus:
RBC 200 q AA 5 q DMF 20 q
VB 50 q CDR 150 q KL 400 q
NOB 350 q X 70 q RBC 75 q
Und so weiter, ganze sieben Blätter, vierzehn Seiten lang, d.h. um genau zu sein, sollte ich anmerken, daß die letzte Seite nur zu einem guten Drittel beschrieben war.
Don Basilio meinte, für eine derartige Auflistung bräuchte es kein Geheimfach, die könne man offen auf Pablos Theke herumliegen lassen, denn es würde sowieso niemand ihre Bedeutung verstehen.
„Es könnte sich genauso gut um eine Geheimschrift handeln. In dem Fall sind wir so gut wie aufgeschmissen, denn ohne den Quellcode werden wir sie niemals auflösen“, meinte er weiter.
„Vielleicht handelt es sich auch um die Auflistung der Einnahmen, die wir eigentlich suchen. Die Großbuchstaben könnten Abkürzungen von Namen oder Firmenbezeichnungen und die Zahlen Summen sein“, sagte ich, „doch warum sind dann einige Zahlen unterstrichen und einige nicht. Und was bedeutet das q?“
Don Remigio räusperte sich.
„Wenn diese Annahme richtig ist, könnte das q für quilo, kilo, griechisch für tausend, stehen. Wenn wir weiter annehmen, die Zahlen beziffern eine pekuniäre Größenordnung, die wir in unserem Fall, da wir in Spanien leben, zweckmäßigerweise in peseta ausdrücken, hieße das, die Blätter hier listen ungeheure Summen auf, die der Rabe eingenommen oder ausgegeben oder beides hat. Unglaublich, das haut einem glatt den Boden unter den Füßen weg.“
Leise pfiff ich durch die Zähne. Wenn unsere Vermutung stimmen würde, wagte ich nicht, die Beträge zusammenzuzählen, weil ich Angst vor der Endsumme hatte. Sie mußte schwindelerregend hoch sein, dazu angetan, einen Kollaps des Kreislaufs hervorzurufen. Woher kommt soviel Geld?
Don Basilio hatte eine ganze Weile in den Auflistungen geblättert und geschwiegen. Unversehens meldete er sich wieder zurück.
„Schauen Sie, was ich gefunden habe.“, er hielt mir eine Seite hin. „Das ist ein Bruch in der Logik der Liste, schauen Sie es sich nur genau an.“
Und richtig, im unteren Drittel der Seite war die Aufzählung von Buchstaben und Zahlen über alle drei Spalten hinweg unterbrochen. Stattdessen stand dort in der Mitte nur ein einzelnes unterstrichenes Wort:
Martorell
Darunter hatte Don Xavier die Auflistung dann weitergeführt wie gehabt.
„Martorell, was soll das bedeuten, damit kann ich nichts anfangen. Sicher wieder so eine unverständliche Zusammensetzung von Buchstaben, deren Bedeutung nur derjenige versteht, der sich das ausgedacht hat“, sagte ich enttäuscht vor mich hin.
„Das kann so sein, muß es aber nicht“, antwortete mir Don Basilio, „wahrscheinlicher scheint mir doch, der Rabe meint DEN Martorell, nämlich Joanot Martorell, einen valenzianischen Autor des 15. Jahrhunderts. Er hat den Tirant Lo Blanc in valenzianischem català geschrieben, einen Ritterroman, von dem der berühmte Cervantes meinte, es sei das beste Buch der Welt. Zumindest war es das Erste, das man als Vorläufer des modernen Romans bezeichnen kann. Der Don Quixote des guten Cervantes ist ohne den Tirant des Valencianers Martorell überhaupt nicht denkbar. Er hat allerdings die Veröffentlichung seines Romans nicht mehr selbst erlebt, denn er starb bereits 1468, da war die Erzählung noch unvollendet. Sie wurde dann von Marti Joan de Galba, einem ritterlichen Freund, zu Ende geschrieben, jedenfalls geht man davon aus, daß es Galba war, und endlich 1490 in Valencia, zweiundzwanzig Jahre nach dem Tod Martorells und makabererweise auch erst nachdem Galbas, er starb 1489, veröffentlicht. Wenn ich recht habe mit meiner Vermutung, sollte hier irgendwo in dieser Bibliothek eine Ausgabe des Tirant Lo Blanc stehen. Wir müssen sie nur finden. Vielleicht hat der Rabe in dem Buch etwas vermerkt, was uns weiterbringt und eventuell diese Blätter hier erklärt.“
Don Remigio konnte es sich nicht verkneifen, seinem Freund mit einem ironischen Unterton zu bespötteln.
„Halt ein, Basilio, so interessant deine literaturhistorischen Vorlesungen auch sind, du mußt uns nicht gleich mit der Chronik des spanischen, und dort wiederum im Besonderen des katalanischen Schriftguts von den Anfängen bis zur Neuzeit vollschütten. Martorell und sein Weißer Ritter sind gefragt, wir haben verstanden. Also laßt uns die Zeit nicht weiter vertändeln und lieber danach suchen. Das scheint mir sinnvoller.“
Der so Angesprochene lächelte zu diesem kleinen Seitenhieb, nickte aber mit dem Kopf und sagte nichts weiter dazu. Er war diese kleinen Nicklichkeiten seines Amtsbruders seit langen Jahren gewöhnt, teilte sie selbst in entgegengesetzter Richtung in ähnlicher Weise aus, wenn sich die Gelegenheit dazu ergab. Die beiden waren für mich ohne diese ständigen gegenseitigen Spötteleien nicht mehr vorstellbar. Jeder aber, und das erwähne ich an dieser Stelle mit ernsthafter Anerkennung, achtete darauf, die Sache nicht auf die Spitze zu treiben und den anderen womöglich zu verletzen.
„Gut, gut, mein lieber Remigio, dein Wunsch ist mir, wie fast immer, zugleich Anweisung und Auftrag, laßt uns also suchen. Ich darf zudem darauf hinweisen, und das ist dann mein letzter Exkurs in die katalanische Literatur, jedenfalls für heute, daß der Tirant Lo Blanc nicht in einem, sondern in ganzen fünf Bänden erschienen ist. Ein sehr umfangreiches Werk, wie ihr hört. Je nachdem, welche Ausgabe sich also hier in der Bibliothek befindet, wenn sich denn überhaupt eine hier befindet, wird sie eventuell mehrbändig sein. Ansonsten empfehle ich, einen Blick auf die Uhr zu werfen, auf der man unschwer den frühen Morgen ablesen kann. Ich für meinen Teil würde mich deshalb jetzt gerne verabschieden und meine persönliche Beteiligung an der Suche auf den Nachmittag verschieben, denn in wenigen Stunden werde ich eine Reihe von Terminen wahrnehmen müssen, die zwar nicht für mich, aber sehr wohl für die von mir betreuten Schäfchen der Gemeinde wichtig sind. Im Konkreten geht es darum, Trost zu spenden, sowie Beistand und Rat zu geben. Und wenn ich selbst auch nicht von der Wirksamkeit des geistlichen Wortes überzeugt bin, sehe ich mich kraft meines Berufes dennoch in der Verpflichtung, dieses zu erteilen, und zwar glaubwürdig. Auch dir, lieber pare in Theorie und Praxis stünde es gut zu Gesicht, dich wieder einmal etwas intensiver um deine Gemeinde zu kümmern. Ich sage das aus reiner Fürsorge dir gegenüber, mein geschätzter Remigio, und nicht, weil ich dich in irgendeiner Form kritisieren oder gar schulmeistern will, das mußt du mir glauben. Also, lange Rede, wenig Sinn, ich schlage vor, wir vertagen unsere bibliothekarische Untersuchung und begeben uns jetzt erst einmal auf das weiche Lager des Schlafes, der vor uns liegende Tag wird wiederum ein harter werden, ich spüre es jetzt schon in den Knochen.“
Die verhältnismäßig lange Rede Don Basilios, die er mit seiner sonoren Stimme in ruhigem Ton vortrug, hatte die Spannung, die seit dem Fund der Auflistungen in der Luft und auch zwischen uns Suchenden lag, um einiges gemindert. Außerdem stellte sich, zumindest bei mir, in dem Moment eine tonnenschwere Müdigkeit ein, als ich dem Rat Don Basilios folgte und mit einem Blick auf die Uhr feststellte, daß die vierte Morgenstunde bereits zu mehr als der Hälfte überschritten war.
Auch Don Remigio schien mit dem Vorschlag einverstanden, gähnte verschämt hinter vorgehaltener Hand und begann, die Kerzen auszublasen. Wir verabredeten uns für den späten Nachmittag, fünf Uhr, um die Suche nach dem Tirant Lo Blanc aufzunehmen. Ich begleitete die Gefährten nach unten zur Tür und als wir uns mit kurzem Händedruck verabschiedeten, kam Álvaro des Wegs, zögerte kurz im Schritt, als er uns sah und drückte sich dann sichtlich verlegen mit kurzem Gruß an mir vorbei ins Haus, wo er sofort in seinem Zimmer verschwand. Er hatte nicht damit gerechnet, uns zur Stunde seiner Heimkehr vor dem Haus zu treffen und wäre der Begegnung wahrscheinlich ausgewichen, wenn er es noch gekonnt hätte.
Nachdem alle gegangen waren, verschloß ich die Haustür und ging noch einmal hinauf in die Bibliothek. Als ich in der Mitte des Raumes stand, vom Boden bis zur Decke umgeben von hunderten von Büchern, überkam mich wieder das Gefühl der erhabenen Gelassenheit, das ich schon empfand, da ich mir die Bibliothek zum ersten Mal bewußt erschlossen hatte, als ich mir der Kraft bewußt wurde, die von den auf Papier gedruckten und zu Büchern gebundenen Worten ausging.