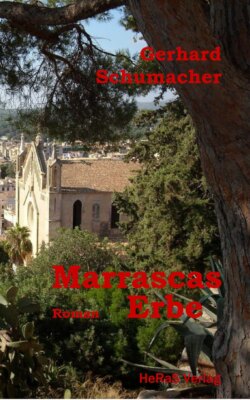Читать книгу Marrascas Erbe - Gerhard Schumacher - Страница 8
vier / quatre
ОглавлениеDas Erste, was mir nach dem Erwachen in den Kopf kam, waren die Schwierigkeiten, eine telefonische Verbindung zu meiner Mutter in Deutschland herzustellen. Das gestaltete sich nicht einfach, ich hatte es mehrfach ausprobiert. Sie selbst hatte keinen Telefonanschluß, ich mußte also zunächst den Kolonialwarenladen gegenüber ihrer Wohnung anrufen, darum bitten, daß man meiner Mutter Bescheid gab, ich würde in einer halben Stunde nochmals anrufen. Das klappte natürlich nur, wenn sie auch gerade zu Hause war. Ich selbst hatte hier in Artà auch kein Telefon, so daß ich im oficina de correus ein Ferngespräch anmelden mußte, das erfahrungsgemäß von einer lausigen Qualität war. Man brauchte nicht wenig Glück, den gewünschten Teilnehmer nicht nur zu erreichen, sondern ihn dann auch noch zu verstehen.
Natürlich war die Fügung des Schicksals auch diesmal keine günstige. Meine Mutter war nicht zu Hause und der Mann im Kolonialwarenladen erwies sich keineswegs als sonderlich hilfsbereit. Ich hinterließ die Telefonnummer der Bar El Ultim und versuchte ihm die Dringlichkeit eines Rückrufs klarzumachen, war mir aber nicht sicher, ob er die Notwendigkeit genauso einschätzte, wie ich es tat.
Deshalb schickte ich noch ein Telegramm an meine Mutter, in dem ich in aller gebotenen Kürze den Sachverhalt und meine Fragen darzulegen versuchte. Aber auch der Weg eines Telegramms war ein langwieriger und konnte ewig dauern. Dafür hatte es einen Preis, dem man durchaus das Prädikat unverschämt anhängen konnte.
Schließlich gab ich Pablo, dem Wirt der Bar El Ultim Bescheid und bat ihn, umgehend Álvaro, der die Bar ja nur in äußersten Notfällen verlies, zu mir zu schicken, wenn ein Anruf aus Deutschland an seinem Apparat auflaufen sollte.
Ich schrieb ihm die deutschen Worte >Bitte warten< und >kommt gleich< auf einen Zettel, die er sagen sollte, wenn am anderen Ende der Leitung eine Frauenstimme für ihn Unverständliches auf deutsch in die Sprechmuschel schrie. Aber schon nach einer kurzen Probe brach ich den Versuch wieder ab, da ich befürchtete, noch mehr Verwirrung anzurichten, als ohnehin schon im weiten Raum zwischen Mallorca und Deutschland stand. Pablo war ein guter Wirt, aber seine Begabung für andere Sprachen als català hielt sich in sehr eng gefaßten Grenzen. Obwohl er selbst ganz anderer Meinung war und mir versicherte, meine Mutter respektvoll, wie es ihr zukam, zu behandeln. Davon war ich reinen Herzens überzeugt, allerdings bezweifelte ich, daß meine Mutter die Ehrerbietung Pablos auch nur in Ansätzen heraushörte, geschweige denn, überhaupt etwas mitbekam von dem, was da verbal temperamentvoll aus ihm herausquoll.
Sodann begab ich mich nach Hause in die scheinbare Sicherheit meines Ohrensessels und hoffte, daß der unwillige Mensch vom Kolonialwarenladen in absehbarer Zeit meine Mutter erreichte, diese sich bei Pablo auch richtig verbunden wähnte und nicht gleich wieder auflegte, weil sie nichts von seinem Redeschwall verstand. Doch auch im Sessel fand ich keine Ruhe, die Unrast trieb mich um und wurde durch die Erkenntnis, nichts tun zu können, außer zu warten, noch verstärkt.
Nach wenigen Minuten begab ich mich ein Stockwerk höher in die Bibliothek und holte die Kladde mit den Haushaltsausgaben aus der oberen Schublade des Unterschränkchens. Der Rabe mußte ein sehr penibler Mensch gewesen sein, denn seine Aufzeichnungen der Ausgaben waren gründlich und akkurat, fast schon pedantisch zu nennen. Jeder einzelne, noch so kleine Posten, war ordentlich aufgeführt und erfaßt, ging in den Tagessaldo ein und der wiederum in die wöchentliche und monatlich Kumulation, man konnte jedes Samenkorn, das einmal gekauft worden war, fast bis auf seinen Ursprung zurückverfolgen. Nach dem Tod des gewissenhaften Buchhalters hatte seine esposa die Kladde nach seinem Vorbild weitergeführt.
Doch es waren ausschließlich die Ausgaben festgehalten, mit keinem noch so kleinen Tintenklecks war ein Bezug zu den Einnahmen hergestellt. Doch um etwas ausgeben zu können, waren Einnahmen zwingend notwendig. Es fiel mir in diesem Zusammenhang auf, daß ich nichts davon wußte, welchen Beruf Don Xavier ausgeübt, womit er seinen Lebensunterhalt verdient hatte. Ich nahm mir vor, Don Remigio heute Nachmittag danach zu fragen.
Seite um Seite durchblätterte ich das großformatige Buch, überflog Tage, Wochen, Monate und Jahre bis zum Ende der Aufzeichnungen am 31. Dezember 1931. Obwohl mir keinerlei Besonderheiten auffielen, hatte ich das Gefühl, irgend etwas übersehen zu haben. Doch als ich die Seiten erneut, rückwärts diesmal, wälzte, verstärkte sich zwar die Gewißheit, etwas Wichtiges sei meiner Beachtung entgangen, dem konkreten Ergebnis, um was es sich handelte aber kam ich dadurch auch nicht näher.
Nach einiger Überlegung kam ich auf die Idee, die Kladde sorgfältig Position für Position durchzuarbeiten, in der Hoffnung, dadurch eine Struktur der Ausgaben und eventuelle Auffälligkeiten erkennen zu können. Wenn ich zum Beispiel die Ausgaben einzelnen Sparten zuordnete, ließ sich schon recht einfach Gewöhnliches von Ungewöhnlichem trennen.
Es war mir durchaus bewußt, welchen Arbeitsaufwand ich betreiben mußte, ohne die Garantie für ein verwertbares Ergebnis zu haben. Dem gegenüber standen die wenigen Möglichkeiten, die ich überhaupt hatte, den Dingen auf die Spur zu kommen. Die Kladde war eine davon, wenn auch eine vage, die lediglich auf einem Gefühl in meinem Inneren beruhte, aber immerhin, es war eine. Außerdem hatte ich jede Menge Zeit, konnte meine botanischen Ausflüge einstellen oder zumindest reduzieren, hatte eine komfortable Dachterrasse, auf der ich in angenehmer Umgebung arbeiten konnte und, ganz wichtig, ich war in der privilegierten Situation, von finanziellen Zwängen völlig unabhängig zu sein. Alles in allem, schien es mir, waren die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entschlüsselung der mallorquinischen Geheimnisse, von denen ich mich umgeben sah, sehr günstig, ich mußte sie nur richtig einsetzen. Und Arbeit hatte mich noch zu keiner Zeit geschreckt.
Voller Eifer verließ ich das Haus und bat in der Bar El Ultim den dort ständig sitzenden Álvaro, mir in der botiga der Senyora Luengo, die an der Placa d’ Espanya Zeitungen und Schreibwaren zum Kauf anbot, ausreichend Papier und Stifte zu besorgen, damit ich meinen Vorsatz noch heute in die Tat umsetzen konnte. Ich selbst wollte in der Bar auf den Rückruf meiner Mutter warten, den ich unter keinen Umständen versäumen durfte.
Erfreut, mir mit einem kleinen Dienst gefällig sein zu können, ging Álvaro sofort los und kam schon kurze Zeit später mit einem ansehnlichen Packen Schreibpapier und einer Holzkiste voller Stifte zurück, was er mir beides stolz präsentierte. Als Dank für den Botengang bestellte ich für Álvaro eine Flasche Wein bei Pablo und eilte dann mit meinen neu erworbenen Schätzen in mein heimisches Refugium zurück. Dort angekommen, schleppte ich Papier, Stifte und Kladde auf die Dachterrasse und wollte mit der Arbeit beginnen, da hörte ich unten auf der Straße den Sohn Pablos laut schreien.
„Don Diego, Don Diego, schnell, kommen Sie, ein telefònica aus alemany, man verlangt Sie am Hörer, kommen Sie schnell, es eilt, Don Diego, hören Sie…“
Ich sprang die Treppen hinunter und war in weniger als einer Minute in der Bar El Ultim, Pablo sprach mit einem völlig unverständlichen Kauderwelsch voll Inbrunst auf den Hörer ein, den er in seiner rechten hielt und gestikulierte dabei wie angestochen mit dem linken Arm. Allem Anschein nach hielt er sein Geschwätz für deutsch und wunderte sich, daß man ihn am anderen Ende der Leitung nicht verstand. Ich riß ihm den Telefonhörer aus der Hand und schrie hinein.
„Mutter, hier ist Jakob, schön, daß Du zurückrufst, es ist dringend.“
„Warum schreist Du denn so“, schrie nun ihrerseits meine Mutter ins Telefon, „erstens bin ich nicht taub und zweitens möchte ich wissen, wer der nette Herr war, mit dem ich eben längere Zeit das Vergnügen hatte. Offensichtlich wohl ein Ausländer, sein deutsch läßt sehr zu wünschen übrig. Sag ihm das bitte. Aber ansonsten war er schon charmant, sehr kultiviert. Was willst Du wissen, fasse Dich kurz, weißt Du eigentlich, was so ein Telefongespräch nach Spanien kostet? Du hast ja keine Vorstellung.“
„Doch Mutter, ich weiß, was so ein Gespräch kostet. Sag mir wo Du bist und ich rufe Dich sofort zurück.“
„Deshalb kostet das Gespräch doch nicht weniger. Ob ich Dich nun anrufe oder Du mich, ist den Kosten doch vollkommen egal. Oder bekommst Du irgendwelche Prozente?“
„Nein Mutter, ich bekomme keine Prozente. Bitte beantworte mir eine Frage, auch wenn sie Dir im Moment vielleicht komisch vorkommt. Ich erkläre Dir dann alles in einem Brief, versprochen. Also, weißt Du, ob Großvater je auf Mallorca war und wenn ja, wann das gewesen ist? Bitte Mutter, es ist wichtig für mich. Sehr wichtig.“
„Wer soll wann wo gewesen sein? Ich weiß nicht, was das soll.“
„Ich muß wissen, ob Großvater jemals hier auf Mallorca gewesen ist und wann das ungefähr war. Es ist wichtig, sehr wichtig.“
Ich schrie jetzt mit aller Stimmkraft in den Hörer. Pablo, Consuela, ihr Sohn und Álvaro schauten mich interessiert an. Aus der Küche hatte Bienvenida ihren Kopf durch die Tür gesteckt.
„Ich weiß wirklich nicht, warum Du mich diese Dinge fragst. Was ist so wichtig daran, ob Dein Großvater selig in Spanien war oder woanders? Er ist lange tot, lassen wir ihn in Frieden ruhen.“
Langsam bekam ich den Eindruck, meine Mutter wollte aus irgendeinem Grund nicht mit der Sprache heraus. Was war so Geheimnisvolles an den Reisen ihres Vaters?
„Mutter, bitte, ich erkläre Dir alles später. Was ist nun, war er oder war er nicht?“
Es entstand eine Pause, meine Mutter antwortete nicht, schien zu überlegen. Man hörte nur ein Rauschen in der Leitung. Von irgendwoher quakten Stimmen undeutlich in fremder Sprache durch die Sphären. Dann war die Stimme meiner Mutter wieder da. Ihr Tonfall ein anderer als zuvor, gequält, so als müßte sie sich zu einer Antwort zwingen.
„Ja, Dein Großvater war in Spanien. Ob er auch auf Mallorca war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, er hat nie darüber gesprochen. Er hat überhaupt sehr wenig gesprochen, nachdem er wieder zu Hause war. Meistens hat er nur in seinem Zimmer gesessen und vor sich hin gegrübelt. Er ist ein komplett anderer Mensch gewesen seit dieser, seiner letzten Reise. Es war die Zeit der Jahrhundertwende, etwa ein Jahr nach seiner Rückkehr nach Deutschland ist er dann gestorben, das war 1902 im April. Du warst gerade zwei Jahre alt, hast ihn ja nicht mehr kennengelernt, Deinen Großvater selig…“
Die Stimme meiner Mutter erstarb, ich hörte allerlei Geräusche in der Leitung. Ich schrie erneut mit aller Kraft den Hörer an, wollte eine Trennung des Gesprächs verhindern.
Die Aufmerksamkeit meines Publikums erreichte ebenfalls einen Höhepunkt, man nahm teil am Geschehen, auch wenn es sich aus Sicht meiner Zuhörerschaft um ein Einmannstück handelte, schien meine Vorstellung einigermaßen dramatisch bei ihnen anzukommen. Vielleicht dachten sie, ich kämpfe aus irgendeinem Grund um meine große Liebe.
In der Leitung war nur noch Rauschen, meine Mutter hatte aufgelegt. Als auch ich den Hörer auf den Apparat an der Wand legte, klatschte Consuela Beifall, Pablo nickte und Álvaro und Bienvenida hauchten im Chor „meravellós“, wobei sie mich fast ehrfürchtig ansahen.
Ungefragt hatte Pablo mir einen Kaffee auf die Theke gestellt. Ich trank in kleinen Schlucken, wollte zahlen, aber Pablo bedeutete mir, meine Vorstellung sei ihm Lohn genug und fragte nur, wann ich heute Abend zum sopar käme. Er hatte schon einen gewissen schlitzohrigen Humor, der Wirt der Bar El Ultim, das mußte ich neidlos anerkennen.
Nachdenklich ging ich nach Hause. Die Art, wie meine Mutter eine Antwort zuerst hinauszögerte, dann stockend und bedrückt, so schien es mir wenigstens, doch eine Antwort gab, eine Antwort allerdings, die mehr neue Fragen aufwarf denn sie alte klärte, hatte für mich etwas Unverständliches. Über meinen Großvater wurde in unserer Familie nie groß geredet und da ich ihn nicht kannte, stellte ich auch kaum Fragen nach ihm. Ich wußte nur, daß er sehr wohlhabend gewesen sein mußte, denn er ging keiner geregelten Arbeit nach, sondern reiste einen Großteil seines Lebens durch die Welt. Sein Erbe verhalf unserer Familie zu einem ähnlich sorglosen Leben. Erst jetzt fiel mir auf, daß ich nichts über die Umstände seines Todes wußte. Als er starb, war mein Großvater gerade 52 Jahre alt, kein Alter um ins Schattenreich zu wechseln.
Ich setzte mich auf die Dachterrasse und schrieb meiner Mutter einen längeren Brief, in dem ich ihr alle die Dinge mitteilte, die zu meiner Frage geführt hatten. Aus ihrer telefonischen Antwort hatten sich nun weitere Fragen ergeben, die ich sie bat, mir baldmöglichst zu beantworten. Als ich den Brief beendet hatte, verschloß ich das Kuvert, beschriftete es mit Adresse und Absender und gab ihn im oficina de correus zur schnellstmöglichen Beförderung auf. Aus der Erfahrung heraus wußte ich, daß der Brief etwa eineinhalb, eher zwei Wochen benötigte, ehe meine Mutter ihn in den Händen hielt. Wenn sie meiner Bitte um Beantwortung unverzüglich nachkam, konnte ich mit ihrem Schreiben in etwa vier Wochen rechnen. Solange mußte ich mich in Geduld üben, aber ich hatte ja genug andere Sachen zu tun, um die mysteriösen Umstände einer Klärung herbeizuführen.
Als ich das oficina de correus verließ, fühlte ich mich um einiges leichter als bei meinem Eintritt.
Auf dem Rückweg in die Carrer Major traf ich Don Remigio, der zu unserer Verabredung wollte, die ich über die ganze Aufregung völlig vergessen hatte. Erst jetzt bemerkte ich, daß es schon nachmittags war.
Don Remigio teilte mir mit, daß er, mein Einverständnis vorausgesetzt, seinen Kollegen Don Basilio zu unserem Treffen hinzugebeten hatte. Don Basilio, erklärte er mir, wüßte besser über den Raben und die gesamte Familie Marrasca bescheid als er selbst und da er davon ausging, mich würden entsprechende Einzelheiten interessieren, habe er ohne vorherige Absprache in hoffentlich meinem Sinne gehandelt. Ich stimmte ihm lachend zu, erinnerte an das >te absolvo<, das ich ihm vorauseilend erteilt hatte und erzählte dann von den Ereignissen des Tages.
Wir hatten kaum auf der Dachterrasse Platz genommen und den ersten Schluck Wein genossen, da hörten wir schon Don Basilios fröhliche Stimme von der Carrer Major zu uns herauf schallen.
„Hola Don Diego, Remigio, wollt ihr einem armen Diener des Herrn keinen Einlaß gewähren? Was ist das für ein unchristliches Verhalten, Remigio, alter Heide“, gefolgt von dröhnendem Gelächter. Ich beeilte mich, seiner Aufforderung unmittelbar nachzukommen, eher er noch die ganze Straße zusammengeschrieen hatte.
Don Basilio war nur wenige Jahre älter als sein Kollege Remigio und betreute die Wallfahrtskirche, die etwas höher lag als die Pfarrkirche. Er war von rundlicher Gestalt, jedoch hochgewachsen, insgesamt eine stattliche Erscheinung, der man eine Vorliebe für gutes und vor allen Dingen reichliches Essen und Trinken durchaus ansah. Don Basilio war Festlandspanier, seit dem Priesterseminar aber hier auf der Insel tätig und vertrat die mallorquinischen Interessen vehementer und militanter als so mancher Eingeborene es tat. Wie er mir einmal erzählte, war er keineswegs freiwillig zu seinem geistlichen Beruf gekommen, sondern durch einen Entschluß seines Vaters, dem patro der Familie, der noch der alten Tradition anhing, einen seiner Söhne der Kirche zu schenken. Don Basilio fügte sich seinem Schicksal und wurde pare, nicht aus Glaube und Überzeugung, sondern aus rein materiellen Überlegungen, denn hätte er sich dem Willen des Vaters nicht gebeugt, wäre er enterbt worden und damit so arm wie die Mäuse, die sich im Holzgestühl seiner Kirche herumtrieben.
Also dachte er nach und sagte sich schließlich, kein Gebot kann so streng überwacht werden, daß es nicht umgangen werden kann und tat das, was er wollte, jedenfalls in gewissen, durchaus sehr großzügig definierten Grenzen. Mit dieser Einstellung kam er der seines Kollegen Don Remigio sehr nahe und das war auch mit ein Grund, warum sich beide so ausnehmend gut verstanden. Dieses Einvernehmen ging so weit, daß sie sich in gewissen Abständen abwechselnd eine mehrtätige Auszeit nahmen und jeder für sich verschwand, wer weiß, wohin, während der andere ihn in seiner Pfarrei vertrat. Kam der eine frisch erholt zurück, fuhr der andere ins Unbekannte. Keiner im Ort außer den beiden wußte, wo sie sich in dieser Zeit aufhielten und was sie taten. Anfangs zerrissen sich die Leute die Mäuler darüber, da man aber weder dem einen noch dem anderen irgend etwas Unrechtes nachsagen konnte, nahmen sie es schließlich als gegeben hin und interessierten sich nicht weiter dafür. Eines Morgens war der eine weg, eines anderen Morgens wieder da. Und kurze Zeit später verschwand der andere in ähnlicher Manier.
Ebenso wie sein Kollege Remigio war Don Basilio, sieht man einmal von seiner professió ab, ein über alle Maßen angenehmer Zeitgenosse, der nicht nur wußte, in welche Richtung die Erde sich drehte, sondern der sich, wenn es darauf ankam, auch gegen den Wind stemmte, der ihm hin und wieder ins Gesicht blies. Darüber hinaus war er nicht nur über den allgemeinen Durchschnitt gebildet, sondern auch so klug, dies nicht jeden anderen gleich fühlen zu lassen.
Nachdem er sich zu uns auf die Dachterrasse durchgekämpft hatte, belohnte er diese Anstrengung seines Körpers erst einmal mit einem sehenswerten Schluck Wein, bekundete lautstark sein Wohlbehagen und fragte dann, wie er uns helfen könne.
Don Remigio erzählte ihm in großen Zügen von meinem Erbe und den Begleitumständen, die damit verbunden waren oder sich aus der Hinterlassenschaft ergeben hatten und bat ihn dann um Auskunft über die Person Xavier Marrasca, den man den Raben nannte.
Don Basilio nickte, erklärte sich selbstverständlich bereit, mich mit seinem Wissen zu unterstützen und fragte, ob er vielleicht das Schreiben Don Xaviers an mich lesen könnte, bevor er selbst über den Raben berichten würde.
Natürlich konnte er, ich holte das Schreiben und Don Basilio vertiefte sich darin, schmunzelte ab und zu und schüttelte an einer Stelle leicht seinen Kopf. Dann gab er mir die Papiere zurück, nahm einen weiteren Schluck Wein und sprach:
„Eins ist sicher, das Schreiben ist echt. Nicht nur ist es die Handschrift des Raben, so weit ich sie noch in Erinnerung habe, sondern auch ein Inhalt, wie er nur von ihm stammen kann, so etwas kann man nur schwer fälschen oder kopieren. Schon gar nicht die kleinen Halbwahrheiten und gekonnten Auslassungen, aber darauf komme ich später zurück, zunächst will ich etwas von Don Xavier Marrasca erzählen, der hier im Ort von jedem nur respektvoll el corb, der Rabe, genannt wurde.
Entgegen der Annahmen vieler stammte Don Xavier nicht aus Artà, obwohl er diese Tatsache zeitlebens gerne verschwieg. In Wirklichkeit ist er aus einem kleinen Nest in der Nähe des Puig d’ es Moix in der Serra de Tramuntana gebürtig. Ein, nun, ich will mal sagen, recht eigenwilliges Bergvölkchen war das damals, solange ist es noch gar nicht her, daß die Gegend dort bewohnte und auch manchmal unsicher machte. Die einen sagten, sie seien zurückgeblieben, weil von der Zivilisation abgeschnitten, die anderen hielten sie schlicht für Wilde, die nicht viel mehr zustande brachten, als an ihren Berghängen herumzuklettern und sich ansonsten von rohem Fleisch zu ernähren. Ich halte beide Meinungen nicht für richtig, der Rabe bewies eher mehr denn weniger meine Theorie.
Don Xavier kam gegen Ende der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts nach Artà, genau weiß ich es nicht, denn ich selbst war damals noch nicht in der Stadt. Eines Tages stand er auf der Placa d’ Espanya und war einfach da.
Der alte Jaume, einer der wenigen noch Lebenden aus dieser Zeit, behauptet, ihn als Erster gesehen zu haben und schwört, der Rabe hätte damals schon einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und einen gelben Strohhut mit schwarzem Band getragen. Auch wenn der alte Jaume inzwischen die zweite Hälfte seiner neunziger Jahre ansteuert und des öfteren wirre Merkwürdigkeiten von sich gibt, erscheint mir seine Darstellung von der Ankunft des Raben durchaus glaubhaft. Aber die Details dessen sind wohl eher zweitrangig, obwohl man hierzulande, das sollten Sie wissen, Don Diego, gerade auf Einzelheiten und die Möglichkeiten, diese auszuschmücken, allergrößten Wert legt.
Als er von den Bergen herabgestiegen war, hieß er auch noch nicht Marrasca, diesen Namen hat er erst später, etwa ein Jahr vor seiner Hochzeit mit der jungen Maria Campillo angenommen. Ich selbst kenne keinen Menschen, der weiß, welchen Namen Don Xavier von Geburt an getragen hat.
Vielleicht hatte er nur seinen Vornamen, die Bevölkerung in den abgelegenen Bergdörfern lebte damals zum Teil noch unter recht archaischen Verhältnissen. Da war ein Nachname ohne Wert, man kannte sich ohnehin in der kleinen Gemeinschaft des Dorfes. Vielleicht wollte er seinen richtigen Namen auch bewußt nicht nennen. Die Leute in den Bergen gingen nicht immer ganz realen Geschäften nach, Schmuggel und Wegelagerei waren beliebte Erwerbsquellen. Da konnte es durchaus von Vorteil sein, keinen Namen zu haben. Und Xavier, ja, Xavier hießen viele hier auf der Insel. Aber das sind alles nur Vermutungen, durch nichts bewiesen. Schließlich bin ich der Letzte, der einem Toten Dinge, die er nicht zu verantworten hat, in die nunmehr leeren Schuhe schieben will. Da sei mein geistlicher Stand vor.“
An dieser Stelle kicherte Don Remigio, ich muß schon sagen: frech in die Runde, aber sein Kollege beachtete die kleine Provokation nicht weiter und fuhr stattdessen in seiner Erzählung fort.
„Ich selbst bin 1888 als junger Priester nach Artà gekommen und habe natürlich alle Honoratioren der Stadt, darunter auch Don Xavier, schnell kennengelernt, das war unvermeidlich. Nach einiger Zeit fiel mir auf, daß der Rabe keinem eigentlichen Beruf nachging, will sagen, er übte weder ein Handwerk aus, noch hatte er nennenswerten Grundbesitz, von dem es sich auskömmlich leben ließ. Dennoch gehörte er zu den wenigen Begüterten des Ortes. Er protzte nicht mit seinem Vermögen, er schmiß mit dem Geld nicht um sich, war aber auch nicht kleinlich, wenn er die Kirche, die Stadt oder die Armen regelmäßig mit großzügigen Zuwendungen bedachte. Schon zu dieser Zeit fragte ich mich oft, woher die Wohlhabenheit Don Xaviers wohl stammen könnte, bin aber nie dahinter gekommen.
Selbst der alte Pedro Campillo, sein Schwiegervater, hat immer nur bedeutungsvoll die Brauen hochgezogen, wenn das Gespräch auf die pekuniären Quellen des Mannes seiner Tochter kam, aber gesagt hat er nichts. Vielleicht hat er aber auch nichts gewußt oder sich bewußt nicht darum gekümmert, denn er sah seine Tochter gut versorgt und er selbst lebte auch nicht schlecht in der materiellen Sicherheit, die sein Schwiegersohn garantierte.
Noch als Junggeselle war der Rabe oft auf Reisen quer über die Insel. Später, als verheirateter Mann hielt er es ebenso, häufig nahm er seine Frau, Dona Maria, mit sich. Die beiden führten auch nach heutigen modernen Verhältnissen ein komfortables, manche würden sagen: aufregendes Leben und schienen bar jeglicher Sorgen zu sein. Jedenfalls jeglicher finanzieller Sorgen, was sonst noch gewesen sein mochte, fand, wenn überhaupt etwas war, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit statt.
Kurz nachdem Don Xavier in Artà angekommen war, machte er Maria Campillo den Hof, die ja auch wenige Jahre später seine Frau wurde und Ihnen, Don Diego, als Dona Maria wohl bekannt sein dürfte. Maria Campillo muß damals eine außergewöhnliche Schönheit gewesen sein, auf die die heiratsfähigen Männer der Stadt geradezu versessen waren. Aber gegen den Raben hatte kein anderer eine Chance.
Ich glaube, 1875 heirateten die beiden und aus Maria Campillo wurde Dona Maria Marrasca. Sie zogen in das Elternhaus von Dona Maria, bewohnten einen Teil der oberen Etagen, eben dasselbe Haus, das Sie geerbt haben und jetzt bewohnen.
Und hier kommt auch eine dieser kleinen Unrichtigkeiten zutage, mit denen der Rabe kokettierte und ab und an eine Kurve begradigen wollte. In seinem Brief an Sie, Don Diego, schreibt er sinngemäß vom Haus seiner Väter. Er hat aber erst in die Familie Campillo, der das Haus seit etlichen Generationen gehörte, hineingeheiratet. Ich habe das überprüft, es kann also nicht das Haus seiner, Don Xaviers, Väter gewesen sein.
Aber das sollte uns in der Betrachtung und Beurteilung seiner Person nicht weiter beeinträchtigen. Derlei Dinge sind bei uns an der Tagesordnung, damit nimmt es unser Menschenschlag hier nicht so ganz genau. Eine Weile regt man sich auf, dann ist alles vergessen und man akzeptiert das Gewünschte. Es schadet ja auch niemandem. Ja, das Ehepaar Marrasca lebte in Wohlstand zufrieden vor sich hin, nahm an den gesellschaftlichen Ereignissen unseres kleinen Städtchens teil, richtete sogar draußen vor der Stadt alljährlich eine große festa aus, und war überall wohlgelitten. Besonders Don Xavier schätzte man ob seiner Besonnenheit und seiner Klugheit. Deshalb in erster Linie auch sein Beiname der Rabe, den man ihm verliehen hatte, die ständige schwarze Kleidung und der gelbe Strohhut waren nur eine passende Beigabe.
Natürlich gab es, wie überall auf der Welt, auch hier Neider und böse Zungen. Aber das waren unbedeutende Randerscheinungen, die keiner ernst nahm. So ist es doch immer, wenn Eifersucht und Neid sich paaren, Sie kennen das sicher, Don Diego.
Ja und dann kam das unglückselige Jahr, in dem der Rabe starb. Die Tatsachen sind ja bekannt, er fuhr, wie er es häufig tat, mit seinem Boot von Canyamel aus hinaus aufs Meer, ein Sturm kam überraschend auf und Dan Xavier ertrank jämmerlich. Am nächsten Tag fanden Fischer Teile seines zerschmetterten Bootes am Strand. Zwar wurde seine Leiche nie irgendwo angeschwemmt, aber das hat nicht viel zu sagen, dafür kann es hunderte Erklärungen geben.
Im Ort meinten einige, mit den Geschäften des Raben sei es nicht mehr so gut gelaufen und er habe deshalb Hand an sich selbst gelegt.
Ich halte das für eine gewagte, nicht zutreffende Vermutung. Nichts, aber auch gar nichts wies darauf hin, daß es ihm schlecht ging. Kurz zuvor hatte er mit seiner Gattin noch eine längere Reise nach Barcelona unternommen. Ganze zwei Monate blieben sie auf dem Festland und schienen sich ausgiebig amüsiert zu haben. Dona Maria schwärmte noch Jahre danach von dieser Reise. Und kurz nach ihrer Rückkehr nach Artà geschah dann das Unglück. Nein, ich bin mir sicher, Don Xavier hat keinen Selbstmord begangen. Dazu war er einfach nicht der Typ. Und womit er sein Leben bestritt, wußte ja keiner. Niemand kannte seine Geschäfte.
Außerdem, so schlecht kann es ihm offensichtlich nicht gegangen sein, auch nach seinem Ableben hat Dona Maria die Zuwendungen an die Kirche, die Stadt und die Armen der Gemeinde fortgeführt und zwar über ihren eigenen Tod hinaus, entsprechende Verfügung über großzügige Schenkungen waren in jenem Teil des Testaments, das Sie nicht betraf. Lediglich die alljährlichen festas vor der Stadt hat sie nach dem Tod ihres Mannes nicht mehr veranstaltet. Aber das erscheint mir durchaus verständlich, obwohl ich glaube, sie tat das mehr aus Rücksicht auf das Gerede der Leute, denn aus Pietät ihrem espos gegenüber.
Überdies, bitte nehmen Sie mir den kommenden Satz nicht übel, Don Diego, aber Sie selbst partizipieren, nach allem, was man hört, auch nicht schlecht von der Hinterlassenschaft Don Xaviers.
Nein, ich bleibe dabei, sein Tod war ein bedauerliches Unglück, so wie es leider täglich auf der ganzen Welt vorkommt. Man sollte keine verschwörerischen Theorien darum spinnen.
Was bleibt, sind das schöne Haus in der schönsten Stadt Mallorcas“, Don Basilio lachte vergnügt auf, „und natürlich das Geheimnis um den Reichtum des Raben. Aber ich habe von jeher die Meinung vertreten, der Mensch muß nicht alles und jedes ergründen. Nehmen Sie es so hin, wie es ist. Solange sich keine Verdachtsmomente auftun, die auf irgendwelche Unrechtmäßigkeiten hinweisen.
Und selbst dann, nennen Sie mir ein Vermögen, das auf rechtmäßige Art und Weise erworben wurde. Das eine schließt das andere aus. Genauso radikal übrigens, wie der berühmte Herr Teufel angeblich das Weihwasser meidet. Es mag Sie vielleicht erstaunen, diesen Satz aus dem Munde eines capellà zu hören, aber Sie kennen ja meine unkonventionelle Einstellung bestimmten Dingen gegenüber. Hab ich recht, Remigio?“
Damit beendete Don Basilio seine Rede, nahm einen großen Schluck Wein, wischte sich mit dem Ärmel über den Mund (es mußte sich um eine unter den Geistlichen der Insel verbreitete Unsitte handeln) und lächelte zufrieden in unsere kleine Runde.
Don Remigio nickte versonnen.
„Zeigen Sie doch dem Kollegen die beiden Fotografien, über denen wir den gestrigen Abend verbracht haben. Vielleicht weiß er, um welches Café es sich handeln könnte“, wandte er sich an mich.
Da ich sowieso neuen Wein holen mußte, stieg ich ins Haus hinab und holte auch gleich die Bilder. Don Basilio besah sie sich lange, schüttelte dann aber den Kopf.
„Ich würde mich dazu hinreißen lassen, die Behauptung aufzustellen, es handelt sich um ein spanisches Café. Ein Gefühl, mehr nicht. Ob es aber hier auf Mallorca oder auf dem Festland liegt, vermag ich beim besten Willen nicht zu sagen. Ist das wichtig? Aber weil wir nun einmal dabei sind, wer ist der Herr im Hintergrund, der so aussieht wie Sie, Don Diego?“
„Nun, ich vermute einmal, es handelt sich bei dem großen Unbekannten um meinen Großvater. Verschiedene Anhaltspunkte weisen darauf hin. Und an dieser Stelle setzt auch mein Interesse an der ganzen Sache ein. In welcher Verbindung stand mein Großvater zu den Marrascas? Alle drei Personen auf den Bildern sind tot, ich kann keinen von ihnen mehr befragen. Natürlich kann alles nur ein blöder Zufall sein, aber wenn ich das Schreiben Don Xaviers an mich und mein Erbe bedenke, glaube ich einfach nicht an eine Laune des Schicksals. Ich bin davon überzeugt, sobald ich hinter diesen Zusammenhang komme, lüfte ich auch das Geheimnis meines Erbes. Vielleicht sogar noch weitere Dinge, von denen wir jetzt noch nichts wissen.
Sie sagten gerade, Don Basilio, der Rabe hätte vor seinem Tod zwei Monate zusammen mit seiner Frau in Barcelona verbracht. Auch mein Großvater war zu dem fraglichen Zeitpunkt zumindest in Spanien, warum also nicht in Barcelona? Können Sie sich vorstellen, daß diese Aufnahmen dort in Barcelona entstanden sind?“
„Natürlich kann ich das. Sie können sehr gut in Barcelona entstanden sein, allerdings, das muß ich der Vollständigkeit halber hinzufügen, ebenso gut in Valencia, Sevilla, Madrid, Salamanca oder in jeder anderen Ansiedlung, in der es ein Straßencafé gibt. Wissen Sie, wie viele Etablissements dieser Art es in unserem geliebten Heimatland gibt? Wir Spanier sind besessen davon, ein Leben ohne die Straße ist für uns nicht denkbar. Der Rabe ist viel gereist, manchmal hat er seine Frau mitgenommen. Da die Fotos nicht datiert sind, können wir sie leider nicht zuordnen.“
Das mußte ich einsehen und tröstete mich mit dem Antwortschreiben meiner Mutter, das ich in einigen Wochen in den Händen zu halten hoffte.
Sodann erzählte ich den beiden capellàs von meinem Vorhaben, die Haushaltskladde genauestens auf etwaige Besonderheiten und Hinweise zu untersuchen. Sowohl Don Remigio als auch Don Basilio bestärkten mich darin, verwiesen allerdings ehrlicherweise auch auf die ungeheure Arbeit, die dies für mich bedeutete. Andererseits stimmten sie mir zu, daß die Kladde der einzige Angriffspunkt wäre, der mir derzeit zur Verfügung stand. Bis das Antwortschreiben meiner Mutter eingetroffen war, konnte ich ohnehin nichts anderes unternehmen. Es sei denn, zwischenzeitlich passierte etwas Unvorhergesehenes.
Mittlerweile war die Zeit gekommen, in der wir gewöhnlich das Nachtessen einnahmen. Also tranken wir die Neigen unserer Weingläser und begaben uns dann in die Bar El Ultim, in der Consuela schon unseren angestammten Tisch entsprechend eingedeckt hatte.
Zum Zeichen der Dankbarkeit, daß beide pares sich meiner Probleme mit so viel Engagement annahmen, erbot ich mich, sie zu diesem Essen einzuladen, was sie erfreut akzeptierten. Es war die Geste, die sie zu schätzen wußten und nicht der finanzielle Vorteil, den beide nicht nötig hatten, denn sowohl Don Remigio als auch Don Basilio waren von Hause aus mit reichlichen Mitteln ausgestattet, an denen auch ihr geistlicher Stand nichts änderte.
Bienvenida hatte an diesem Abend eine llom amb col, eine Kohlroulade mit Schweinefleisch in einer köstlichen Sauce aus Wein, Speck, Rosinen und Pinienkernen zubereitet und kredenzte uns zum Nachtisch einen gató amb gelat d’ ametla, wobei es sich um einen Mandelkuchen mit eben solchem Eis handelte.
Álvaro aber saß, wie seit Wochen schon, auf seinem Stammplatz nahe der Küchentür und träumte von einer gemeinsamen Zukunft mit der begnadeten Köchin.