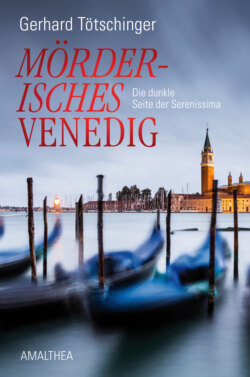Читать книгу Mörderisches Venedig - Gerhard Tötschinger - Страница 13
Die russische Gräfin
ОглавлениеReisen bildet, eine Binsenweisheit. Macht man Station in einem Restaurant und hat nichts zu lesen in der Tasche, kann man sich ärgern oder langweilen, nach einer Zeitung fragen – oder man liest eben, was einem nur ins Auge fällt, die Menükarte, mit scharfem Auge die Lektüre des Tischnachbarn. In der Bar des Hotel Ala am Campo Santa Maria del Giglio kann man das gerahmte Werk eines Gerichtssaalreporters lesen, eine Seite aus dem Gazzettino, der venezianischen Lokalzeitung.
Im Frühjahr 1910 erregt ein Prozess Alt und Jung, Arm und Reich in der Stadt an der Lagune. Das Schwurgericht und mit ihm die Gerichtssaalkiebitze und endlich auch die Zeitungsleser blicken in einen »solchen Abgrund von sittlicher Verworfenheit der hohen Gesellschaftskreise, daß man sich mit Betrübnis eingestehen muss, wir sind trotz unseres fortgeschrittenen Zeitalters von wahrer Kultur noch weit entfernt«. Erschüttert berichtet der Reporter Hugo Friedländer selbst ins ferne Berlin. Die von ihm zuletzt verfolgten Prozesse »beweisen, daß in gewissen Kreisen der sogenannten hohen Gesellschaft eine Fäulnis herrscht, von der sich der gesittete Mensch mit Ekel und Abscheu abwenden muß«.
Das kann er freilich nicht, wenn er sich mit dieser Fäulnis beruflich zu befassen hat, wie eben Friedländer. Er muss im Gegenteil sich so sehr mit der Verworfenheit der hohen Gesellschaftskreise beschäftigen, dass er seine Zeitungs-, später auch seine Buchseiten voll bekommt.
Noch intensiver befasst sich einer seiner Schriftstellerkollegen mit diesem interessanten Fall, Hans Habe. Ihm ist die Mordgeschichte um die irisch-russische Gräfin Maria Nikolajewna Tarnowska ein dreißig Jahre dauerndes Quellenstudium wert. Er studiert Expertengutachten, Polizeiprotokolle, Prozessakten, Briefe. Er will den Tatmotiven auf die Spur kommen, und weil er ja auch für sensationsgierige Illustrierte und ihr spezielles Publikum schreibt, wird das Dolce Vita im Russland der Jahre um 1900 ausführlich beschrieben, der Irrweg der verworfenen Gräfin durch feudale Datschen, vornehme Kurorte, Bordelle bis ins Gericht und in das Frauengefängnis von Venedig. Auch die im Jahr der Erscheinung von Habes Buch, 1962, noch in die Zukunft tastende weibliche Emanzipation macht er sich hier zum Thema, denn sie hat nach seiner Aussage »sexuelle Perversionen als Folgeerscheinung«.
Was also war geschehen? Die empörte Zeitung berichtet von einem »Weib der höchsten Gesellschaftskreise, dessen Wiege in einem feenhaften Schloß gestanden, das in üppigstem Luxus und Wohlstand erzogen, dessen Taten aber so entsetzlich waren, dass sich Tinte und Feder sträuben, sie niederzuschreiben«.
Schließlich hatte sie ja ihre erotische Macht missbraucht, um zwei Männer, mit denen sie ein Verhältnis hatte, zum Mord an ihrem künftigen Ehemann zu bewegen.
Selbst im Gerichtssaal soll sie keine Reue gezeigt haben, sie blieb selbstbewusst und hatte dazu wohl auch einen triftigen Grund. Ihre atemraubende Schönheit, die auch zur Basis ihrer Verbrechen geworden war, beeindruckte alle Zuhörer, nicht nur die Männer. Das ging so weit, dass einer der Geschworenen sich zu Wort meldete und sich für befangen und somit prozessunfähig erklärte. Sein Gewissen zwinge ihn zu dem Geständnis, dass er sein Richteramt nicht mehr mit der doch durch einen Schwur gelobten Unbefangenheit ausüben könne. Er habe sich mit aller Macht in die Angeklagte verliebt. Man musste ihn also austauschen.
Die Hauptangeklagte war am 16. Juni 1877 im väterlichen Schloss in der Nähe von Kiew zur Welt gekommen. Ihr Vater war der russische Adelsmarschall Graf Rusk. Mit fünfzehn Jahren kam sie in ein vornehmes Internat, der Vater hatte große Pläne. Maria Nikolajewna sollte dereinst einen Fürsten heiraten. Aber sie und das Schicksal entschieden anders.
Die sechzehnjährige Komtess hatte einen jungen Kosakenoffizier kennengelernt, Graf Wassili Wassiljewitsch Tarnowski, der sie unbedingt zur Frau haben wollte. Graf Rusk war dagegen, die Familie Tarnowski war ihm zu minder, die Tochter zu jung.
Aber diese Tochter setzte ihren Kopf durch, und das nicht zum letzten Mal. Sie ließ sich von ihrem Liebhaber entführen und heimlich heiraten. Damit begann nun ihre aufregende, wenngleich nicht glänzende Karriere. Ihre Schönheit fiel auch anderen Männern auf, und auch der Bruder ihres Ehemannes verliebte sich in Maria Nikolajewna. Als er erkannte, dass er chancenlos war, erhängte er sich.
Lang blieb Frau Tarnowska ihrem Kosaken nicht treu. Die lange Liste ihrer Liebhaber in den nächsten Jahren wurde von einem Grafen Tolstoi angeführt. Das brachte den Ehemann immerhin so sehr auf, dass er Tolstoi zum Duell forderte, das zwar für beide Kontrahenten harmlos ausging, doch nun kam der nächste Graf. Er hieß Borgewski und erklärte, er sei vor Liebe halb wahnsinnig. Tarnowski konnte ihn fernhalten, aber nur kurz, dann wollte auch der Neue sich um seine Ehefrau duellieren. Ein ebenfalls verliebter Baron Stahl, Freund beider Herren, konnte das durch Überredung verhindern. Stahl, der von Maria Nikolajewna nicht erhört worden war, machte seinem Leben bald selbst ein Ende.
Zum Duell kam es zwar nicht, aber Tarnowski schoss Borgewski eine Kugel in den Kopf und ließ sich verhaften. Das Schwurgericht in Kiew fällte aufgrund der besonderen Umstände einen Freispruch, doch inzwischen war Tarnowskis Verliebtheit abgekühlt und er ließ sich scheiden.
Die Gräfin sah nun ihre Freiheit in erreichbarer Nähe, ihre beiden Kinder bedeuteten ihr kein Hindernis. Das Angebot an potenziellen Liebhabern war nach wie vor bedeutend. Aber jetzt zuerst einmal die Scheidung, da brauchte sie einen guten Anwalt.
Sie fand ihn in Moskau, Dr. Donato Prilukow. Er war ein hervorragender Jurist, ein glänzender Redner. Seine Plädoyers waren berühmt, die Gerichtssäle waren überfüllt, wenn er ans Werk ging. Und zu alledem kam sein privates Glück – er führte eine vorbildliche Ehe, hatte zwei Kinder, verdiente sehr gut. Und dann kam Gräfin Tarnowska.
Prilukow war ebenso rasch in die neue Klientin verliebt wie schon viele vor ihm. Er zog fort von zu Hause, lebte mit der Gräfin in Saus und Braus, vernachlässigte Beruf und Kanzlei, und als er schließlich pleite war, hielt er sich an ihm anvertraute Kunden gelder. Das war nun der Tiefpunkt, die Anwaltskammer schloss ihn aus. Und auch die Geliebte verließ ihn bald, wenn auch nur vorübergehend, nachdem ihre Scheidung erfolgreich verlaufen war.
Maria Nikolajewna hatte dem nächsten Grafen den Kopf verdreht, Pawel Komarowski, schwerreich und verwitwet. Er machte der gerade Geschiedenen einen Heiratsantrag, sie willigte ein. Doch der Bräutigam beging einen schweren Fehler – er stellte seiner künftigen Gattin einen jungen Freund vor, mit Namen Nikita Naumow. Der war unter den Männern, was die Tarnowska unter den Frauen war – von auffälliger Schönheit und Anmut. Hinter dem Rücken des Freundes beziehungsweise Bräutigams Komarowski entwickelte sich in kurzer Zeit eine selbst für die erfahrene Frau ungewöhnliche Liebesbeziehung.
Der Tarnowska-Prozess in einer Zeitungsausgabe vom 13. März 1910, dargestellt von A. Beltrame
Naumow liebte es, sich von Frauen peinigen zu lassen, nicht einfach nur geistig etwas quälen, sondern körperlich. Die Tarnowska erfüllte ihm seine Wünsche – und hatte bald selbst schon sehr spezielle Wünsche an den jungen Geliebten.
Graf Komarowski hatte vor, auf eine Geschäftsreise zu gehen und sich auch um sein Haus in Venedig zu kümmern. Zuvor hatte er noch ihre Zusage zur Ehe erreicht, indem er die künftige Gattin zur Universalerbin erklärte. Außerdem ließ er vor der Abreise eine Lebensversicherung zu ihren Gunsten abschließen, die der Tarnowska bei seinem Ableben eine Million Rubel garantierte, selbst für den Fall, dass sie noch nicht verheiratet, nur verlobt sein sollte. Das war sein Todesurteil.
Maria Nikolajewna weihte Prilukow in ihren Plan ein – Komarowski sollte möglichst bald ums Leben kommen. Nun war der frühere Anwalt zwar immer noch einer ihrer Geliebten, aber so weit wollte er nun doch wieder nicht gehen und ihr zuliebe zum Mörder werden. Doch er diente ihr als Berater – Naumow sollte die Tat ausführen. Der werde wohl nicht so einfach zu überreden sein, Komarowski war ihm ein enger Freund. Das brachte Prilukow auf folgenden Gedanken: Die Tarnowska möge ein Telegramm erhalten, des Inhalts, dass er, Naumow, ein übler Charakter sei, von dem sie sich fernhalten sollte, Unterschrift – Graf Komarowski.
Das Telegramm schien seinen Zweck zu erfüllen. Naumow las es und tobte.
Er werde sich mit dem früheren Freund duellieren – das genügte der Tarnowska nicht, man müsste Komarowski umbringen. Nur so käme sie auch an das Geld, das sie zu ihrer Lebenshaltung dringend benötigte. Sonst bliebe ihr nichts übrig, als tatsächlich zu heiraten.
Nach längerem Zögern, auch Prilukow hatte geholfen, den jungen Mann zum Mord zu bewegen, gab er nach. Naumow reiste zusammen mit Prilukow nach Venedig und wartete die Ankunft Graf Komarowkis ab.
Am 3. September 1907 trafen die beiden Russen in Venedig ein. Naumow erkundigte sich, ob denn Graf Komarowski schon hier sei, das wurde bejaht. Er wartete erfolglos vor dem Haus, und als es Mitternacht war, ging er in sein Hotel.
Am nächsten Morgen ging er wieder in das Haus seines Opfers – und traf den Grafen an. Ohne ein Wort zu sagen, schoss er viermal auf ihn – und floh, fort aus Venedig, bis Verona.
Vier Tage später starb Komarowski. Die Polizei war überraschend schnell – Naumow wurde in Verona verhaftet. Er gestand auf der Stelle und gab auch die komplette Vorgeschiche, alle Hintergründe, preis. So konnte man auch Prilukow, die Tarnowska und ihre Kammerfrau Perier, eine Schweizerin, verhaften, die in alles eingeweiht gewesen sein soll.
Sie alle landeten in Venedig im Gefängnis, die Untersuchung dauerte lang. Endlich begann der Prozess, am 4. März 1910. Die vier Angeklagten wurden von insgesamt zehn Anwälten vertreten. Dazu kamen zwei Advokaten, die Komarowskis Mutter als Nebenklägerin privat engagiert hatte.
Mit zahlreichen Kiebitzen war zu rechnen – aber der Saal war zu klein. Selbst am Bahnhof von Santa Lucia kamen täglich neugierige Scharen an, die zum Schwurgerichtshof beim Campo Santi Apostoli strömten und dann enttäuscht vor dem überfüllten Gerichtsgebäude standen.
Die Russen hatten in den Jahren der Voruntersuchung so viel Italienisch gelernt, dass ein Dolmetsch kaum in Erscheinung trat. Naumow kam zuerst an die Reihe, er hatte längst alles gestanden und erging sich nun in Details. Immer wieder musste er seine Antworten und Erklärungen unterbrechen, weil er in Tränen ausgebrochen war und nicht sprechen konnte.
Und immer wieder geriet er in Streit mit der Tarnowska, die ihm vorwarf, er lüge. Nun kam es zum Verhör von Anwalt Prilukow – und auch er suchte Ausflüchte, die Tarnowska widersprach ihm, auch er weinte unentwegt.
Sie selbst erklärte dem Gericht, nun werde sie die komplette, ungeschminkte Wahrheit sagen. Ausführlich beschrieb sie ihre Kindheit, das Leben im vornehmen Internat, die Bekanntschaft mit Tarnowski. Immer wieder war sie, wie das damals in der eleganten Welt Russlands guter Ton war, nach Italien gereist, nach Genua, an die Riviera, nach Venedig, aber auch nach Franzensbad und in französische Kurorte. Und immer wieder ging es um Männer, um Verehrer, aber niemals war sie selbst an allen diesen Anträgen, Selbstmorddrohungen, Duellforderungen schuld.
Der Vorsitzende, begreiflich verwirrt durch die komplizierten erotischen Verwicklungen, die sich dem Auditorium darboten, versuchte immer wieder Klarheit zu schaffen.
»Sie haben also mit Naumow und Prilukow und Komarowski ein Quartett gebildet?«
»Ja, Exzellenz. Weil ich immer auf einen Menschen hoffte, der es ehrlich mit mir meint.
»Aber drei Liebhaber – das ist doch etwas viel, zur selben Zeit.« Im Saal herrschte kurz Heiterkeit, dann ging es weiter.
Tarnowska war bemüht, ihren früheren Anwalt Prilukow als Drahtzieher und Urheber der geplanten Mordaktion darzustellen. Detailreich und weitläufig schilderte sie, wie sehr sie gehofft habe, Naumow werde sich doch nicht zu der Tat überreden lassen. Zudem habe er ja Russland verlassen und sich eine Zeit lang im nahen österreichischen Podwolotschyska aufgehalten.
Der Vorsitzende ermahnte sie immer wieder, lauter und nicht überflüssig ausführlich zu sprechen.
Außer den Verhören der vier Angeklagten kam es noch zu zahlreichen weiteren Aussagen, von Zeugen, die man aus Russland geholt hatte, von den Ärzten, die den schwerverwundeten Komarowski behandelt hatten. Die russischen Zeugen, etliche von ihnen Juristen, versuchten den einstigen Kollegen Prilukow als zum Bösen verführten, aber im Grunde anständigen Menschen darzustellen. Andere wieder berichteten von Naumow, der zwar diese merkwürdige Neigung zum Masochismus gehabt habe, aber ein grundgütiger, hilfsbereiter junger Mann sei.
Breiten Raum nahmen die Berichte der Klosterschwestern ein, die die Tarnowska im Gefängnis bewachten und betreuten. Sie sei hochgradig hysterisch, leide unter Nervenkrisen, übe aber andererseits eine große Suggestivkraft auf die Menschen ihrer Umgebung aus.
Große Aufregung brachte die Ankunft der Mutter des ermordeten Grafen Komarowski, einer sehr vornehmen Dame von dreiundsechzig Jahren. Außer ihr waren noch der Vater Naumows ebenso wie der Vater der Tarnowska im Gerichtssaal, der alte Graf Rusk. Während Naumow senior unentwegt weinte, verstand der Vater der Angeklagten nur wenig von den Vorgängen, denn er sprach nicht Italienisch – im Gegensatz zur Mutter des Ermordeten.
Gräfin Komarowska hatte ihren Sohn immer wieder vor der Braut mit der bewegten Vergangenheit gewarnt – sie werde ihm kein Glück bringen und die Gesellschaft werde das künftige Ehepaar meiden.
Das Gericht hatte bei Fachärztes Gutachten zum Geisteszustand der Hauptangeklagten und der beiden Männer in Auftrag gegeben. So standen also jetzt auch der »Direktor des Irrenhauses von Venedig, Dr. Cappeletti«, der Psychiater Morselli aus Genua, Professor Dr. Tanzi, »Geisteskrankenarzt aus Florenz«, der berühmte Psychiater Prof. Dr. Bianchi aus Neapel und Professor Belmondo, Direktor der Klinik für Geisteskrankheiten an der Universität Padua, vor den Schranken.
Die Herren waren weitgehend einer Meinung. Das Abenteurerleben der Angeklagten habe ihre neurotische Anlage bis zur »Störung ihrer Seelenvorgänge gesteigert«, »moralische Anästhesie« sei eingetreten.
Wenige Tage später kam es zu den Strafforderungen des Staatsanwaltes, und danach zu langen, heftigen Auseinandersetzungen zwischen den vielen Rechtsanwälten. Jeder versuchte, seinen Schützling zu entlasten und die Schuld der anderen Angeklagten zu beweisen. Erfolg hatte nur der Anwalt der Schweizerin Perier.
Die Beratung des Schwurgerichts dauerte vier Stunden. Vor dem Gebäude standen Tausende und erwarteten die Urteile. Sie machten so großen Lärm, dass es in den Räumen schwer geworden sein soll, sich zu konzentrieren.
Naumow wurde zu dreieinhalb Jahren, die Tarnowska zu acht Jahren, Prilukow zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Perier kam ohne Strafe davon, man konnte ihr die Mitwisserschaft nicht nachweisen.
Das Urteil war gefällt, die Täter hatten ihre verdiente Strafe abzusitzen, die russische Gräfin kam ins venezianische Frauengefängnis auf der Giudecca. Das war bis 1806 ein Kloster der Benediktinerinnen gewesen, von der französischen Besatzungsmacht säkularisert.
Zwischen dem 28. Februar und dem 21. Mai 1910 wurden die Gerichtsreporter der venezianischen Zeitungen der Tarnowska-Berichte nicht müde, vor allem in der Gazzetta di Venezia.
Die Öffentlichkeit wandte sich danach neuen Skandalen, neuen Prozessen, neuen Untaten zu. Die Venezianer sollten dazu schon bald Gelegenheit haben. Denn an diesem 21. Mai 1910 geschah ein Verbrechen, das die Serenissima weit mehr betraf als der Fall der verruchten Russin. Doch dazu mehr in der Geschichte »Das mordende Haus«.