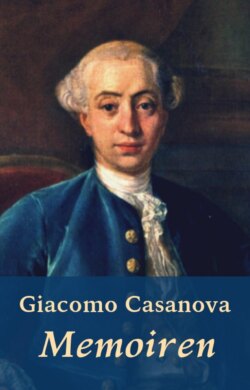Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 24
Neunzehntes Kapitel
ОглавлениеKleine Unglücksfälle, die mich nötigten, Venedig zu verlassen. – Erlebnisse in Mailand und Manua.
Am zweiten Ostertag besuchte uns Carlo mit seiner reizenden Frau, die mir in jeder Beziehung eine andere Person schien als Cristina. Allein das rührte von ihrer gepuderten Frisur her, die nicht die Ebenholzschwärze ihrer köstlichen Haare aufwog, und von ihrer Damenkleidung, die viel weniger anziehend war, als die einer reichen Bäuerin. Das Glück stand auf ihren Gesichtern geschrieben. Carlo machte mir zarte Vorwürfe, daß ich sie nicht ein einziges Mal besucht hätte, und um mein augenscheinliches Unrecht gutzumachen, besuchte ich sie am zweiten Tage darauf mit Herrn Dandolo. Carlo sagte mir, seine Frau werde von seiner Tante vergöttert und sei die beste Freundin seiner Schwester. Sie sei sanft, gefällig, teilnahmsvoll und habe ein sehr einschmeichelndes Wesen. Das machte mir das größte Vergnügen und beinahe ein ebenso großes empfand ich, als ich sah, daß Cristina sich mit der venezianischen Mundart vollkommen vertraut zu machen begann.
Wir fanden Carlo nicht zu Hause, Cristina war mit ihren beiden Verwandten allein. Wir wurden ausgezeichnet aufgenommen und als das Gespräch darauf kam, lobte die Tante ihre Fortschritte im Schreiben und forderte sie auf, mir ihr Heft zu zeigen. Wir gingen in das benachbarte Zimmer, wo sie mir sagte, daß sie glücklich sei und daß sie jeden Tag engelhafte Eigenschaften an ihrem Gatten entdecke. Er hatte ihr ohne den geringsten Zug von Argwohn oder Mißtrauen gesagt, er wisse, daß wir zwei Tage zusammen verbracht hätten, und er habe der wohlmeinenden Person ins Gesicht gelacht, die ihm diese dienstfertige Mitteilung gemacht habe, um ihr Glück zu trüben.
Carlo hatte alle Tugenden und die edlen Eigenschaften eines ehrenwerten und ausgezeichneten Menschen. Sechsundzwanzig Jahre nach seiner Heirat mußte ich mich an seine Börse wenden, und ich fand ihn als meinen wahren Freund. Ich habe niemals sein Haus besucht, und er wußte mein Zartgefühl zu schätzen. Einige Monate vor meiner Abreise von Venedig ist er gestorben; er hinterließ seine Witwe in guten Verhältnissen und drei wohlerzogene Söhne, die alle gut angestellt waren und vielleicht noch bei ihrer Mutter leben.
Im Monat Juni ging ich nach Pabua zum Jahrmarkt und befreundete mich dort mit einem jungen Mann meines Alters, der unter dem berühmten Professor Succi Mathematik studierte. Er hieß Tognolo, aber er änderte diesen übelklingenden Namen in Fabris. Er ist derselbe, der als Graf von Fabris und Generalleutnant Josephs des Zweiten in Siebenbürgen starb, wo er für diesen Herrscher kommandierte. Dieser Mann, der sein Glück seinen Tugenden verdankte, würde vielleicht in der Dunkelheit gestorben sein, wenn er seinen Namen Tognolo beibehalten hätte, der ein ganz bäurischer Name ist. Er stammte aus Oderzo, einem großen Flecken im venezianischen Friaul. Er hatte einen Bruder, der Abbate, ein geistreicher Mann und großer Spieler war und der, da er die Welt kannte, den Namen Fabris angenommen hatte, worauf auch der andere Bruder sich so nennen mußte, um ihn nicht Lügen zu strafen. Bald darauf kaufte er ein Lehen mit einem Grafentitel, wurde venezianischer Nobile und hörte auf, ein Bauer zu sein. Wenn er seinen Namen Tognolo beibehalten hätte, so würde ihm dieser Name Schaden bereitet haben, denn er hätte ihn niemals aussprechen können, ohne sich an das zu erinnern, was man nach dem verächtlichen Vorurteil eine niedrige Herkunft nennt. Die bevorrechtigte Klasse will in strafbarem Irrtum nicht glauben, daß in einem Bauer Größe und Genie sein könnten. Die Zeit wird zweifellos kommen, wo die Gesellschaft aufgeklärter und vernünftiger sein und erkennen wird, daß in allen Ständen edle Gefühle, Ehre und Heldentum sich ebenso leicht finden können, wie in einer Klasse, deren Blut nicht immer frei von dem Makel der Mesalliance ist.
Indem der neue Graf seinen Ursprung in Vergessenheit brachte, war er übrigens zu verständig, um ihn selbst zu vergessen, und bei allen von ihm unterzeichneten Urkunden ist sein Familienname immer neben seinem angenommenen Namen gestanden. Sein Bruder bot ihm zwei Wege an, die er für sein Fortkommen in der Welt einschlagen sollte, und ließ ihm die Wahl zwischen diesen beiden. Der eine wie der andere forderte eine Ausgabe von tausend Zechinen, aber der Abbé hielt diese Summe bereit. Es handelte sich für meinen Freund um die Wahl zwischen dem Schwert des Mars und dem Vogel der Minerva. Der Abbate war überzeugt, für seinen Bruder eine Kompanie in der Armee Seiner Kaiserlichen apostolischen Majestät kaufen oder ihm einen Lehrstuhl an der Universität Padua verschaffen zu können, denn Geld macht alles. Aber mein Freund, mit einem rechtschaffenen Sinn begabt und voll edler Gefühle, wußte, daß er sowohl in dem einen wie in dem anderen Fall Kenntnisse brauchte, um auf ehrenvolle Weise seine Laufbahn zu verfolgen, und studierte, bevor er eine Entscheidung traf, mit Erfolg die mathematischen Wissenschaften. Er entschied sich für die Laufbahn der Waffen, wie Achilles, der das Schwert der Spindel vorzog. Auch bezahlte er, wie der Sohn des Peleus, mit seinem Leben; allerdings starb er weniger jung als der Besieger Hektors und nicht an einem Pfeilschuß, sondern an der Pest, die er in dem unglücklichen Land erwarb, in dem das sorglose Europa den Türken erlaubt, sie fortzupflanzen.
Das vornehme Wesen, die edlen Gefühle, die Kenntnisse und die Tugenden von Fabris würden unter dem Namen Tognolo lächerlich geworden sein, denn so groß ist die Macht des Vorurteils, besonders bei denen, die sich nur auf einen dummen Hochmut stützen können, daß ein übelklingender Name in der dümmsten aller Welten seinen Träger herabwürdigt. Ich glaube, wer einen übelklingenden Namen trägt oder einen solchen, der an unanständige oder lächerliche Gedanken anklingt, sollte ihn ändern, wenn er auf Ehren, Beachtung und auf eine glückliche Laufbahn in Kunst und Wissenschaft Anspruch macht. Vernünftigerweise sollte ihm niemand dieses Recht bestreiten können, vorausgesetzt, daß der Name, den er annimmt, niemandem sonst gehört. Das Alphabet ist allgemeines Eigentum, und jeder ist frei, sich desselben zu bedienen, um ein Wort zu bilden und sich damit zu benennen. Aber er muß den Namen selber verfaßt haben. Voltaire würde trotz seinem Genie mit seinem Namen Arouet vielleicht nicht auf die Nachwelt gekommen sein, und besonders bei einem Volke, wo Zweideutigkeit und Lächerlichkeit stets in erster Reihe stehen. Wie hätte man in einem Schriftsteller, der à rouer (zu rädern) war, einen großen Mann finden können? Und würde d’Alembert seinen hohen Glanz und seine Berühmtheit erreicht haben, wenn er sich begnügt hätte, Herr Le Rond oder der Runde zu sein? Welches Aufsehen würde Metastasio unter seinem wahren Namen Trapasso gemacht haben? Welchen Eindruck würde Melanchthon mit seinem Namen Schwarzerde hervorgerufen haben? Würde er es gewagt haben, als Moralphilosoph und als Reformator der Eucharistie und so vieler anderer heiliger Dinge zu sprechen? Und hätte Herr von Beauharnais nicht die einen zum Lachen und die anderen zum Erröten gebracht, wenn er feinen Namen Beauvit beibehalten hätte, selbst wenn der erst seiner alten Familie der Wirklichkeit dieses Namens sein Glück verdankt hätte? Würden die Bourbeur (die Kotigen) auf dem Throne eine so schöne Figur gemacht haben wie die Bourbons? Die Coraglio würden sicher den Namen wechseln, wenn sie sich in Portugal niederlassen würden. Der König Poniatowski hätte, denke ich, den Namen Augustus, den er bei seiner Thronbesteigung angenommen hatte, ablegen sollen, als er auf die Königswürde verzichtete. Nur die Coleoni von Bergamo würden in Verlegenheit sein, wenn sie ihren Namen ändern sollten, denn sie wären gleichzeitig verpflichtet, das Zeichen ihres Wappens zu ändern, da sie auf dem Schild ihrer alten Familie die Hoden führen, und müßten dadurch den Ruhm des Helden Bartolomeo, ihres Ahnherrn, zerstören!
Gegen das Ende des Herbstes stellte mich mein Freund Fabris einer Familie vor, die so recht geschaffen war, Herz und Geist zu erquicken. Sie wohnte auf dem Lande in der Gegend von Zero. Es wurde gespielt, geliebelt, und man bemüht sich, gegenseitig sich Streiche zu spielen. Diese waren manchmal sehr derb; aber die Tapferkeit erforderte, über nichts böse zu werden, über alles zu lachen, denn wer keinen Scherz verstand, galt für einen Dummkopf.
Man ließ Betten zusammenfallen, ließ Gespenster erscheinen, man gab den jungen Damen harntreibende Pillen oder Zuckerplätzchen und zuweilen solche, von denen Blähungen erzeugt wurden, die man nicht zurückhalten konnte. Diese Scherze gingen manchmal ein bißchen weit, aber so war nun einmal der Geist der Gesellschaft: es sollte durchaus gelacht werden. Ich war im Handeln wie im Dulden nicht weniger tapfer als die anderen. Aber schließlich spielte man mir einen nichtswürdigen Streich, und dieser gab mir einen anderen ein, dessen schlimme Folgen der Manie, die alle Welt ergriffen hatte, ein Ende machten.
Wir machten gewöhnlich einen Spaziergaug zu einem Pachtgut, das auf dem gewöhnlichen Wege eine halbe Meile entfernt lag. Man kürzte den Weg aber um die Hälfte ab, wenn man auf einem schmalen Brett einen tiefen und kotigen Graben überschritt, und diesen Weg schlug ich immer ein trotz der Furcht unserer Schönen, die vor Angst zitterten, obwohl ich ihnen immer vorausging und ihnen von drüben die Hand reichte. Eines schönen Tages, als ich zuerst hinübergehe, um den Damen Mut zu machen, weicht das Brett ungefähr in der Mitte plötzlich unter mir, und ich liege in dem Graben, in einem stinkenden Kot eingehüllt, der mir bis zum Kinn geht, und trotz der Wut, die ich im Grunde des Herzens spüre, muß ich nach üblichem Brauch in die allgemeine Heiterkeit einstimmen, die indessen nur einen Augenblick dauerte, denn der Streich war abscheulich, und die ganze Gesellschaft erklärte ihn dafür. Man rief Bauern herbei, die mich mit großer Mühe und in einem kläglichen Aufzug herauszogen. Ein ganz neues Modell, mit Flittern gestickt, meine Spitzen, meine Strümpfe, mit einem Wort, alles war verdorben. Dessenungeachtet lachte ich stärker als die anderen, obgleich ich innerlich daran dachte, mich so grausam wie nur möglich zu rächen. Um den Urheber dieses schlechten Streiches kennenzulernen, brauchte ich nur zu schweigen und mich ruhig und gleichgültig zu zeigen. Es war ersichtlich, daß das Brett durchgesägt worden war. Man schaffte mich nach Hause und lieh mir ein Kleid, ein Hemd, überhaupt alles, denn, da ich diesmal nur auf vierundzwanzig Stunden anwesend war, so hatte ich nichts bei mir. Am nächsten Tag begab ich mich in die Stadt, und am Abend fand ich mich wieder bei der lustigen Gesellschaft ein. Fabris, der nicht weniger erzürnt war als ich, sagte mir, der Urheber des hinterlistigen Streiches müsse wohl sein Unrecht fühlen, denn er habe sich nicht entdeckt. Eine Zechine, die ich einer Bäuerin versprach, wenn sie mir sagen könnte, von wem das Brett durchgesägt worden wäre, enthüllte mir alles. Sie sagte mir, das Brett habe ein junger Mann durchgesägt, den sie mir nannte. Ich suchte ihn auf, und das Versprechen einer zweiten Zechine, noch mehr aber meine Drohungen veranlassten ihn zu gestehen, daß er von einem Herrn Demetrio dafür bezahlt worden wäre, einem griechischen Gewürzhändler im Alter von fünfundvierzig bis fünfzig Jahren, gut und liebenswürdig, dem ich keinen anderen Streich gespielt hatte, als daß ich ihm eine zierliche kleine Zofe weggeschnappt hatte, in die er verliebt war.
Zufrieden mit meiner Entdeckung, zerbrach ich mir den Kopf, welchen Streich ich ihm wohl spielen könnte. Damit aber meine Rache vollständig wäre, mußte mein Streich stärker sein als der, den er mir gespielt hatte. Meine Erfindungskraft ließ mich im Stich und zeigte mir nichts Befriedigendes. Ein Begräbnis zog mich aus der Verlegenheit.
Mit einem Jagdmesser bewaffnet begab ich mich ganz allein, kurz nach Mitternacht, auf den Friedhof, schaufelte den Toten aus, den man an demselben Tage begraben hatte, und schnitt nicht ohne Mühe ihm den Arm bei der Schulter ab. Nachdem ich den Leichnam wieder eingescharrt hatte, kehrte ich mit dem Arm des Toten in mein Zimmer zurück. Am nächsten Tage speiste ich mit der ganzen Gesellschaft zu Abend und begab mich darauf in mein Zimmer, wie wenn ich schlafen gehen wollte. Aber bald verließ ich es wieder, mit meinem Arm bewaffnet, schlich mich in das Zimmer des Griechen ein und verbarg mich unter seinem Bett. Eine Viertelstunde später tritt mein Mann ein, kleidet sich aus, löscht sein Licht aus und legt sich nieder. Ich warte, bis er anfängt einzuschlafen. Hierauf ziehe ich vom Bettende her nach und nach die Decke herab, so daß er bis zu den Hüften entblößt liegt.
Er begann zu lachen und sagte: „Wer Sie auch seien, gehen Sie und lassen Sie mich schlafen; ich glaube an keine Geister.“
Mit diesen Worten zog er die Decke wieder an sich und suchte wieder einzuschlafen. Ich wartete fünf oder sechs Minuten und begann ihn wieder zu entblößen. Allein, als er seine Decke wieder hinaufziehen wollte, indem er mir wiederholte, daß er keine Geister fürchtete, setzte ich ihm Widerstand entgegen. Er richtete sich auf, um die Hand fassen zu können, die die Decke hielt, aber ich richtete es so ein, daß er die Totenhand fand. Im Glauben, den Mann oder die Frau, die ihn neckte, zu halten, zog er lachend an ihr, ich aber hielt den Arm während einiger Augenblicke fest. Als ich ihn plötzlich losließ, fiel der Grieche auf seine Polster zurück und sprach kein Wort.
Da mein Stück ausgespielt war, ging ich leise davon, kehrte in mein Zimmer zurück und legte mich nieder.
Ich schlief tief, als plötzlich ein lautes Hin- und Herlaufen mich zeitig am Morgen weckte. Da ich den Grund nicht begriff, erhob ich mich, und die Frau des Hauses, der ich zuerst begegnete, sagte mir, was ich getan hätte, wäre zu stark.
„Was habe ich denn getan?“
„Herr Demetrio liegt im Sterben.“
„Habe ich ihn denn getötet?“
Sie ging fort, ohne mir zu antworten. Ich kleidete mich ein wenig erschrocken an, war aber auf alle Fälle entschlossen, den Unwissenden zu spielen. Ich ging in das Zimmer des Griechen. Dort fand ich das ganze Haus, und alle blickten mich mit Entsetzen an; man machte mir die heftigsten Vorwürfe. Ich beteuerte meine Unschuld, aber jeder lachte mir ins Gesicht. Der Erzpriester und der Meßner, die man geholt hatte, und die den Arm, der noch da war, nicht eingraben wollten, sagten mir, ich hätte ein großes Verbrechen begangen.
„Ich bin erstaunt, Hochwürden“, sagte ich zu dem Erzpriester, „über das vermessene Urteil, das man sich auf meine Rechnung zu fällen erlaubt, ohne durch irgendeinen Beweis dazu berechtigt zu sein.“
„Sie, nur Sie allein“, riefen alle Anwesenden einstimmig, „sind einer solchen Abscheulichkeit fähig. Sie sieht Ihnen ähnlich. Kein anderer als Sie würde es zu tun gewagt haben.“
„Ich bin verpflichtet“, sagte der Erzpriester, „ein Protokoll aufzunehmen.“
„Wie Sie wollen, es steht vollkommen in Ihrem Belieben“, sagte ich zu ihm. „Aber ich sage Ihnen im voraus, daß ich nichts fürchte. Ich gehe.“
Als ich mich bei dem Mittagmahl ruhig und gleichgültig verhielt, sagte man mir, man habe dem Griechen zur Ader gelassen und er habe die Bewegung der Augen wieder erlangt, aber noch nicht die Sprache und den Gebrauch der Glieder. Am nächsten Tage sprach er, und ich erfuhr nach meiner Abreise, daß er blöde und an Krämpfen leidend geblieben wäre. Er hat den Rest seines Lebens in diesem traurigen Zustande zugebracht. Sein Schicksal betrübte mich, aber da ich nicht die Absicht gehabt hatte, ihm so viel Übles zuzufügen, so tröstete ich mich, indem ich daran dachte, daß der Streich, den er mir gespielt hatte, mir leicht das Leben hätte kosten können.
An demselben Tage entschloß sich der Erzpriester, den Arm wieder in das Grab legen zu lassen, und reichte zugleich bei der bischöflichen Kanzlei in Treviso eine förmliche Anklage gegen mich ein.
Gelangweilt von den Vorwürfen, die man mir machte, kehrte ich nach Venedig zurück. Vierzehn Tage darauf empfing ich eine Vorladung, wegen Gotteslästerung vor Gericht zu erscheinen. Ich bat Herrn Barbaro, sich nach der Ursache der besagten Vorladung zu erkundigen, denn es war eine gefürchtete Behörde. Ich wunderte mich, daß man gegen mich verfuhr, als ob man die Gewißheit gehabt hätte, daß ich ein Grab geschändet hätte, während man doch höchstens nur den Verdacht haben konnte. Aber es betraf nicht dieses. Herr Barbaro sagte am Abend, es sei eine Frau gegen mich klagbar geworden und habe Gerechtigkeit wegen der Schändung ihrer Tochter verlangt. Sie besagte in ihrer Klage, ich habe ihre Tochter nach der Zuecca gelockt und hätte sie mit Gewalt mißbraucht; zum Beweis fügte sie bei, daß ihre Tochter infolge der schlechten Behandlung, die ich ihr zugefügt hätte, um mein Ziel zu erreichen, im Bette läge.
Es war eine von den Klagen, die oft eingereicht werden, um einem ganz Unschuldigen Ausgaben und Verlegenheiten zu bereiten. Ich war unschuldig in bezug auf die Schändung. Allein es war wahr, daß ich das Mädchen ordentlich geprügelt hatte. Ich setzte meine Verteidigung auf und bat Herrn Barbaro, sie gütigst dem Gerichtssekretär überreichen zu wollen.