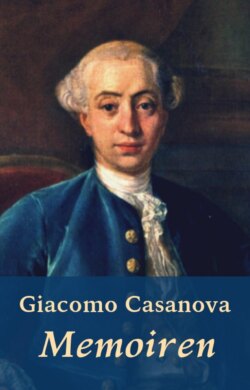Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 31
Viertes Kapitel
ОглавлениеIch nehme trotz Henriettens Widerstreben eine Loge in der Oper. – Herr Dubois kommt zu uns zum Essen; Eulenspiegelstreich, den ihm meine Freundin spielt. – Betrachtungen Henriettens über das Glück. – Wir gehen zu Dubois; wunderbares Talent, das meine Freundin dort entfaltet. – Herr Dutillot. – Prachtvolles Hoffest im herzoglichen Park. Verhängnisvolle Begegnung. – Ich habe eine Zusammenkunft mit dem Günstling des Infanten, Herrn Antoine.
Das Glück, dessen ich genoß, war zu vollkommen, um dauerhaft sein zu können; es mußte mir entrissen werden. Doch greifen wir den Ereignissen nicht vor!
Nachdem die Gemahlin des Infanten Don Filippo, Madame de France, angekommen war, sagte ich Henrietten, ich wollte eine Loge in der Oper mieten, und wir würden alle Tage hingehen. Sie hatte mir mehrere Male gesagt, daß die Musik ihre größte Leidenschaft sei, und ich bezweifelte nicht, daß sie voll Freuden auf meinen Plan eingehen würde. Sie hatte noch keine italienische Oper gesehen und mußte neugierig sein, auch diesen Teil von Italiens Ruhm kennen zu lernen. Man denke sich meine Überraschung, als ich von ihr den Ausruf hörte: „Wie, lieber Freund, du wünschest, daß wir jeden Tag in die Oper gehen?“
„Ich denke, liebe Freundin, wenn wir nicht hingingen, würden wir den bösen Zungen Stoff zum Reden geben. Wenn du jedoch nicht gerne hingehst, so weißt du, daß nichts dich dazu zwingt. Tu dir keinen Zwang an. Ich ziehe die süßen Gespräche mit dir hier im Zimmer dem schönsten Engelkonzert vor.“
„Ich liebe die Musik rasend, mein zärtlicher Freund; aber ich zittere unwillkürlich bei dem bloßen Gedanken, daß wir ausgehen sollen.“
„Wenn du zitterst, so bebe ich; aber wir müssen in die Oper gehen oder von hier abreisen: gehen wir nach London, oder anders wohin! Befiehl – ich bin bereit, alles zu tun, was du willst.“
„Nimm eine Loge, die nicht allzusehr den Blicken ausgesetzt ist.“
„Du entzückst mich, und du sollst zufriedengestellt werden.“
Ich nahm eine Loge im zweiten Rang; da jedoch das Theater klein war, so konnte eine hübsche Frau schwerlich unbemerkt bleiben; dies sagte ich ihr.
„Ich glaube nicht“, antwortete sie mir, „daß ich irgend eine Gefahr laufe, denn in der Fremdenliste, die du mir zu lesen gegeben hast, habe ich keinen einzigen bekannten Namen gefunden.“
Henriette ging also mit mir in die Oper; sie hatte kein Rot aufgelegt, und in der Loge brannten keine Kerzen. Am ersten Abend wurde eine komische Oper gegeben; die Musik von Buranello war ausgezeichnet und die Schauspieler sehr gut.
Meine Freundin bediente sich ihres Glases nur, um die Vorgänge auf der Bühne zu beachten, und niemand achtete auf uns. Da das Finale des zweiten Aktes ihr sehr gefallen hatte, versprach ich ihr die Noten zu verschaffen; ich wandte mich an Dubois, um sie mir zu besorgen. Da ich glaubte, daß Henriette Klavier spielte, bot ich ihr eins an; aber sie sagte mir, sie hätte dies Instrumentt niemals spielen gelernt.
Bei unserem vierten oder fünften Besuch kam Herr Dubois in die Loge; da ich ihn meiner Freundin nicht vorstellen wollte, so begnügte ich mich damit, ihn zu fragen, worin ich ihm zu Diensten sein könnte. Er überreichte mir die Noten, die ich bei ihm bestellt hatte; ich bezahlte ihm den Preis, indem ich ihm für seine Gefälligkeit dankte. Da wir uns der herzoglichen Loge gegenüber befanden, fragte ich ihn gesprächsweise, ob er bereits die Bilder ihrer Hoheiten angefertigt habe. Er antwortete mir, er habe bereits zwei Medaillen gemacht, und ich bat ihn, sie mir in Gold zu bringen. Er versprach es mir und ging. Henriette hatte ihn nicht einmal angesehen; dies war in der Ordnung, da ich ihn nicht vorgestellt hatte. Am nächsten Tage jedoch ließ er sich bei uns melden, während wir bei Tisch saßen. Herr de la Hane, der mit uns speiste, beglückwünschte uns zu der Bekanntschaft des Herrn Dubois und stellte ihn, als er eingetreten war, sofort seiner Schülerin vor. Natürlich mußte Henriette ihn jetzt freundlich empfangen, und sie benahm sich dabei ausgezeichnet.
Nachdem sie ihm für die Partitur gedankt hatte, bat sie ihn, ihr auch noch einige andere Melodien zu besorgen, und der Künstler ging auf diese Bitte ein wie auf eine, die ihm viel Vergnügen machte.
„Mein Herr“, sagte Dubois zu mir, „ich nahm mir die Freiheit, zu Ihnen zu kommen, um Ihnen die Medaillen zu zeigen, nach denen Sie mich fragten: hier sind sie.“
Auf der einen befanden sich der Infant und seine Gemahlin, die andere trug nur das Bild von Don Filippo. Die heiden Medaillen waren von vollendet schöner Arbeit, und wir lobten sie mit Recht.
„Die Arbeit ist unbezahlbar“, sagte Henriette zu ihm; „aber das Gold kann man gegen anderes tauschen.“
„Gnädige Frau“, antwortete bescheiden der Künstler, „sie wiegen sechzehn Zechinen.“ Sie zählte ihm diese sofort auf und lud ihn ein, er möchte ein anderes Mal schon zur Suppe kommen. Unterdessen war der Kaffee gebracht worden, und Henriette lud ihn ein, ihn mit uns zu trinken. Im Augenblick, wo sie den Zucker in seine Tasse tun wollte, fragte Henriette ihn, ob er den Kaffee süß liebe.
„Ihr Geschmack, gnädige Frau“, antwortete der galante Bucklige, „wird ganz gewiß auch der meinige sein.“
„Sie haben also erraten, daß ich ihn stets ohne Zucker trinke; es freut mich sehr, daß Sie diesen Geschmack mit mir teilen.“
Mit diesen Worten reichte sie ihm sehr anmutig die Tasse ohne Zucker, bediente hierauf de la Hane und mich, indem sie uns reichlich Zucker gab, und füllte ihre eigene Tasse in derselben Weise, wie die des Herrn Dubois. Ich hatte Mühe, nicht laut herauszuplatzen; denn meine boshafte Französin, die sonst den Kaffee nach Pariser Art, das heißt sehr süß, trank, schlürfte ihren bitteren Trank mit einer Miene, wie wenn er ihr den größten Genuß bereitete, und zwang dadurch den Herrn Münzdirektor, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Der feine Bucklige war nun zwar für sein fades Kompliment bestraft; aber er war darum nicht verlegen, sondern lobte die Güte des Kaffees und behauptete sogar, diese sei die einzig richtige Art, das herrliche Aroma zu genießen.
Als nun Dubois und de la Haye fort waren, lachten wir über diesen Streich, „aber“, sagte ich zu ihr, „du wirst das erste Opfer deiner Bosheit sein, denn wenn er hier bei uns speist, wirst du genötigt sein, deine Rolle noch weiter zu spielen, um dich nicht zu verraten“.
„Ach, ich werde leicht ein Mittel finden, meinen Kaffee tüchtig gezuckert zu trinken und trotzdem ihn auch fernerhin die Schale der Bitternis leeren lassen.“
Nach einem Monat sprach Henriette geläufig italienisch, und dies verdankte sie mehr der beständigen Übung mit meiner Base Gianetta, die sie als Zofe bediente, als den Unterrichtsstunden des Herrn de la Haye; denn durch den Unterricht lernt man nur die Regeln, zum Sprechen aber braucht man Übung. Ich habe diese Erfahrung an mir selber gemacht. Ich lernte in der allzukurzen Zeit, da ich das Glück hatte, im vertrauten Umgange mit dieser anbetungswürdigen Frau zu leben, mehr Französisch, als ich bei Dalacqua gelernt hatte.
Wir waren zwanzigmal in der Oper gewesen, ohne eine einzige Bekanntschaft gemacht zu haben, und wir lebten glücklich in der vollen Bedeutung des Wortes. Ich ging nur mit Henrietten aus, und wir benutzten stets einen Wagen. Wir waren für niemanden zu sprechen, und daher kannte mich kein Mensch.
Seit der Abreise unseres guten Ungarn war Herr Dubois der einzige, der zuweilen zu uns zum Essen kam; de la Haye dagegen war unser täglicher Tischgenosse. Dubois war sehr neugierig, wer wir seien; aber er war schlau und verriet sich nicht. Übrigens waren wir zurückhaltend ohne Ziererei, und seine Neugier kam nicht auf ihre Rechnung. Eines Tages erzählte er uns von dem Glanz, der nach der Ankunft von Madame de France am Hofe des Infanten herrsche, und von dem Andrang von Fremden beiderlei Geschlechtes, die zurzeit in Parma seien. Sich sodann besonders zu Henrietten wendend, sagte er: „Die fremden Damen, die wir hier gesehen haben, sind uns zum größten Teil unbekannt.“
„Vielleicht würden, wenn sie es nicht wären, viele von ihnen sich nicht zeigen.“
„Das ist sehr wohl möglich, gnädige Frau; aber ich versichere Ihnen, selbst wenn sie durch ihre Schönheit oder durch ihren Putz auffallen sollten, so gehen doch die Wünsche unserer Herrscherfamilie dahin, daß volle Freiheit herrsche. Ich hoffe denn auch, gnädige Frau, daß wir die Ehre haben werden, Sie bei Hofe zu sehen.“
„Das wird wohl kaum angehen; denn ich finde es überaus lächerlich, wenn eine Frau zu Hofe geht, ohne vorgestellt zu sein; besonders wenn sie Anspruch darauf hat, sich vorstellen zu lassen.“
Auf diese letzten Worte, die Henriette etwas stärker betont hatte, wußte der kleine Bucklige nichts zu erwidern; meine Freundin benützte die hiedurch entstandene Pause und gab dem Gespräch eine andere Wendung.
Nach seinem Fortgehen lachten wir über die Niederlage, die die Neugier unseres Gastes erlitten hatte; aber ich sagte zu Henrietten, sie müsse wirklich allen verzeihen, die sie neugierig mache; denn… Sie schnitt mir das Wort ab, indem sie mein Gesicht mit zärtlichen Küssen bedeckte. So im Glück schwelgend und jeden Augenblick uns selber genügend, lachten wir über die griesgrämigen Philosophen, welche leugnen, daß es ein vollkommenes Glück auf Erden gibt.
„Was wollen denn, Freund, jene Hohlköpfe, die da behaupten, das Glück sei nicht dauerhaft? Was verstehen sie unter diesem Wort? Wenn man ihm den Sinn von beständig, unsterblich, unaufhörlich gibt, so hat man recht; da aber der Mensch selber dies nicht ist, so kann in natürlicher Schlußfolgerung das Glück es ebensowenig sein. Jedes Glück ist dauernd schon dadurch, daß es vorhanden ist; und um dauernd zu sein, braucht es nur vorhanden zu sein. Versteht man aber unter vollkommenem Glück eine Reihenfolge verschiedenartiger und niemals unterbrochener Freuden, so hat man unrecht; denn indem wir nach jedem Vergnügen die Ruhe eintreten lassen, die dem Genuß folgen muß, verschaffen wir uns die Zeit, den glücklichen Zustand in seiner Wirklichkeit zu erkennen; oder mit anderen Worten: diese notwendigen Augenblicke der Ruhe sind eine wahre Quelle von Genüssen; denn durch sie kosten wir die Wonnen der Erinnerung, die alle Genüsse verdoppeln. Der Mensch kann nur glücklich sein, wenn er bei eigenem Nachdenken sich dafür hält, und nachdenken kann er nur, wenn er ruhig ist; in Wirklichkeit wäre er also ohne diese Ruhe nie ganz glücklich. Der Genuß muß also, um ein Genuß zu sein, aufhören, sich zu betätigen. Was will man also mit diesem Wort dauerhaft sagen?
Wir haben alle Tage einen Augenblick, wo wir den Schlaf herbeiwünschen; dieser ist ein Abbild der Nichtexistenz. Und trotzdem: wird man leugnen wollen, daß es ein Vergnügen ist? Nein; zum mindesten kann man dies, scheint mir, ohne Inkonsequenz nicht tun; denn sobald der Schlaf sich zeigt, ziehen wir ihn allen denkbaren Genüssen vor; aber dankbar können wir ihm erst sein, wenn er uns wieder verlassen hat.
Wer behauptet, niemand könne sein ganzes Leben lang glücklich sein, der spricht ein wenig leichtfertig. Die Philosophie lehrt das Geheimnis, sich ein solches Glück aufzubauen; doch gilt die Bedingung, daß man von körperlichen Leiden verschont sein muß; ein Glück, das in solcher Gestalt ein ganzes Leben dauert, läßt sich mit einem Blumenstrauß vergleichen, der aus tausend Blüten zusammengesetzt und der so schön und so gut ausgewählt ist, daß man ihn für eine einzige Blume halten könnte. Inwiefern wäre es also unmöglich, daß wir hier unser ganzes Leben verbrächten, genau so, wie wir jetzt einen Monat hier zugebracht haben: immer wohlauf, immer mit einander zufrieden, ohne jemals eine Leere oder ein Bedürfnis zu empfinden? Und um dieses Glück zu gründen, das sicherlich ein sehr großes Glück wäre, brauchten wir nur in hohem Alter, von unseren süßen Erinnerungen sprechend, zu sterben. Ganz gewiß, ein solches Glück wäre dauerhaft gewesen. Der Tod würde es nicht unterbrechen; er würde ihm ein Ende machen: wir könnten uns nur für unglücklich halten, insofern wir nach unserem Tode ein anderes, unglückliches Leben befürchten; und diese Idee scheint mir abgeschmackt zu sein, denn in ihr läge ein Widerspruch mit der Idee der Allmacht und göttlichem Vaterliebe.“
So philosophierte meine reizende Henriette mit mir lange köstliche Stunden über Gefühle. Sie philosophierte besser als Cicero in seinen Tusculanen; aber sie gab zu, daß dieses dauerhafte Glück, dessen Idee uns entzückte, nur zwischen zwei Wesen bestehen könnte, die miteinander zusammenlebend beständig ineinander verliebt, dazu gesund an Körper und Geist, aufgeklärt und reich genug wären, endlich einigermaßen den gleichen Geschmack, den gleichen Charakter und das gleiche Temperament hätten. Glücklich die Liebenden, bei denen der Geist an die Stelle der Sinne treten kann, wenn diese der Ruhe bedürfen! Hierauf kommt der süße Schlaf, und dieser dauert so lange, bis die physische Harmonie wieder hergestellt ist. Beim Erwachen sind zuerst die Sinne wieder da, stets bereit, sich von neuem zu betätigen.
Für den Menschen gelten dieselben Bedingungen wie für das Weltall; man könnte sogar sagen, es ist vollständige Identität vorhanden. Denn wenn wir das Weltall ausschalten, gibt es keinen Menschen mehr, und wenn wir den Menschen ausschalten, gibt es kein Weltall mehr. Denn angenommen, es gäbe nur unbelebte Materien, wer könnte sich einen Begriff davon machen? Ohne die Idee: nihil est, denn die Idee ist das wesentlichste von allem; Ideen aber hat nur der Mensch; übrigens können wir, wenn wir von der Form Abstand nehmen, uns nicht mehr die Existenz der Materie vorstellen, und umgekehrt.
Ich war mit Henrietten ebenso glücklich, wie dies anbetungswürdige Weib es mit mir war: wir liebten uns mit allen unseren Kräften; wir genügten einander vollkommen; wir lebten ganz und gar in und für einander. Sie wiederholte mir oft die hübschen Verse des guten Lafontaine:
Soyez-vous l’un à l’autre un monde toujours beau
Toujours divers, toujours noveau.
Tenez-vous lieu de tout: comptez pour rien le reste.
Seid euch einander eine Welt,
Stets schön, verschieden stets, stets neu;
Seid alles euch für euch allein,
Und alles andre sei euch einerlei!
Und wir lebten nach diesem Rat; denn niemals unterbrach ein Augenblick der Langweile oder der Erschlaffung unser Glück; niemals fühlten wir ein Rosenblatt in der Seligkeit, deren wir genossen. Am Tage nach dem Schluß der Oper speiste Dubois bei uns; nach dem Essen sagte er uns, er habe für den nächsten Tag den ersten Sänger und die erste Sängerin eingeladen, und es käme nur auf uns an, wenn wir die schönsten Arien, die sie auf der Bühne gesungen, nochmals hören wollten. Sie würden in einem gewölbten Saal seines Landhauses singen, der für die Entfaltung ihrer Stimmen außerordentlich günstig wäre. Henriette dankte ihm vielmals, bemerkte jedoch, daß sie eine zarte Gesundheit hätte und sich daher von einem Tage zum andern zu nichts verpflichten könnte; hierauf gab sie dem Gespräch eine andere Wendung.
Sobald wir allein waren, fragte ich sie, warum sie sich nicht bei Dubois unterhalten wolle?
„Ich würde hingehen, mein lieber Freund, und sogar mit sehr großem Vergnügen, wenn ich nicht fürchtete, dort irgend jemanden zu treffen, der mich erkennen und dadurch mein Glück zerstören könnte, dessen ich genieße.“
„Wenn du irgend einen neuen Anlaß zur Furcht hast, so tust du recht, vorsichtig zu sein; wenn es aber nur eine unbestimmte Bangigkeit ist, mein Engel, warum willst du dich dann eines wahren und recht unschuldigen Vergnügens berauben? Wenn du wüßtest, welche Freude ich empfinde, wenn ich sehe, daß du ein Vergnügen hast, besonders wenn ich dich beim Anhören guter Musik in einer Art von Verzückung sehe!“
„Nun mein Herz, du sollst nicht glauben, daß ich weniger mutig sei als du; wir werden zu Dubois gleich nach dem Essen gehen; vorher werden die Sänger nicht auftreten. Außerdem, mein Freund, hat er, da er nicht auf uns rechnet, niemand eingeladen, der neugierig wäre, mit mir zu sprechen. Wir werden hingehen, ohne es ihm zu sagen und ohne daß er uns erwartet; wir bereiten ihm gewissermaßen eine freundschaftliche Überraschung. Er hat uns gesagt, er werde in seinem Landhause sein, und Caudagna weiß, wo dieses ist.“
Aus ihren Worten sprachen Vorsicht und Liebe, zwei Dinge, die so selten miteinander vereint sind. Ich antwortete ihr mit einer Umarmung, worin ebensoviel Bewunderung wie Zärtlichkeit lag, und am anderen Tage um vier Uhr nachmittags begaben wir uns zu Herrn Dubois. Zu unserer Überraschung fanden wir ihn allein mit einem hübschen Mädchen, das er uns als seine Nichte vorstellte.
„Ich bin entzückt, Sie zu sehen“, sagte er zu uns; „da ich aber nicht auf das Glück zu hoffen wagte, Sie bei mir zu haben, so habe ich aus dem geplanten Mittagsmahl ein kleines Abendessen gemacht, und ich hoffe recht sehr, daß Sie dieses gütigst mit Ihrer Gegenwart beehren werden. Die beiden Virtuosi werden gleich kommen.“
So waren wir also wider Willen genötigt, am Abendessen teilzunehmen. „Haben Sie“, fragte sie, „viele Gäste eingeladen?“
„Sie werden sich“, antwortete er mit Siegermiene, „in einer Ihrer würdigen Gesellschaft bewegen. Es tut mir nur leid, keine Damen eingeladen zu haben.“
Auf diese galante und zartfühlende Bemerkung, die sich im besonderen an Henriette richtete, antwortete meine Freundin ihm mit einer Verbeugung, die sie mit einem Lächeln begleitete. Ich sah mit Vergnügen den Ausdruck der Befriedigung auf ihrem Gesicht. Aber ach, sie verbarg darunter nur das peinliche Gefühl, das sie empfand. Ihre große Seele wollte sich nicht unruhig zeigen, und ich drang nicht in ihre inneren Gedanken ein, weil ich glaubte, daß ich etwas zu befürchten hätte. Ich hätte anders gedacht und gehandelt, wenn ich ihre ganze Geschichte gekannt hätte; ich hätte sie nicht in Parma gelassen, sondern wäre mit ihr nach London gegangen, und sie wäre darüber hocherfreut gewesen.
Sehr bald kamen die beiden Sänger; es waren Laschi und Fräulein Baglioni, die damals sehr hübsch war.
Nach und nach kamen alle Gäste an.
Es waren alle Franzosen und Spanier und lauter Herren in mittleren Jahren. Von Vorstellung war nicht die Rede, und nun bewunderte ich den Takt des liebenswürdigen Dubois. Da aber alle gewandte Hofleute waren, so verhinderte dieser Verstoß gegen die Etikette nicht, daß meiner Freundin alle Ehren erwiesen wurden; sie empfing dieselben mit jener Leichtigkeit und Weltgewandtheit, die man nur in Frankreich kennt; und selbst dort nur in der besten Gesellschaft – ausgenommen allerdings einige Provinzen, wo der Adel, den man mit Unrecht die gute Gesellschaft nennt, ein wenig zu sehr den ihn kennzeichnenden Hochmut zutage treten läßt.
Das Konzert begann mit einer prachtvollen Symphonie; hierauf sang das Künstlerpaar mit viel Geschmack und Talent ein Duett. Dann kam ein Schüler des berühmten Vandini und spielte ein Cello-Konzert, das großen Beifall fand.
Der Beifall dauerte noch an, als plötzlich Henriette aufstand, auf den jungen Künstler zutrat, ihm sein Cello aus der Hand nahm, indem sie mit bescheidener aber zuversichtlicher Miene ihm sagte, sie wolle das Instrument noch mehr zur Geltung bringen. Ich fiel aus den Wolken. Sie setzte sich auf den Platz des jungen Mannes, nahm das Cello zwischen ihre Beine und bat das Orchester, das concerto noch einmal zu beginnen. Das tiefste Schweigen trat ein, ich aber zitterte wie Espenlaub und war einer Ohnmacht nahe. Zum Glück waren alle Blicke auf Henrietten gerichtet, und kein Mensch sah mich an. Auch sie sah nicht nach mir hin; sie wagte es nicht; denn wenn sie einen Blick ihrer schönen Augen auf mich geworfen hätte, so würde sie den Mut verloren haben. Da ich sie indessen sich nicht zum Spielen in Positur setzen sah, begann ich mir mit der Hoffnung zu schmeicheln, sie habe nur einen liebenswürdigen Scherz machen wollen.
Aber als ich sie den ersten Bogenstrich tun sah, bekam ich so starkes Herzklopfen, daß ich zu sterben glaubte. Man stelle sich jedoch meine Gefühle vor, als nach dem ersten Satz wohlverdienter Beifall das Orchester gänzlich übertönte! Dieser schnelle Übergang von äußerster Furcht zu überschwenglicher Freude versetzte mich in eine Erregung, die dem heftigsten Fieber glich. Der Beifall schien auf Henrietten gar keinen Eindruck zu machen; ohne ihre Augen von den Noten abzuwenden, die sie zum erstenmal sah, spielte sie hintereinander noch sechs Sätze mit derselben Vollkommenheit. Als sie ihren Platz verließ, machte sie der Gesellschaft kein Zeichen des Dankes für ihren Beifall, sondern wandte sich mit liebenswürdiger Miene zum jungen Künstler und sagte ihm mit einem freundlichen Lächeln, sie habe niemals auf einem besseren Instrument gespielt. Dann wandte sie sich zur Gesellschaft und sprach: „Ich bitte Sie, die kleine Eitelkeit zu entschuldigen, die mich veranlaßt hat, Ihre Geduld eine halbe Stunde lang zu mißbrauchen.“
Dieses würdevolle und zugleich anmutige Kompliment brachte mich vollends aus der Fassung, und ich verschwand in den Garten, um dort, wo niemand mich sehen konnte, zu weinen.
„Wer ist denn diese Henriette!“ rief ich, mit gerührtem Herzen, Tränen vergießend; „was ist das für ein Schatz, den ich besitze!“ Mein Glück schien mir zu groß, als daß ich seiner würdig Sein könnte.
In diese Betrachtungen versunken, die mir meine Tränen doppelt wonnig machten, wäre ich noch lange im Garten geblieben, wenn mich nicht Dubois selber geholt hätte. Er fand mich trotz dem nächtlichen Dunkel, das in dem Baumgang herrschte, worin ich träumte.
Er war unruhig wegen der Ursache meines Verschwindens; ich beruhigte ihn jedoch, indem ich ihm sagte, ein leichter Schwindel- anfall habe mich genötigt, hinauszugehen, um frische Luft zu schöpfen.
Unterwegs hatte ich Zeit, meine Tränen zu trocknen; doch konnte ich die Röte meiner Augen nicht beseitigen, und diese wurde zum Glück nur von Henrietten bemerkt, die mir sagte:
„Ich weiß, mein Engel, was du da draußen gemacht hast!“
Sie kannte mich und konnte leicht erraten, welchen Eindruck dieser Abend auf mein Herz gemacht hatte.
Dubois hatte bei sich die angenehmsten Kavaliere des Hofes versammelt und das Abendessen, das er ihnen gab, war ohne jede Verschwendung eingerichtet, aber ebenso delikat wie gut zusammengestellt. Ich saß Henrietten gegenüber, die als einzige Dame natürlich alle Aufmerksamkeiten auf sich lenkte; aber sie hätte nur gewinnen können, wäre sie von einem Kranze von Damen umgeben gewesen, die sie ganz gewiß überstrahlt hätte, ohne anderer Hilfsmittel zu bedürfen, als ihrer Schönheit, ihres Geistes und ihrer vornehmen Manieren. Sie verlieh der Mahlzeit Reiz durch den Zauber, den sie über die Unterhaltung verbreitete. Dubois sprach nicht; aber er strahlte vor Stolz, daß es ihm gelungen war, eine so anziehende Schönheit bei sich zu Gast zu haben. Mit großer Gewandheit sagte sie jedem etwas Liebenswürdiges, und sie besaß so viel Geist, daß sie niemals etwas Hübsches sagte, ohne mich mit hineinzuziehen. Zwar trug ich meinerseits Unterwürfigkeit, Ergebenheit und Ehrfurcht vor meiner Göttin zur Schau; aber sie wollte, daß ein jeder erriete, ich wäre ihr Orakel. Man konnte sie für meine Frau halten; aber so, wie ich mich gegen sie verhielt, mußte dies doch unwahrscheinlich vorkommen.
Als das Gespräch auf die beiderseitigen Vorzüge der französischen und der spanischen Nation kam, beging Dubois die Übereilung, Sie zu fragen, welcher Nation sie den Vorzug gäbe.
Die Frage war im höchsten Grade indiskret, denn die Hälfte der Gesellschaft waren Spanier und die andere Hälfte Franzosen.
Henriette sprach jedoch so gut, daß die Spanier hätten Franzosen und die Franzosen Spanier hätten sein mögen. Unersättlich fragte Dubois sie weiter, wie sie über die Italiener dächte. Ich zitterte. Ein gewisser Herr de la Combe schüttelte mißbilligend den Kopf; aber meine Freundin wich der Frage nicht aus.
„Was soll ich Ihnen über die Italiener sagen?“ fragte sie; „ich kenne nur einen einzigen; wenn ich alle nach dem einen beurteile, wird mein Urteil sicher sehr günstig für sie lauten. Aber ein einziges Beispiel kann nicht für eine Regel gelten.“
Unmöglich hätte sie besser antworten können. Ich aber tat, wie der Leser sich wohl denken kann, als hätte ich nichts gehört, und um den indiskreten Dubois davon abzuhalten, noch weiter zu fragen, brachte ich das Gespräch auf etwas anderes, indem ich einige gleichgültige Fragen an ihn stellte.
Die Unterhaltung kam auf die Musik, und bei dem Anlaß fragte ein Spanier Henriette, ob sie außer Cello noch irgend ein anderes Instrument spiele. „Nein“, antwortete sie ihm, „ich hatte nur für dieses Neigung. Ich lernte es im Kloster meiner Mutter zu Gefallen, die es recht leidlich spielte; und wenn mein Vater es nicht in aller Form befohlen hätte und dabei vom Bischof unterstützt worden wäre, würde die Oberin es mir niemals erlaubt haben.“
„Welchen Grund konnte denn wohl die Abtissin haben, es Ihnen zu verbieten?“
„Die fromme Braut des Herrn behauptete, ich könnte Cello nur in einer unanständigen Stellung spielen.“
Bei diesen Worten bissen die Spanier sich auf die Lippen, die Franzosen aber lachten laut heraus und sparten nicht mit ihren Epigrammen gegen die gewissenhafte Nonne.
Nach einigen Minuten machte Henriette eine leichte Bewegung, wie wenn sie um Erlaubnis bäte, aufstehen zu dürfen. Wir standen alle auf, und wenige Augenblicke darauf gingen wir. Es drängte mich, mit der Göttin meiner Seele allein zu sein; ich richtete hundert Fragen an sie, ohne ihr Zeit zum Antworten zu lassen.
„Ah, du hattest wohl recht, meine Henriette, daß du nicht hingehen wolltest, denn du warst sicher, daß du mir Feinde machen mußtest. Man muß mich verabscheuen; aber ich lache darüber: du bist meine ganze Welt. Grausame Freundin! Du hast mir beinahe das Leben gekostet mit deinem Cello; denn ich konnte deine Zurückhaltung nicht für natürlich halten und habe geglaubt, du seist wahnsinnig geworden. Als ich dich aber dann hörte, habe ich hinausgehen müssen, um meinen Tränen freien Lauf zu lassen. Sie haben mich von dem furchtbaren Druck erleichtert, den ich empfand. Sage mir jetzt, ich beschwöre dich, welche Talente hast du sonst noch? Verheimliche mir keins, denn du könntest mich töten, wenn du sie plötzlich in überraschender Weise zum Vorschein brächtest.“
Ich habe keine anderen Talente, mein Herz; ich habe mein Säckchen gleich auf einmal geleert; jetzt kennst du deine Henriette ganz und gar. Wenn du mir nicht vor einem Monat zufällig gesagt hättest, daß du gar keinen Geschmack an Musik findest, so hätte ich dir gewiß erzählt, daß ich sehr gut Cello spiele; aber ich kenne dich: wenn ich es dir gesagt hätte, hättest du dich beeilt, mir ein Instrument zu beschaffen, und deine Freundin will sich nicht mit etwas unterhalten, was dich langweilt!
Gleich am nächsten Tage erhielt sie ein ausgezeichnetes Cello. Weit entfernt, mich jemals zu langweilen, bereitete sie mir dadurch jedesmal einen neuen Genuß; und ich glaube behaupten zu können, daß ein Mensch, der Abneigung gegen Musik hat, unbedingt ein leidenschaftlicher Freund derselben werden wird, wenn die ausübende Person es zur Meisterschaft darin gebracht hat und wenn diese Person von ihm angebetet wird.
Die menschliche Stimme des Cellos übertrifft die jedes anderen Musikinstrumentes; sie drang mir jedesmal ins Herz, wenn meine Freundin spielte. Diese war davon überzeugt und verschaffte mir jeden Tag den Genuß. Ich war von ihrem Talent so entzückt, daß ich ihr vorschlug, Konzerte zu geben; sie war aber so vorsichtig, nicht darin einzuwilligen. Leider konnten wir trotz ihrer Vorsicht den Willen des Schicksals nicht ablenken. Der verhängnisvolle Dubois besuchte uns am Tage nach seinem hübschen Abendessen, um uns zu danken und die Lobsprüche einzuheimsen, die wir ihm über sein Konzert, sein Essen und über seine gewählte Gesellschaft machten.
„Ich sehe voraus, gnädige Frau“, sagte er zu Henriette, „daß ich große Mühe haben werde, mich gegen die dringenden Bitten zu wehren, womit man mich bestürmen wird, um Ihnen vorgestellt zu werden.“
„Ihre Mühe, mein Herr, wird nicht groß sein; wie Sie wissen, empfange ich niemanden.“
Dubois wagte nicht mehr, von Vorstellung zu sprechen.
An demselben Tage erhielt ich einen Brief vom jungen Capitani, der mir mitteilte, er sei als Besitzer des Messers und der Scheide des heiligen Petrus bei Franzia gewesen mit zwei Magiern, die versprochen hätten, den Schatz zu heben.
Zu seiner großen Überraschung habe man ihn nicht empfangen wollen; er bat mich, ihm zu schreiben und in eigener Person hinzugehen, wenn ich einen Anteil am Schatz haben wollte. Wie man sich denken kann, blieb der Brief unbeantwortet; aber eins möchte ich gern meinen Lesern sagen: Ich empfand die größte Freude darüber, daß es mir gelungen war, den ehrenwerten, aber einfältigen Landmann vor den Betrügern zu schützen, die ihn zugrunde gerichtet haben würden.
Seit jener Abendgesellschaft bei Dubois war ein Monat verflossen, und wir waren während dieser Zeit an Geist und Sinnen glücklich gewesen; denn niemals hatte ein einziger leerer Augenblick uns zum Gähnen veranlaßt. Unser einziges Vergnügen außerhalb des Hauses war eine Spazierfahrt vor der Stadt bei schönem Wetter. Da wir niemals ausstiegen und an keinem öffentlichen Ort verkehrten, so hatte niemand versuchen können, uns kennen zu lernen, oder es hatte jedenfalls niemand Gelegenheit dazu finden können, obgleich meine Freundin vielleicht bei den Personen, mit denen uns der Zufall, besonders auf des Herrn Dubois’ Abendgesellschaft, zusammengeführt hatte, einige Neugier erregt hatte. Henriette war mutiger und ich war zuversichtlicher geworden, nachdem wir gesehen hatten, daß weder im Theater noch bei jener Gesellschaft jemand sie erkannt hatte. Sie fürchtete nur den hohen Adel.
Als wir eines Tages vor dem Colornotor spazieren fuhren, begegneten wir dem Herzog mit seiner Gemahlin, die nach der Stadt zurückfuhren. Einen Augenblick später kam ein anderer Wagen, worin Dubois und ein uns unbekannter Herr saßen. Kaum war unser Wagen bei dem ihrigen vorbeigefahren, da stürzte eines von unseren Pferden. Der Herr, der neben Dubois saß, ließ seinen Wagen anhalten, um uns Hilfe zu schicken. Während das Pferd wieder auf die Beine gebracht wurde, trat er mit vornehmem Anstand an unseren Wagen heran und machte Henrietten ein den Umständen angemessenes Kompliment. Als feiner Höfling, der sich stets auf Kosten anderer in ein günstiges Licht zu setzen bestrebt war, ließ Dubois sich die Gelegenheit nicht entgehen, ihr zu sagen, es sei der Minister, Herr Dutillot. Meine Freundin antwortete nur mit der üblichen Neigung des Kopfes. Als das Pferd wieder auf seinen Beinen stand, setzten wir unsere Spazierfahrt weiter fort, nachdem wir uns bei den Herren für ihre Liebenswürdigkeit bedankt hatten. Eine so gewöhnliche Begegnung hätte im gewöhnlichen Lauf der Dinge eigentlich keine Folgen haben sollen; aber oft führen kleine Ursachen die größten Ereignisse herbei!
Am anderen Tage kam Dubois zu uns zum Frühstück. Er sagte uns sofort ohne die mindesten Umschweife, Herr Dutillot sei entzückt über den glücklichen Zufall, der ihm das Vergnügen verschafft habe, uns kennen zu lernen, und habe ihn beauftragt, uns um die Erlaubnis zu bitten, daß er uns besuchen dürfe.
„Die gnädige Frau oder mich?“ fragte ich sofort.
„Beide.“
„Sehr freundlich. Aber jedes für sich; denn Madame hat, wie Sie wissen, ihr Zimmer und ich das meinige.“
„Ja, aber sie liegen so dicht beieinander.“
„Das gebe ich zu. Ich muß Ihnen jedoch sagen, daß ich, soweit ich in Betracht komme, zu Seiner Exzellenz eilen werde, wenn der Herr Minister mir irgend einen Befehl zu geben oder eine Mitteilung zu machen hat; ich bitte Sie, ihm dies zu sagen. Was Madame anbetrifft, so ist sie ja selber zugegen; sprechen Sie mit ihr; denn ich, mein lieber Herr Dubois, bin nur ihr sehr untertäniger Diener.“
Henriette sagte ihm lachend und höflich: „Mein Herr, ich bitte Sie, Herrn Dutillot meinen Dank zu sagen und ihn zu fragen, ob er mich kennt.“
„Ich bin überzeugt, gnädige Frau, daß er Sie nicht kennt.“
„Sehen Sie? Er kennt mich nicht und will mir doch einen Besuch machen! Räumen Sie mir ein, daß ich ihm einen eigentümlichen Begriff von mir geben würde, wenn ich ihn empfinge. Sagen Sie ihm: obgleich niemand mich kennt und ich keines Menschen Bekanntschaft suche, bin ich doch keine Abenteuerin, und folglich kann ich nicht die Ehre haben, ihn zu empfangen.“
Dubois fühlte, daß er ein Versehen gemacht hatte, und schwieg. Während der folgenden Tage besuchte er uns mehrmals, aber wir fragten ihn nicht, wie der Minister unsere Absage aufgenommen hätte.
Drei Wochen später war der Hof in Colorno; es wurde ein prachtvolles Fest gegeben, und jedermann hatte freien Zutritt zum Park, der die ganze Nacht beleuchtet sein sollte. Der fatale bucklige Dubois hatte uns soviel von diesem Fest gesprochen, daß wir Lust bekamen, hinzugehen; das war für uns der Adamsapfel. Dubois begleitete uns. Wir fuhren den Tag vorher hinaus und nahmen Wohnung im Gasthof.
Gegen Abend gingen wir im Park spazieren, und der Zufall wollte, daß auch die höchsten Herrschaften mit ihrem Gefolge sich dort befanden. Madame de France machte nach dem Brauch des Hofes von Versailles meiner Henriette im Vorübergehen eine Verbeugung, ohne jedoch stehen zu bleiben. Bei diesem Anlaß fielen meine Blicke auf einen Kavalier, der neben dem Infanten Don Luis ging und meine Freundin aufmerksam ansah. Bald darauf kehrten wir um und begegneten demselben Kavalier, der uns eine tiefe Verbeugung machte und Dubois bat, ihn eine Minute anzuhören. Sie unterhielten sich eine volle Viertelstunde, indem sie hinter uns hergingen; wir wollten den Park verlassen, als der fremde Herr den Schritt beschleunigte und, nachdem er mich sehr höflich um Entschuldigung gebeten harte, Henrierten fragte, ob er die Ehre habe, von ihr gekannt zu sein.
„Ich erinnere mich nicht, jemals die Ehre gehabt zu haben, Sie zu sehen.“
„Das genügt, Madame; ich bitte Sie recht sehr um Entschuldigung.“
Dubois sagte uns, der Herr sei ein vertrauter Freund des Infanten Don Luis; er habe geglaubt, die gnädige Frau zu kennen, und deshalb ihn gebeten, ihn ihr vorzustellen. Dubois habe ihm gesagt, sie heiße d’Arci, und wenn er sie kenne, so bedürfe er seiner nicht, um Ihr einen Besuch zu machen. Herr d’Antoine habe ihm geantwortet, der Name d’Arci sei ihm nicht bekannt; er wolle sich aber nicht gerne irren.
„In dieser Ungewißheit“, fuhr Dubois fort, „hat er sich selbst vorgestellt, um Aufklärung zu erhalten; gegenwärtig aber muß er überzeugt sein, daß er sich getäuscht hat.“
Nach dem Essen kam Henriette mir unruhig vor, und ich fragte sie, ob sie nicht etwa nur so getan habe, als kenne sie Herrn d’Antoine nicht.
„Ich versichere dir, mein Freund, es war keine Verstellung. Ich kenne seinen Namen; es ist der einer berühmten Familie der Provence; aber seine Person ist mir gänzlich unbekannt.“
„Ist es möglich, daß er dich kennt?“
„Er mag mich vielleicht gesehen haben; aber ganz gewiß habe ich niemals mit ihm gesprochen; denn dann hätte ich ihn erkannt.“
„Diese Begegnung beunruhigt mich; und mir scheint, sie ist auch dir nicht gleichgültig.“
„Ich gestehe es.“
„Verlassen wir Parma, wenn es dir recht ist, und gehen wir nach Genua. Sobald meine Sache beigelegt ist, reisen wir dann nach Venedig.“
„Ja, mein lieber Freund, wir werden dann ruhiger sein. Ich glaube jedoch nicht, daß wir uns zu beeilen brauchen.“
Am übernächsten Tage kehrten wir nach Parma zurück, und zwei Tage darauf übergab mein Bedienter mir einen Brief, indem er mir sagte, der Läufer, der ihn gebracht hätte, warte im Vorzimmer.
„Dieser Brief“, sagte ich zu Henriette, „beunruhigt mich.“ Sie nahm ihn, öffnete ihn, las ihn und reichte ihn mir mit den Worten: „Ich glaube, Herr d’Antoine ist ein Ehrenmann; ich hoffe daher, wir haben nichts zu befürchten.“ Der Brief lautete folgender- maßen:
„Entweder bei Ihnen, oder bei mir, oder an irgend einem anderen Ort, den Sie mir gütigst bezeichnen wollen, bitte ich Sie, mein Herr, mir Gelegenheit zu geben, mich mit Ihnen über etwas zu unterhalten, das Sie sehr interessieren muß. Ich habe die Ehre (und so weiter)… d’Antoine.“ Der Brief war überschrieben: An Herrn de Farussi.
„Ich glaube“, sagte ich zu meiner Freundin, „ich muß ihn sehen; aber wo?“
„Weder hier noch in seiner Wohnung, sondern im herzoglichen Park. Deine Antwort darf nur Stunde und Ort deiner Ankunft enthalten.“
Ich setzte mich an den Schreibtisch und teilte ihm mit, daß ich mich um halb Zwölf im herzoglichen Park einfinden würde, indem ich ihn bat, mir eine andere Stunde zu bezeichnen, falls die von mir genannte ihm nicht passen sollte. Ich kleidete mich sofort an, um pünktlich zur verabredeten Zeit fertig zu sein; in der Zwischenzeit bemühten wir beide uns, ruhig zu erscheinen, aber wir konnten uns trüber Ahnungen nicht erwehren. Ich war pünktlich zur Stelle und fand, daß Herr d’Antoine bereits vor mir gekommen war. Er sagte zu mir: „Ich bin genötigt gewesen, mir die Ehre, die Sie mir erweisen, zu verschaffen, weil ich kein sichereres Mittel ausfindig machen konnte, Frau d’Arci diesen Brief zuzustellen, den ich Sie ihr zu übergeben bitte. Wollen Sie es mir, bitte, nicht übelnehmen, daß ich den Brief Ihnen versiegelt übergebe. Wenn ich mich täusche, so ist es nichts gewesen, und der Brief braucht nicht einmal beantwortet zu werden; wenn ich mich jedoch nicht getäuscht habe, so muß die gnädige Frau allein bestimmen, ob sie Ihnen den Brief zeigen will. Aus diesem Grunde übergebe ich ihn Ihnen versiegelt. Wenn Sie wirklich ihr Freund sind, so muß der Inhalt des Briefes Sie sicher ebenso interessieren wie die gnädige Frau. Kann ich darauf rechnen, daß Sie so freundlich sein werden, ihr den Brief zu übergeben?“
„Mein Herr, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort darauf.“
Hierauf trennten wir uns, nachdem wir uns gegenseitig eine tiefe Verbeugung gemacht hatten, und ich ging eilends nach meinem Gasthof zurück.