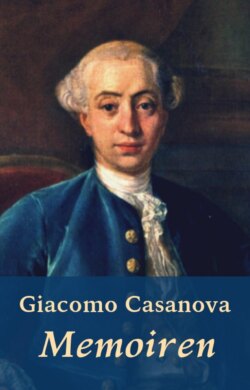Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 39
Zwölftes Kapitel
ОглавлениеMein Aufenthalt in Wien. – Josef der Zweite. – Abreise nach Venedig.
So war ich also zum erstenmal in der österreichischen Hauptstadt. Ich war achtundzwanzig Jahre alt, gut mit Sachen versehen, aber ein bißchen knapp an Geld, weshalb ich bis zum Eintreffen eines auf Herrn von Bragadino gezogenen Wechselbetrages meine Ausgaben einschränken mußte. Der einzige Empfehlungsbrief, den ich hatte, war vom Dresdener Dichter Migliavacca an den berühmten Metastasio gerichtet, dessen Bekanntschaft zu machen ich sehr begierig war. Ich gab den Brief gleich am Tage nach meiner Ankunft ab und fand in einer stundenlangen Unterhaltung den Dichter noch gelehrter, als er in seinen Werken erscheint. Metastasio war außerdem so bescheiden, daß ich anfangs diese Bescheidenheit nicht für natürlich hielt; sehr bald aber überzeugte ich mich, daß sie vollkommen echt war, denn wenn er etwas von seinen Versen hersagte, war er der erste, der auf die guten Stellen und auf die Schönheiten aufmerksam machte. Dies tat er mit derselben Einfachheit, womit er schwache Partien hervorhob. Ich erwähnte seinen Lehrer Gravina, und er sagte bei dieser Gelegenheit fünf oder sechs noch ungedruckte Stanzen her, die er auf dessen Tod gedichtet hatte. Gerührt durch die Erinnerung an den Verlust seines Freundes und durch die Süßigkeit seiner eigenen Verse, hatte er während des Sprechens die Augen voll von Tränen. Als er geendet hatte, fragte er mich in einem Ton wahrhaft rührender Biederkeit: Ditemi il vero: si può dir meglio? – Sagen Sie mir die Wahrheit; kann man es besser ausdrücken? Ich antwortete, nur ihm selber stände es zu, dies für möglich zu halten. Als ich ihn hierauf fragte, ob seine schönen Verse ihm viele Mühe kosteten, zeigte er mir vier oder fünf Seiten Geschriebenes mit vielen Ausstreichungen. Es waren im ganzen nur vierzehn Verszeilen, und er versicherte mir, an einem Tage hätte er niemals mehr machen können. Er bestätigte mir damit eine mir schon bekannte Tatsache, nämlich die, daß gerade die Verse dem Dichter am meisten Mühe kosten, von denen der Durchschnittsleser glaubt, er habe sie nur so aus dem Ärmel geschüttet.
„Welche von Ihren Opern“, fragte ich ihn, „lieben Sie am meisten?“
„Attilio Regolo: ma questo non vuol già dire, che sia il migliore. – Attilius Regulus; aber damit ist noch nicht gesagt, daß sie die beste ist.“
„Man hat in Paris Ihre sämtlichen Werke in französische Prosa übersetzt; aber der Herausgeber hat sich damit zugrunde gerichtet, denn man kann sie nicht lesen: dies beweist, wie erhaben und kräftig Ihre Poesie ist.“
„Vor etlichen Jahren verlor ein anderer Dummkopf sein Vermögen, indem er Ariostos schöne Verse in französische Prosa übertrug. Ich lache, wenn jemand behauptet, ein Prosawerk könne Anspruch darauf erheben, für ein Gedicht zu gelten.“
„Ich bin vollkommen Ihrer Meinung.“
„Und mit Recht.“
Hierauf erzählte er mir, er habe niemals eine Ariette gedichtet, ohne sie selber in Musik zu setzen; doch zeige er für gewöhnlich seine Musik keinem Menschen.
„Es ist komisch“, fuhr er fort, „wie die Franzosen glauben können, daß es möglich sei, Verse einer bereits vorhandenen Musik anzupassen. Das ist gerade, wie wenn man einem Bildhauer sagte: Da hast du einen Marmorblock; mache mir eine Venus daraus. Aber ihr Gesicht muß zu erkennen sein, ehe du noch ihre Züge herausgemeißelt hast.“
Bei einem Besuch der Hofbibliothek begegnete ich zu meiner großen Überraschung Herrn de la Haye mit zwei Polen und einem jungen Venetianer, der von seinem Vater ihm zur Vollendung seiner Erziehung übergeben worden war. Ich hatte geglaubt, er wäre in Polen, und das Wiedersehen mit ihm war mir angenehm, da es interessante Erinnerungen in mir erweckte. Ich umarmte ihn herzlich mehrere Male. Er sagte mir, er sei Geschäfte halber in Wien und werde im Laufe des Sommers nach Venedig kommen. Wir machten uns gegenseitig Besuche, und als ich ihm sagte, daß ich nicht recht gut bei Kasse sei, lieh er mir fünfzig Dukaten, die ich ihm kurz nachher zurückgab. Er teilte mir mit, daß sein Freund Bavois bereits Oberstleutnant in venezianischen Diensten sei, und diese Nachricht machte mir wirkliche Freude. Er hatte das Glück gehabt, von Herrn Morosini zu seinem Generaladjutanten erwählt zu werden, als dieser nach seinem Rücktritt vom Pariser Botschafterposten zum Grenzkommissar ernannt worden war. Ich war entzückt, zwei Menschen glücklich zu wissen, die mich als den ersten Urheber ihres Glückes ansehen mußten. In Wien erfuhr ich bestimmt, daß de la Haye Jesuit war, aber darüber durfte man mit ihm nicht sprechen.
Da ich nicht wußte, wohin ich gehen sollte, jedoch große Lust hatte, mich zu amüsieren, so besuchte ich die Probe der Oper, die nach Ostern gegeben werden sollte; dort traf ich den mir von Turin her bekannten ersten Tänzer Bodin, der die schöne Geoffroi geheiratet hatte. Ferner traf ich dort den Gatten der schönen Ancilla, Campioni. Er sagte mir, er sei zur Trennung gezwungen gewesen, weil sie ihn zu öffentlich entehrt habe. Dieser Campioni war ein ebenso großer Spieler wie großer Tänzer; ich nahm Wohnung bei ihm.
In Wien war alles schön. Viel Geld und viel Luxus. Aber infolge der Frömmelei der Kaiserin war es außerordentlich schwer, sich Cytherens Freuden zu verschaffen, besonders für Fremde. Eine Legion erbärmlicher Spitzel, die man mit dem schönen Namen Keuschheitskommissäre schmückte, waren die unerbittlichen Verfolger aller Mädchen. Die Herrscherin besaß in bezug auf die sogenannte illegitime Liebe nicht die erhabene Tugend der Duldsamkeit; fromm bis zur Bigotterie glaubte sie sich ein großes Verdienst vor Gott zu erwerben, indem sie den natürlichsten Trieb beider Geschlechter auf das kleinlichste verfolgte. Indem sie das Verzeichnis der Todsünden in ihre kaiserliche Hand nahm, glaubte sie über sechs von ihnen hinwegsehen zu dürfen, um nur die Wollust zu treffen, die ihr unverzeihlich schien.
„Man kann“, sagte sie, „den Stolz verkennen, denn die Würde trägt sein Kleid. Der Geiz ist allerdings abscheulich; aber man kann sich dabei täuschen, denn er hat große Ähnlichkeit mit der Sparsamkeit. Der Zorn ist eine mörderische Krankheit, wenn er lostobt; aber auf Totschlag steht Todesstrafe. Die Völlerei mag vielleicht nur Leckerhaftigkeit sein, und diese Sünde wird von der Religion nicht bestraft; denn in guter Gesellschaft gilt sie sogar für einen Vorzug; übrigens ist sie vom Appetit abhängig, und wenn einer an einer Unverdaulichkeit stirbt, nun, so hat er eben seine Strafe weg. Der Neid ist eine niedrige Leidenschaft, die sich niemals offen kundgibt; um die Neidischen noch anders zu bestrafen als durch das ätzende Gift, das sie ohnehin verzehrt, müßte ich zunächst meinen ganzen Hof auf die Folter spannen lassen. Die Faulheit wird schon durch die Langeweile bestraft. Etwas anderes aber ist es mit der Unenthaltsamkeit; dieser kann meine keusche Seele nicht verzeihen, und ich erkläre ihr offenen Krieg. Mögen meine Untertanen alle hübschen Frauen hübsch finden, mögen die Frauen alles aufbieten, um hübsch auszusehen, möge man sich unterhalten, soviel man will. Das kann ich nicht verbieten; aber ich will nicht, daß man Begierden, von denen die Erhaltung der menschlichen Rasse abhängt, befriedigt, wenn man nicht in aller Form Rechtens verheiratet ist. Man wird daher alle jene Unglücklichen, die ihre Liebe und ihre von der Natur empfangenen Reize verkaufen, nach Temesvar schicken. Ich weiß wohl, man ist in dieser Hinsicht in Rom sehr milde; denn dort hat ja jede Eminenz ihre Geliebte, um ein größeres Verbrechen zu verhindern – das trotzdem doch nicht verhindert wird. Aber in Rom macht man dem Klima Zugeständnisse, die ich hier nicht zu machen brauche, denn hier ersetzen Flasche und Pfeife alle anderen Genüsse. (Die gekrönte Frau hätte hinzufügen können: und der Tisch, denn die Österreicher sind berühmt als gewaltige Fresser.) Auch Unordnungen, die in den Häusern vorkommen, werde ich nicht verschonen; sobald ich erfahre, daß eine Frau ihrem Gatten untreu ist, werde ich sie einfach einsperren lassen, mag man auch noch so viel behaupten, der Mann allein sei Herr über seine Frau; denn dieser Einwand ist nicht stichhaltig in meinen Staaten, wo die Ehemänner zu gleichgültig sind. Fanatische Ehemänner mögen meinetwegen schreien, soviel sie Lust haben, und mögen sich beklagen, ich entehre sie, indem ich ihre Frauen bestrafe; sie sind durch deren Untreue schon vorher entehrt.“
„Aber, Madame, die Entehrung kann nur darin bestehen, daß sie bekannt wird; übrigens können Sie sich geirrt haben, obgleich Sie Kaiserin sind.“
„Das weiß ich. Aber schweigen Sie! Ich gestehe Ihnen nicht das Recht zu, mir zu widersprechen.“
Derartige Gründe müssen Maria Theresia bewogen haben. Aber obgleich ihr Entschluß nur aus Beweggründen der Tugend hervorgegangen war, entstanden daraus alle jene Niederträchtigkeiten, die die Henker von Keuschheitskommissären ungestraft in ihrem Namen begingen. Zu allen Stunden des Tages und in allen Straßen Wiens wurden alleingehende Mädchen, die oft nur ausgegangen waren, um sich in Ehren ihren Lebensunterhalt zu verdienen, verhaftet und ins Gefängnis geschleppt. Es war eine Gemeinheit; denn wie konnte man wissen, daß das Mädchen zu einem Mann ging, um sich trösten zu lassen, oder daß sie auf der Straße einen Tröster suchte? Das war doch nicht so einfach. Ein Spion – die Polizei bezahlte ganze Scharen von solchen – folgte ihnen von fern, und da diese Halunken keine Uniform trugen, konnte man sie nicht erkennen. Die Folge war, daß man gegen jeden unbekannten Menschen mißtrauisch war.
Wenn ein Mädchen in ein Haus eintrat, wartete der sie verfolgende Spion unten an der Tür, hielt sie an, sobald sie wieder herauskam, und nahm sie ins Verhör. Wenn das arme Ding ein verlegenes Gesicht machte, wenn sie nur einen Augenblick zögerte, eine Antwort zu geben, die den Spitzel befriedigte, brachte der Kerl sie ins Gefängnis, nachdem er zunächst ihr alles Geld und allen Schmuck abgenommen hatte; diese Wertgegenstände waren verloren, denn niemals gelang es, ihre Rückerstattung zu bewirken. Wien war in dieser Beziehung eine wahre Räuberhöhle, voll von privilegierten Spitzbuhen. Eines Tages drückte bei einem Straßenauflauf in der Leopoldstadt ein junges Mädchen mir eine goldene Uhr in die Hand, damit der Spion, der sie verfolgte und ins Gefängnis bringen wollte, sie nicht bekäme. Ich kannte das arme Mädchen gar nicht, aber ich hatte das Glück, sie einen Monat später wiederzusehen. Sie war hübsch und hatte durch mehr als ein Opfer ihre Freiheit wieder erlangt. Ich freute mich sehr, ihr ihre Uhr wiedergeben zu können, und verlangte keinen Lohn für meine Ehrlichkeit, obgleich die Schöne der Mühe wert war. Um den Belästigungen zu entgehen, gab es für die Mädchen nur ein Mittel: sie mußten gesenkten Kopfes und mit einem Rosenkranz in der Hand über die Straße gehen; denn alsdann durfte das ekelhafte Gezücht sich nicht erlauben, sie ohne weiteres zu verhaften. Es wäre ja möglich gewesen, daß sie in die Kirche gehen wollten, und in diesem Fall hätte Maria Theresia den Keuschheitskommissär hängen lassen.
Diese Bande machte für die Fremden den Aufenthalt in Wien sehr unangenehm; denn es war schwer, selbst ganz natürliche Bedürfnisse zu befriedigen. Ich war sehr überrascht, als ich eines Tages in einem Gäßchen an der Mauer stand, von einem Strolch in runder Perücke angefahren zu werden, der mir sagte, ich sollte mich anderswohin scheren, sonst würde er mich verhaften lassen.
„Und warum, bitte?“
„Weil da links von Ihnen eine Frau ist, die Sie sehen kann.“
Ich blickte auf und sah im vierten Stock den Kopf einer Frau, die mit einem Fernrohr wohl hätte unterscheiden können, ob ich Christ oder Jude war. Lachend kam ich dem Befehl nach. Ich erzählte mein Erlebnis überall, aber kein Mensch wunderte sich darüber, denn so etwas kam jeden Tag hundertmal vor.
Um die Wiener Bräuche kennen zu lernen, aß ich bald hier bald dort. Als ich eines Tages mit Campioni zum Essen in den Gasthof zum Krebs ging, sah ich zu meiner großen Uberraschnng an der Gasttafel jenen Bepe il Cadetto sitzen, den ich während meiner Gefangenschaft beim spanischen Heere kennen gelernt, später in Venedig und dann noch in Lyon unter dem Namen Don Giuseppe Maratti wiedergesehen hatte. Campioni, der in Lyon sein Teilhaber gewesen war, umarmte ihn, sprach dann mit ihm abseits und sagte mir schließlich, der Herr habe seinen richtigen Namen wieder angenommen und heiße jetzt Graf Afflisio. Nach dem Essen werde man eine Pharaobank auflegen, woran ich beteiligt sein solle; man bitte mich daher, nicht zu spielen. Ich erklärte mich einverstanden. Afflisio gewann, und ein gewisser Hauptmann Beccaria warf ihm die Karten ins Gesicht – ein kleiner Scherz, woran der angebliche Graf bereits gewöhnt war und der daher nicht weiter auffiel. Nach dem Spiel gingen wir in ein Kaffeehaus, wo ein gut aussehender Offizier mich aufmerksam ansah. Endlich lächelte er, doch in einer Weise, die durchaus nichts Beleidigendes an sich hatte.
„Mein Herr“, fragte ich ihn höflich, „über wen mögen Sie wohl lachen?“
„Über Sie, mein Herr. Ich sehe, Sie erinnern sich meiner nicht.“
„Es ist mir so, als müßte ich bereits die Ehre gehabt haben, Sie irgendwo zu sehen. Aber wo? Das kann ich nicht sagen.“
„Vor neun Jahren, als ich auf Befehl des Fürsten Lobkowitz sie ans Tor von Rimini brachte.“
„Sie sind Baron Vais!“
„Ganz recht!“
Wir umarmten uns, und er bot mir seine Freundschaft an, indem er mir versprach, mir in Wien alle nur möglichen Vergnügungen zu verschaffen. Ich nahm dies natürlich an, und an demselben Abend stellte er mich einer Gräfin vor, bei der ich die Bekanntschaft des Abbate Testagrossa machte, den man Grosse Tête (Dickkopf) nannte. Er war Gesandter des Herzogs von Modena und bei Hofe gern gesehen, weil er die Heirat eines Erzherzogs mit der Prinzessin Beatrice von Este vermittelt hatte. Ich machte dort auch die Bekanntschaft der Grafen Rockendorf und Sarrotin und mehrerer adliger junger Damen, die man nach der Etikette nur als Fräulein anreden darf. Auch war dort eine Baronin, die danach aussah, als ob sie ein lockeres Leben geführt hätte, die aber wohl noch gefallen konnte. Wir speisten zu abend, und ich wurde dabei fortwährend als Baron angeredet. Vergebens sagte ich, ich wäre kein Baron und hätte überhaupt keinen Titel. „Sie müssen doch irgend etwas sein“, antwortete man mir, „und weniger als Baron können Sie nicht sein. Sie müssen sich Baron nennen lassen, wenn Sie in Wien irgendwo in Gesellschaften zugelassen werden wollen.“
„Nun so will ich denn meinetwegen Baron sein. Es hat ja nichts weiter auf sich.“
Die Baronin gab mir bald zu verstehen, daß sie mich nach ihrem Geschmack finde und daß es ihr angenehm sein würde, wenn ich ihr den Hof machte. Ich besuchte sie schon am nächsten Tage, und sie sagte mir: „Wenn Sie gern spielen, so kommen Sie heute Abend.“ Ich lernte bei ihr mehrere Spieler und drei oder vier Fräuleins kennen, die sich ohne Furcht vor Keuschheitskommissären dem Dienst der Venus geweiht hatten und ihrem Beruf so ergeben waren, daß sie ihrem Adel nichts zu vergeben glaubten, wenn sie für ihre Gefälligkeiten einen kleinen Lohn annahmen. Da merkte ich, daß die Herren Keuschheitskommissäre nur für solche unbequem waren, die nicht in guten Häusern verkehrten.
Da die Baronin mir sagte, ich könne ihr meine Freunde vorstellen, so führte ich den Baron Vais, Campioni und Afflisio bei ihr ein. Der Graf spielte, hielt die Bank und gewann; Tramontini, den ich kennen gelernt hatte, stellte ihn seiner Frau vor, die Madame Tesi genannt wurde, und durch ihre Vermittlung machte Afflisio die ausgezeichnete Bekanntschaft des Prinzen von Sachsen-Hildburghausen. Dies war der Ausgangspunkt für die glänzende Laufbahn des Grafen eigener Mache; denn Tramontini, der sein Teilhaber bei allen großen Spielpartien geworden war, ließ durch seine Frau den Herzog bewegen, ihm zunächst den Rang eines Hauptmanns im Dienst Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Majestät zu verschaffen. Drei Wochen später trug Afflisio die Uniform mit seinen Rangabzeichen. Als ich von Wien abreiste, war er im Besitz von hunderttausend Gulden. Die Majestäten liebten das Spiel, aber sie setzten nicht. Der Kaiser ließ vielmehr eine Bank halten. Er war ein guter, prachtliebender und haushälterischer Fürst. Ich sah ihn einmal in vollem kaiserlichen Ornat und war überrascht, daß er spanische Kleidung trug. Ich glaubte Karl den Fünften zu sehen, der diese Etikette eingeführt hatte; sie war noch immer im Brauch, obwohl nach ihm kein Kaiser Spanier gewesen ist und Franz der Erste mit der spanischen Nation gar nichts gemein hatte.
Später sah ich die gleiche Sonderbarkeit in Polen bei der Krönung von Stanislaus August Poniatowski, und die alten Paladine weinten vor Ärger, als sie diese Tracht sahen; aber sie mußten gute Miene zum bösen Spiel machen, denn unter dem russischen Despotismus war ihnen nichts anderes übrig geblieben, als sich in Geduld zu fassen.
Kaiser Franz der Erste war schön, und ich würde sein Gesicht stets angenehm gefunden haben, ob er nun ein Lodenwams oder den kaiserlichen Purpur getragen hätte. Er behandele seine Frau mit der größten Rücksicht und hinderte sie nicht, den Staat in Schulden zu stürzen, weil er die Kunst verstand, dessen Gläubiger zu werden. Er begünstigte den Handel, weil dieser ihm seine Kassen füllte. Er war galant, und die Kaiserin, die ihn stets nur ihren Herrn nannte, tat, als merkte sie nichts davon; denn sie wollte in der Welt nicht den Glauben aufkommen lassen, daß ihre Reize nicht mehr genügten, ihren erlauchten Gemahl zu fesseln, um so mehr, da man allgemein die Schönheit ihrer zahlreichen Nachkommenschaft bewunderte. Alle Erzherzoginnen, mit Ausnahme der ältesten, schienen mir schön; von den Knaben konnte ich nur den ältesten genauer beobachten; ich fand seine Gesichtszüge unglücklich, obwohl Abbé Dickkopf, der sich etwas auf seine physiognomischen Kenntnisse zugute tat, andrer Meinung war.
„Was bemerken Sie“, fragte er mich eines Tages, „an der Physiognomie des Prinzen?“
„Eigendünkel und Selbstmord.“
Ich war ein guter Prophet; denn Josef der Zweite hat sich tatsächlich selbst getötet, allerdings absichtslos, und sein Eigendünkel war schuld daran, daß er es nicht merkte. Er wußte etwas; aber seine eingebildeten Kenntnisse zerstörten die, die er wirklich besaß. Besonders gern sprach er mit Leuten, die ihm nicht zu antworten wußten, weil sie von seinen Gründen geblendet waren, oder weil sie wenigstens so taten. Dagegen mied er Pedanten – wie er sie nannte – die durch ein gesundes Urteil das schlecht gezimmerte Gerüst seiner Meinungen umstießen.
Als ich vor sieben Jahren in Laxenburg bei ihm war, sprach er mit berechtigtem Spott von einem Menschen, der mittels riesiger Summen und durch alle möglichen Kriechereien einen elenden Adelsbrief erworben hatte. Bei dieser Gelegenheit sagte er zu mir: „Ich verachte alle, die den Adel kaufen.“
„Mit Recht. Aber was soll man von denen halten, die ihn verkaufen?“
Nach dieser Frage drehte er mir den Rücken zu und hielt mich nicht mehr für würdig, ein Wort an mich zu richten.
Der hohe Hert hatte eine Leidenschaft fürs Erzählen, und er erzählte in der Tat hübsch und wußte die Einzelheiten einer Anekdote geschickt auszuschmücken; aber er wollte durchaus seine Zuhörer lachen sehen, denn wer nicht zu seinen Späßen lachte, war in seinen Augen ein Dummkopf, und leider blieben gerade die ernst, die ihn am besten kannten. Er zog Brambillas Rat, der ihm schließlich den Tod brachte, den Meinungen der Ärzte vor, die ihm vernünftige Verhaltungsmaßregeln gaben. Übrigens hat niemand ihm Furchtlosigkeit abgestritten; aber von der Kunst des Regierens hatte er keine Ahnung, denn er hatte nicht die geringste Kenntnis vom menschlichen Herzen, und er wußte weder sich zu verstellen noch ein Geheimnis zu bewahren. Er hatte seine Gesichtszüge so wenig in der Gewalt, daß er nicht einmal sein Vergnügen zu verbergen wußte, wenn er eine Strafe verhängte. Wenn er jemand sah, dessen Züge ihm nicht gefielen, schnitt er stets ein Gesicht, das sehr übel aussah.
Josef der Zweite ist einer wirklich furchtbaren Krankheit erlegen; denn er blieb bis zum letzten Augenblick bei vollem Bewußtsein, während er doch den unvermeidlichen Tod vor Augen sah. Ihm ist das Unglück widerfahren, alles bereuen zu müssen, was er getan hatte, und es nicht rückgängig machen zu können; teils weil das meiste nicht wieder gut zu machen war, teils weil er geglaubt hätte, sich zu entehren, wenn er aus Gründen der Vernunft zerstörte, was er aus Unvernunft geschaffen hatte; denn ohne Zweifel bewahrte er bis zum letzten Augenblick das Gefühl der seiner hohen Geburt anhaftenden Unfehlbarkeit, obgleich der schwankende Zustand seiner Seele ihm die Fehlbarkeit seiner Natur hätte zum Bewußtsein bringen müssen. Er hegte die größte Achtung für seinen Bruder, der heute an seiner Stelle regiert; trotzdem hatte er nicht den Mut, die wichtigen Ratschläge zu befolgen, die dieser ihm gab. In einer Regung von Seelengröße gab er dem geschickten und klugen Arzt, der ihm sein Todesurteil ankündigte, eine hohe Belohnung; aber in einer Schwäche entgegengesetzter Art hatte er einige Monate vorher die Ärzte und den Quacksalber belohnt, die ihm weismachten, er sei geheilt. Ferner hatte er das Unglück, genau zu wissen, daß man seinen Tod nicht betrauern würde – ein trostloser Gedanke, besonders für einen Herrscher. Seine von ihm innig geliebte Nichte starb vor ihm, und wenn die Personen seiner Umgebung ihn geliebt hätten, so würde ihm die herzzerreißende Nachricht erspart worden sein; denn es war handgreiflich, daß sein Ende unmittelbar bevorstand, und sein Groll wegen Vorenthaltens der Nachricht wäre daher nicht mehr zu fürchten gewesen.
Ich war entzückt von dem Wiener Leben und von den Genüssen, die ich bei den schönen Fräuleins fand, deren Bekanntschaft ich bei der Baronin gemacht hatte. Kurz vor meiner Abreise aus der schönen Stadt traf Baron Vais mich beim Hochzeitsfest des Grafen Durazzo und lud mich zu einem Picknick in Schönbrunn ein. Wir fuhren hin, und ich war dort in keiner Weise enthaltsam; als wir nach Wien zurückkamen, hatte ich mir denn auch dermaßen den Magen verdorben, daß ich vierundzwanzig Stunden später dem Tode nahe war.
Das letzte Fünkchen Vernunft, das ich in meinem erschöpften Zustand noch besaß, benutzte ich dazu, mir das Leben zu retten. Campioni und die Grafen Rockendorf und Sarrotin standen an meinem Bett. Sarrotin, mit dem ich sehr befreundet geworden war, hatte einen Arzt mitgebracht, obgleich ich auf das bestimmteste erklärt hatte, ich wollte keinen. Der neue Sangrado glaubte mir seine Kunst als Despot aufdrängen zu können und hatte einen Wundarzt kommen lassen, der mir gegen meinen Willen die Ader schlagen sollte. Ich war schon halb tot, aber einer mir selber unbegreiflichen Eingebung folgend, schlag ich die Augen auf und sah den Mann mit der Lanzette in der Hand und grade im Begriff, mir die Ader zu öffnen. „Nein, nein!“ sagte ich und zog matt meinen Arm zurück; der Kerl aber wollte mir, wie der Arzt sich ausdrückte, auch gegen meinen Willen das Leben retten und packte von neuem meinen Arm. Grade in diesem Augenblick verspürte ich eine Belebung meiner Kräfte; ich streckte die Hand aus, ergriff eine meiner Pistolen, und die Kugel riß ihm eine seiner Locken vom Kopf. Dies genügte. Alle Anwesenden machten sich aus dem Staube, ausgenommen meine Magd, die nicht von mir ging, und mir soviel Wasser zu trinken gab, wie ich verlangte. Am vierten Tag war ich völlig wieder hergestellt.
Mein Erlebnis gab allen Wiener Müßiggängern ein paar Tage lang Stoff zur Erheiterung, und Abbé Dickkopf versicherte mir, wenn ich den armen Wundarzt erschossen hätte, so wäre er eben tot gewesen und weiter nichts, denn die anwesenden Zeugen würden der Wahrheit gemäß erklärt haben, man hätte mir mit Gewalt zur Ader lassen wollen; demgemäß wäre ich also in der Notwehr gewesen. Von mehreren Seiten wurde mir auch berichtet, die Wiener Ärzte hätten die Ansicht ausgesprochen, daß ich nicht mit dem Leben davon gekommen wäre, wenn man mir Blut abgezapft hätte; hätte mein Wassertrinken mich nicht geheilt, so würden die klugen Leute genau das Gegenteil behauptet haben. Ich fühlte jedoch, daß ich mich in acht nehmen müßte, um nicht in der deutschen Hauptstadt krank zu werden. Denn höchstwahrscheinlicher Weise hätte ich nur mit großer Schwierigkeit einen Arzt gefunden. In der Oper suchten viele Leute meine Bekanntschaft zu machen; man sah in mir einen Mann, der sich mit Pistolenschüssen gegen den Tod gewehrt hatte. Ein Miniaturenmaler, Morol, der sehr an Indigestionen litt und schließlich auch an einer solchen starb, hatte nur die Lehre gegeben: um von dem Unwohlsein zu genesen, sei nichts weiter nötig, als reichliche Mengen Wasser zu trinken und Geduld zu haben. Er starb, weil man ihm in einem Augenblick zur Ader ließ, wo er keinen Widerstand leisten konnte.
Meine Indigestion erinnerte mich an ein Witzwort eines Mannes, der sonst selten Witze machte, nämlich des Herrn von Maisonrouge. Er hatte sich eines Tages den Magen überladen und wurde sterbend nach Hause gebracht. Den Quinze-Vingts gegenüber mußte sein Wagen anhalten, weil einige Karren sich verfahren hatten; ein Armer trat an seinen Wagenschlag heran und bat ihn um ein Almosen, indem er sagte: „Ach, mein Herr, ich sterbe vor Hunger!“ – „Ei, wie kannst du dich darüber beklagen, du Schelm“, antwortete ihm Maisonrouge stöhnend, „ich wollte, ich wäre an deiner Stelle.“
Etwa um dieselbe Zeit machte ich die Bekanntschaft einer Mailänder Tänzerin; sie war klug, hatte ein ausgezeichnetes Benehmen, besaß literarische Kenntnisse und war vor allen Dingen sehr hübsch. Sie empfing in ihrem Salon gute Gesellschaft, mit der sie ausgezeichnet umzugehen wußte. Bei ihr lernte ich einen Grafen Christoph Erdödy kennen, einen liebenswürdigen, reichen und freigebigen Kavalier, ferner einen Fürsten Kinsky, der ein höchst anmutiger Harlekin war. Ich verliebte mich in das Mädchen, aber vergeblich, denn sie war in den Florentiner Tänzer Angiolino verschossen. Ich umwarb sie, aber sie machte sich über mich lustig; eine Theaterdame, die in irgend jemand verliebt ist, ist eine uneinnehmbare Festung, falls man nicht in der Lage ist, eine goldene Brücke zu schlagen. Ich war aber nicht reich. Trotzdem gab ich die Hoffnung nicht auf, sondern verbrannte ausdauernd meinen Weihrauch auf ihrem Altar. Meine Gesellschaft war ihr angenehm, denn sie zeigte mir die von ihr verfertigten Briefe, und ich hob deren Schönheiten hervor. Sie besaß von sich ein Miniaturbildnis von überraschender Ähnlichkeit. Am Tage vor meiner Abreise beschloß ich, aus Arger über meine verlorene Zeit und über die von mir in der Verliebtheit begangenen Dummheiten, ihr dies Bildnis zu stehlen. Ein schwacher Trost für einen Unglücklichen, der sich vergeblich um das Original bemüht hatte! Bei meinem Abschiedsbesuch sah ich das Kleinod liegen; ich steckte es ein und reiste damit nach Preßburg, wohin Baron Vais mich nebst zwei schönen Fräuleins zu einer Lustpartie eingeladen hatte.
Als ich aus dem Wagen stieg, war der erste Mensch, dem ich sozusagen in die Arme lief, der Beschützer der Frau Condé-Labré, Chevalier Talvis, dem ich in Paris einen so tüchtigen Denkzettel gegeben hatte. Als er mich erkannte, ging er auf mich los und sagte ich sei ihm eine Revanchepartie schuldig.
„Ich verspreche sie Ihnen“, erwiderte ich, „doch gehe ich niemals eine Partie um einer anderen willen auf: wir werden uns wiedersehen!“
„Das genügt. Würden Sie mir die Ehre erweisen, mich den Damen vorzustellen?“
„Recht gern; aber nicht auf der Straße.“
Wir gingen in den Gasthof, er folgte uns. Da ich der Meinung war, der junge Mann, der im übrigen tapfer war wie nur irgend ein französischer Kavalier, könnte zu unserer Unterhaltung beitragen, so stellte ich ihn vor. Er wohnte seit ein paar Tagen in dem Wirtshaus, wo auch wir abgestiegen waren, und war in Trauer gekleidet. Er fragte uns, ob wir den Ball beim Fürstbischof besuchen würden. Wir wußten nichts von einem solchen, aber Vais bejahte seine Frage. „Man besucht den Ball“, sagte der Chevalier, „ohne vorgestellt zu sein, und deshalb gedenke auch ich hinzugehen, was ich sonst nicht könnte, denn mich kennt hier kein Mensch.“ Hiermit ging er. Der Wirt, der erschien, um sich nach unseren Befehlen zu erkundigen, gab uns Auskunft über den Ball; da unsere schönen Fräuleins den Wunsch äußerten, hinzugehen, so erklärten wir uns bereit.
Allen Leuten unbekannt, durchstreiften wir in voller Freiheit alle Räume des Palastes, bis wir schließlich zu einem großen Tisch gelangten, woran der Fürstbischof saß und eine Pharaobank hielt. Der Goldhaufe, den der edle Prälat vor sich hatte, mochte nach unserer Schätzung etwa dreizehn oder vierzehntausend Gulden betragen. Chevalier Talvis stand zwischen unseren beiden Damen und machte ihnen Komplimente, während Seine Gnaden die Karten mischten. Der Fürst ließ abheben, sah den Chevalier an und lud ihn freundlich ein, doch auch eine Karte zu besetzen.
„Gern, gnädiger Herr; ich halte die Bank auf diese Karte.“
„Gilt!“ sagt der Bischof, um sich nicht den Anschein zu geben, als ob er Furcht hätte. Er zieht ab, die Karte des Chevaliers gewinnt, und mein glücklicher Franzose zieht in aller Seelenruhe das ganze Geld des Prälaten ein und stopft sich die Taschen damit voll. Der Bischof ist verblüfft; ein wenig zu spät die Dummheit erkennend, die er gemacht hat, sagt er zum Chevalier: „Und wenn Ihre Karte verloren hätte, mein Herr, wie würden Sie es angefangen haben, mich zu bezahlen?“
„Gnädiger Herr, das wäre meine Sache gewesen.“
„Mein Herr, Sie haben mehr Glück als Verstand.“
„Das kann wohl sein, Euer Gnaden; aber das ist meine Sache.“
Der Chevalier ging hinaus, ich folgte ihm und holte ihn unten an der Treppe ein. Nachdem ich ihm mein Kompliment gemacht hatte, bat ich ihn, mir hundert Kaiserdukaten zu leihen. Er zählte sie mir augenblicklich auf, indem er mir die Versicherung gab, er sei entzückt, mir diesen Dienst leisten zu können.
„Ich werde Ihnen einen Schuldschein ausstellen.“
„Unsinn, nichts von Schuldschein.“
Ich steckte das Gold in die Tasche, ohne mich um die zahlreichen Masken zu bekümmern, die aus Neugier dem glücklichen Gewinner gefolgt und jetzt Zeugen des Vorfalls waren. Talvis entfernte sich, und ich ging wieder in den Spielsaal.
Rockendorf und Sarrotin, die zufällig auf dem Ball waren, hatten erfahren, daß der Chevalier mir Geld gegeben hätte, und fragten mich, wer er wäre. Ich erzählte ihnen eine aus Wahrem und Falschem gemischte Geschichte und sagte ihnen schließlich, mit dem Gelde, das er mir gegeben, habe der Chevalier eine Schuld getilgt, die er noch von Paris her an mich gehabt habe. Sie mußten mir dies glauben oder doch wenigstens so tun.
In unserem Gasthof erzählte uns der Wirt, der Chevalier sei Hals über Kopf zu Pferde davon gesprengt, und sein ganzes Gepäck hahe in einem Handköfferchen bestanden. Wir speisten zu Nacht, und zur Erheiterung des Mahles erzählte ich Vais und unseren schönen Fräuleins, auf welche Weise ich Talvis kennen gelernt und wie ich es angefangen hatte, meinen Anteil an der Beute zu erhalten.
In Wien war, als wir zurückkehrten, die Geschichte bereits das Tagesgespräch, man lachte über den Gaskogner und ulkte über den Bischof. Die bösen Zungen verschonten auch mich nicht, aber ich tat, als verstände ich die Anzüglichkeiten nicht, denn ich hielt es für zwecklos mich zu verteidigen.
Den Chevalier de Talvis kannte kein Mensch, und der französische Botschafter hatte niemals ein Wort von ihm gehört. Ich weiß nicht, ob er vielleicht später noch nach Preßburg hat von sich hören lassen.
Nachdem ich von allen Freunden und Freundinnen Abschied genommen hatte, reiste ich endlich mit der Post von Wien ab; am vierten Tage übernachtete ich in Triest. Tags darauf schiffte ich mich nach Venedig ein, wo ich am Nachmittag des zweiten Tages vor Himmelfahrt ankam. Ich hatte das Glück, nach einer dreijährigen Abwesenheit meinen herrlichen Beschützer, den Herrn von Bragadino, und seine beiden unzertrennlichen Freunde zu umarmen; sie waren sehr erfreut, mich vollkommen gesund und stattlich ausgerüstet wieder zu sehen.