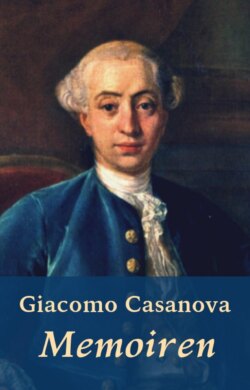Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 36
Neuntes Kapitel
ОглавлениеMeine Tapereien in der französischen Sprache; meine Erfolge: meine zahlreichen Bekanntschaften. – Ludwig der Fünfzehnte. – Ankunft meines Bruders in Paris.
Alle italienischen Schauspieler in Paris wollten mich bei sich zu Gaste haben, um mir ihre Herrlichkeit zu zeigen. Ich wurde bei allen prachtvoll bewirtet. Carlin Bertinazzi, der Lieblingsschauspieler von ganz Paris, der die Harlekinrollen spielte, erinnerte mich daran, daß er mich vor dreizehn Jahren in Padua gesehen hätte, als er mit meiner Mutter von Petersburg zurückgekehrt wäre. Er gab mir ein glänzendes Mahl im Hause der Frau de la Caillerie, bei der er wohnte. Diese Dame war in ihn verliebt. Ich machte ihr ein Kompliment über vier reizende Kinder, die um uns herum sprangen. Ihr anwesender Gatte antwortete mir: „Es sind Herrn Carlins Kinder.“
„Das ist wohl möglich, mein Herr; aber einstweilen tragen Sie Sorge für sie; und da sie Ihren Namen führen, so müssen sie Sie als ihren Vater ansehen.“
„Ja, so wird es nach dem Gesetz wohl sein; aber Carlin ist zu anständig, um sich nicht sofort ihrer anzunehmen, wenn es mir passen sollte, mich ihrer zu entledigen. Er weiß wohl, daß sie von ihm sind, und meine Frau wäre die erste, sich darüber zu beklagen, wenn er es nicht zugeben wollte.“
Der Mann war durchaus nicht ein sogenannter guter Trottel; weit gefehlt; aber da er die Sache sehr philosophisch ansah, so sprach er mit Ruhe und sogar mit einer Art Würde darüber. Er liebte Carlin als Freund, und Verhältnisse dieser Art waren zu jener Zeit in Paris unter Leuten einer gewissen Klasse gar nicht selten. Zwei große Herren, Boufflers und Luxembourg, hatten in aller Freundschaft ihre Frauen getauscht, und beide hatten Kinder von ihnen. Die kleinen Boufflers hießen Luxembourg, und die kleinen Luxembourgs trugen den Namen Boufflers. Die Abkömmlinge dieser Bankerte sind noch heute unter demselben Namen bekannt. Nun, wer des Rätsels Lösung kannte, der lachte mit Recht darüber, und die Erde hörte darum nicht auf, sich nach den Gesetzen der Schwerkraft zu bewegen.
Der reichste von den italienischen Komödianten war Pantalon, Vater von Coraline und Camille und bekannter Wucherer. Auch er war so freundlich, mich zu einem Essen in seine Familie einzuladen, und seine beiden Töchter entzückten mich. Coraline wurde vom Prinzen von Monaco unterhalten, dem Sohn des Herzogs von Valentinois, der noch am Leben war, und Camille war in den Grafen Melfort verliebt, den begünstigten Liebhaber der Herzogin von Chartres, die um diese Zeit durch den Tod ihres Schwiegervaters Herzogin von Orléans wurde.
Coraline war nicht so lebhaft wie Camille, aber hübscher. Ich begann ihr zu unpassenden Stunden, als ein Mensch ohne Bedeutung, den Hof zu machen; aber diese Stunden gehörten auch dem offiziellen Liebhaber. Ich war also zuweilen gerade in dem Augenblick bei ihr, wo der Prinz zu Besuch kam. Bei dem ersten derartigen Zusammentreffen machte ich meine Verbeugung und ging; in der Folge aber bat man mich zu bleiben; denn für gewöhnlich wissen Fürsten sich nur zu langweilen, wenn sie mit ihren Geliebten unter vier Augen sind. Wir speisten zusammen zu Abend, und sie hatten die Aufgabe, mir zuzuhören, während die meinige war, zu essen und zu erzählen.
Ich glaubte dem Prinzen meine Aufwartung machen zu müssen und wurde von ihm ausgezeichnet aufgenommen; eines Morgens aber sagte er mir, sobald er mich eintreten sah: „Ach, es freut mich sehr, Sie zu sehen, denn ich habe der Herzogin de Rufé versprochen, Sie bei ihr einzuführen; wir wollen gleich hingehen.“ Aha; noch eine Herzogin! Ich sagte: Mit gutem Wind! Vorwärts! Wir steigen in einen Diable, wie man einen Wagen nannte, der damals modern war, und sind um elf Uhr vormittags bei der Herzogin.
Leser, wenn ich ganz wahrheitsgetreu wäre, würde das Portrait, das ich von dieser geilen Megäre entwerfen müßte, dich entsetzen. Stelle dir ein mit roter Schminke bemaltes Gesicht vor, auf dem sich sechzig Winter angesammelt haben, eine mit Finnen bedeckte Haut, ein hohlwangiges, fleischloses Gesicht, eine ekelhafte Physiognomie, die von der Ausschweifung mit dem Brandmal der Häßlichkeit gestempelt war. Die Herzogin lag wollüstig auf einem Sofa ausgestreckt und rief bei meinem Erscheinen mit rasender Freude: „Ah, aha! Das ist ein hübscher Junge! Du bist reizend, Prinz, daß du ihn zu mir gebracht hast. Setz dich hierher, mein Junge!“ Ich gehorchte respektvoll, aber ein Pestgeruch von Moschus, der mich an einen Leichnam erinnerte, hätte mich beinahe ohnmächtig gemacht. Die infame Herzogin hatte sich aufgerichtet und zeigte einen entblößten häßlichen Busen, vor dem der Tapferste hätte Angst bekommen können. Der Prinz schützte ein Geschäft vor und ging, indem er mir sagte, er würde mir in einigen Augenblicken seinen Diable schicken.
Sobald wir allein sind, streckt das geschminkte Gerippe seine Arme aus, ehe ich Zeit hatte mich zu besinnen, und preßt seine feuchten Lippen auf meine Wange, daß mich ein Schauder durchläuft; eine ihrer Hände verirrt sich in der unanständigsten Weise, und sie sagt: „Laß doch mal sehen, mein Hühnchen – hast du denn auch einen schönen…?“
Ich zitterte; ich sträubte mich.
„Ach was, sei doch nicht kindisch!“ rief die neue Messalina; „bist du denn noch so neu?“
„Das nicht, meine Gnädige, aber…“
„Nun? was denn?“
„Ich habe…“
„Oh, der häßliche Mensch!“ rief sie, indem sie mich losließ; „was hätte mir da passieren können!“
Ich benutzte den günstigen Augenblick, nahm meinen Hut und verschwand, so schnell ich nur konnte; ich hatte nur Angst, der Türhüter würde mich nicht hinauslassen.
Ich nahm einen Fiaker und fuhr zu Coraline, um ihr die Geschichte zu erzählen.
Sie lachte sehr darüber und gab mir recht, daß der Prinz mir einen sehr bösen Streich gespielt hätte. Sie lobte die Geistesgegenwart, womit ich einen Hinderungsgrund vorgeschützt hatte; aber sie setzte mich nicht in Stand, sie zu überzeugen, daß ich der Prinzessin was vorgelogen hatte. Immerhin unterhielt ich noch einige Hoffnung, denn ich vermutete, daß sie mich nur nicht für verliebt genug hielt.
Drei oder vier Tage darauf aß ich mit ihr allein zu Abend; bei dieser Gelegenheit vertrat ich meine Sache so beredt und verlangte schließlich in so deutlichen Ausdrücken meinen Abschied, daß sie mich auf den nächsten Tag vertröstete.
„Der Prinz“, sagte sie zu mir, „wird erst morgen von Versailles zurückkommen, also gehen wir morgen ins Kaninchengehege, speisen miteinander allein, jagen mit dem Frettchen und fahren voll Vergnügen nach Paris zurück.“
„Vortrefflich!“
Am nächsten Tage um zehn Uhr steigen wir in ein Kabriolet und kommen bei der Barriere an. Im Augenblick, wo wir sie passieren wollen, erscheint ein Vis-à-vis mit einer fremden Livree, und der Herr, der darinnen sitzt, ruft plötzlich: „Halt! Halt!“
Es war der Chevalier de Wirtemberg, der, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen, Coralinen Komplimente zu machen begann; hierauf steckte er den ganzen Kopf zum Wagen hinaus und sagte ihr etwas ins Ohr. Sie antwortete ihm auf dieselbe Art, wandte sich dann zu mir, schüttelte mir die Hand und sagte lachend: „Ich habe eine große Sache mit dem Prinzen vor. Gehen Sie allein ins Kaninchengehege, mein lieber Freund; essen Sie dort zu Mittag, jagen Sie und besuchen Sie mich morgen.“ Zugleich steigt sie aus, steigt in das Vis-à-vis ein, und ich bleibe zurück, wie Lots Weib – aber nicht unbeweglich.
Leser, wenn du dich einmal in einer ähnlichen Lage befunden hast, so wirst du dir leicht vorstellen können, von welcher Wut ich gepackt wurde; wenn du etwas Derartiges niemals erlebt hast, um so besser für dich; aber dann ist es überflüssig, daß ich versuche, dir einen Begriff davon zu geben: du würdest mich nicht verstehen.
Das Kabriolet war mir zum Abscheu geworden, ich sprang heraus und sagte dem Kutscher, er solle zum Teufel fahren. Dann nahm ich den ersten Fiaker, den ich fand, und fuhr geraden Weges zu Patu, dem ich wutschäumend mein Abenteuer erzählte. Anstatt mich zu beklagen oder in meine Entrüstung einzustimmen, lachte Patu, vernünftiger als ich, über mein Abenteuer, und sagte zu mir: „Mir wäre es sehr lieb, wenn mir so etwas passiert wäre; denn nun bist du gewiß, daß bei dem nächsten Zusammensein die Schöne dein sein wird.“
„Ich will sie nicht mehr; ich verachte sie zu sehr.“
„Du hättest sie früher verachten sollen; aber da diese Sache nun einmal erledigt ist – was meinst du dazu, wenn wir zum Essen ins Hotel du Roule gingen, damit du dich schadlos halten kannst?“
„Wahrhaftig, dein Vorschlag ist ausgezeichnet: vorwärts!“
Das Hotel du Roule war in ganz Paris berühmt, aber ich kannte es noch nicht. Die Besitzerin hatte es elegant eingerichtet und hielt darin zwölf bis vierzehn auserlesene Nymphen; außerdem fand man alle Bequemlichkeiten, die man nur wünschen kann: guten Tisch, gute Betten, Sauberkeit, Einsamkeit in herrlichen Gartenanlagen. Ihr Koch war ausgezeichnet und ihre Weine vorzüglich. Sie nannte sich Madame Paris, was ohne Zweifel ein angenommener Name war, der aber vollständig genügte. Sie wurde von der Polizei beschützt; ihr Haus lag ziemlich weit von Paris entfernt; sie konnte daher sicher sein, daß die Besucher ihrer Wohltätigkeitsanstalt Leute waren, die über der Mittelklasse standen. Die innere Einrichtung war genau geregelt, und für jedes Vergnügen war ein vernünftiger Tarif angesetzt; man bezahlte sechs Franken für ein Frühstück mit einer Nymphe, zwölf für ein Mittagessen und das doppelte für eine Nacht. Ich fand das Haus weit über seinem Rufe stehend und freute mich, daß ich nicht nach dem Kaninchengehege gegangen war.
Wir steigen in einen Fiaker, und Patu sagt zum Kutscher: „Nach Charente!“
„Ich verstehe, Herr.“
Nach einer halbstündigen Fahrt hielt der Wagen vor einer Torfahrt, über welcher man las, „Hotel du Roule“. Das Tor war geschlossen. Ein Schweizer mit großem Schnurrbart kommt aus einer Seitentür hervor und mustert uns mit ernster Miene. Er hält uns für anständige Leute, denn er öffnet, und wir treten ein. Eine einäugige Frau von ungefähr fünfzig Jahren, die aber noch Spuren einstiger Schönheit zeigte, trat uns entgegen, begrüßte uns höflich und fragte uns, ob wir bei ihr zu speisen wünschten. Auf unsere bejahende Antwort führte sie uns in einen schönen Saal, wo wir vierzehn junge Mädchen sahen, sämtlich schön und gleichmäßig mit Mousselinkleidern angetan. Bei unserem Erscheinen standen sie auf und machten eine sehr anmutige Verbeugung. Alle waren ungefähr von demselben Alter, einige blond, andere schwarz oder braun: für jeden Geschmack war etwas vorhanden. Wir musterten sie, indem wir zu jeder einige Worte sagten, und trafen unsere Wahl. Die beiden Auserwählten stießen einen Freudenruf aus, umarmten uns mit einer Wollust, die ein Neuling hätte für Zärtlichkeit halten können, und zogen uns in den Garten, um dort die Zeit zu verbringen, bis man uns zum Essen rufen würde.
Der Garten war groß und in künstlerischer Weise so angelegt, daß er der Liebe dienen konnte oder, wenn nicht der Liebe, so doch den Freuden, die die Liebe ersetzen müssen. Frau Paris sagte zu uns: „Nun, meine Herren, genießen Sie der schönen Luft und der Sicherheit in jeder Beziehung; mein Haus ist der Tempel der Ruhe und der Gesundheit.“
Die von mir gewählte Schöne hatte etwas von Coraline an sich, und dieser Umstand ließ sie mich entzückend finden. Aber mitten in der süßesten Beschäftigung rief man uns zum Essen. Wir wurden recht gut bedient und fühlten uns durch die Mahlzeit zu neuen Taten aufgelegt, als mit der Uhr in der Hand die Einäugige erschien und uns meldete, daß unsere Partie zu Ende sei. Das Vergnügen wurde auf Zeit berechnet.
Ich sagte ein Wörtchen zu Patu, der erst einige philosophische Betrachtungen anstellte, dann aber sich an die Frau Direktorin wandte und zu ihr sagte: „Wir werden die Portion noch einmal bestellen und den Lohn dafür verdoppeln.“
„Ganz wie Sie wollen, meine Herren!“ Wir gehen wieder in den Saal, treffen unsere Wahl und beginnen unseren neuen Spaziergang. Gerade wie das erstemal wird uns durch die strenge Pünktlichkeit der Dame die Freude gestört. „Ah, das ist aber doch zu stark, Madame!“
„Lieber Freund, laß uns zum drittenmal hinaufgehen, zum drittenmal wählen und hier die Nacht verbringen.“
„Ein köstlicher Plan, den ich von ganzem Herzen unterschreibe.“
„Und billigt Madame Paris den Plan?“
„Ich selber hätte ihn nicht besser machen können, meine Herren; er ist von Meisterhand entworfen.“
Nachdem wir im Saal unsere neue Wahl getroffen hatten, machten alle anderen sich über die ersten lustig, die uns nicht hätten fesseln können; diese aber sagten, um sich zu rächen, wir seien Schmachtlappen.
Ich war über meine neue Wahl ganz erstaunt. Ich hatte eine wahre Aspasia genommen, und ich dankte dem Zufall, daß ich sie die beiden ersten Male übersehen hatte, weil ich hierdurch die Aussicht hatte, sie vierzehn Stunden hintereinander zu besitzen. Diese Schönheit hieß St.-Hilaire; sie ist dieselbe, die unter diesem Namen in England berühmt wurde, wohin ein reicher Lord das Jahr darauf sie führte. Erst war sie beleidigt, daß ich sie weder beim ersten- noch beim zweitenmal ausgezeichnet hatte, und sah mich stolz und verächtlich an; aber es gelang mir bald, ihr begreiflich zu machen, daß dies ein Glücksfall sei, weil sie infolgedessen um so länger mit mir zusammenbleiben würde. Da fing sie an zu lachen und wurde reizend.
Das Mädchen hatte Geist, Bildung und Talent – mit einem Wort alles, was nötig war, um in der von ihr eingeschlagenen Laufbahn Erfolg zu haben. Während wir zu Abend aßen, sagte Patu zu mir auf italienisch, er hätte sie gerade für sich wählen wollen, als ich sie genommen hätte, und am anderen Morgen sagte er mir, er habe die ganze Nacht geschlafen. Die St.-Hilaire war sehr zufrieden mit mir und brüstete sich damit ihren Freundinnen gegenüber. Sie war Veranlassung, daß ich mehrere Besuche im Hotel du Roule abstattete, die ausschließlich ihr galten. Sie war ganz stolz darauf, mich gefesselt zu haben.
Diese Besuche wurden Ursache, daß meine Liebe zu Coraline sich abkühlte. Ein venezianischer Musiker namens Guadagni, schön, tüchtig in seiner Kunst und geistvoll, wußte sie drei Wochen nach meinem Bruch mit ihr für sich zu gewinnen. Der schöne Jüngling, der nur den äußeren Anschein der Manneskraft besaß, machte sie neugierig und wurde schuld an ihrem Bruch mit dem Prinzen, der sie auf frischer Tat ertappte. Coraline wußte ihn jedoch zu besänftigen; einige Zeit darauf versöhnten sie sich wieder und zwar so aufrichtig, daß ein Püppchen das Resultat war. Es war ein Mädchen, dem der Prinz den Namen Adelaide und eine Aussteuer gab. Nach dem Tode seines Vaters, des Herzogs von Valentinois, verließ der Prinz sie endgültig, um Fräulein de Brignola aus Genua zu heiraten. Coraline wurde die Geliebte des Grafen de la Marche, des Späteren Prinzen von Conti. Coraline lebt nicht mehr; ebensowenig ein Sohn, den sie von ihm hatte und den der Prinz zum Grafen Monréal ernannte.
Die Frau Dauphine brachte eine Prinzessin zur Welt, die mit dem Titel Madame de France geschmückt wurde.
Im August fand im Louvre die öffentliche Gemäldeausstellung der Mitglieder der königlichen Malerakademie statt, und da ich dort kein einziges Schlachtenbild sah, beschloß ich, meinen Bruder nach Paris zu rufen. Er lebte in Venedig und hatte Talent für diesen Zweig der Malerei.
Da Paroselli, der einzige Schlachtenmaler Frankreichs, gestorben war, so glaubte ich, Francesco könnte Erfolg haben und sein Glück machen. Ich schrieb infolgedessen an Herrn Grimani und an meinen Bruder, und es gelang mir, sie zu überzeugen; indessen kam er erst zu Beginn des nächsten Jahres nach Paris.
Ludwig der Fünfzehnte liebte leidenschaftlich die Jagd und hatte die Gewohnheit, jedes Jahr sechs Wochen in Fontainebleau zu verbringen. Mitte November war er stets wieder in Versailles. Diese Reise kostete ihm oder vielmehr Frankreich fünf Millionen.
Er nahm alles mit sich, was zur Unterhaltung aller auswärtigen Gesandten und seines zahlreichen Hofes beitragen konnte. Daher folgten ihm die Mitglieder der italienischen und französischen Komödie und seine Künstler und Künstlerinnen von der Oper. Während dieser sechs Wochen war Fontainebleau viel glänzender als Versailles; trotzdem fielen die Pariser Vorstellungen der Oper, des französischen und des italienischen Theaters nicht aus, so zahlreich waren die Mitglieder dieser Bühnen.
Balettis Vater, dessen Gesundheit wiederhergestellt war, sollte mit Sylvia und der ganzen Familie nach Fontainebleau gehen. Sie luden mich ein, sie dorthin zu begleiten und bei ihnen in einem Hause zu wohnen, das sie gemietet hatten. Die Gelegenheit war schön; das Anerbieten kam von Freunden, und ich glaubte es nicht abschlagen zu dürfen, denn ich hätte mir niemals eine bessere Gelegenheit verschaffen können, den ganzen Hof Ludwigs des Fünfzehnten und alle fremden Gesandten kennen zu lernen. Ich stellte mich Herrn de Morosini vor, der heutzutage Prokurator des heiligen Markus ist und damals Botschafter der Republik in Paris war.
Am ersten Tage, wo eine Oper gegeben wurde, erlaubte er mir, ihn zu begleiten. Man spielte eine Musik von Lulli. Ich saß im Parkett genau unterhalb der Loge der Pompadour, die ich nicht kannte. Beim ersten Auftritt sah ich die berühmte Le Maur auf der Bühne erscheinen und hörte sie einen so unerwarteten Schrei ausstoßen, daß ich glaubte, sie sei verrückt geworden. Ich lachte darüber in aller Unschuld, denn ich dachte nicht, daß irgendjemand mir dies übelnehmen könnte. Ein Kavalier mit blauem Ordensband, der neben der Marquise saß, fragte mich in schroffem Ton, aus welchem Lande ich wäre. Ich antwortete im selben Ton:
„Aus Venedig.“
„Ich bin dort gewesen und habe sehr über das Rezitativ Ihrer Oper gelacht.“
„Ich glaube es Ihnen, mein Herr, und bin ich überzeugt, daß es keinem Menschen eingefallen ist, Sie am Lachen zu verhindern.“
Über meine etwas schneidende Antwort lachte Frau von Pompadour; sie fragte mich, ob ich wirklich von da unten wäre?
„Von wo da unten?“
„Von Venedig.“
„Venedig, Madame, liegt nicht da unten, sondern da oben.“
Diese Antwort fand man noch sonderbarer als die erste, und die ganze Loge beriet sich darüber, ob Venedig da unten oder da oben liege. Offenbar fand man, daß ich recht hätte, denn ich wurde nicht weiter angegriffen. Ich hörte nun der Oper zu, ohne zu lachen; da ich aber einen Schnupfen hatte, brauchte ich oft mein Taschentuch. Derselbe Herr mit dem blauen Ordensband richtete von neuem das Wort an mich und sagte mir, offenbar schlössen die Fenster meines Zimmers nicht gut. Dieser Herr, den ich nicht kannte, war der Marschall Richelieu. Ich antwortete ihm, er irre sich; meine Fenster seien calfoutrées. Sofort brach die ganze Loge in ein lautes Gelächter aus, und ich saß ganz verdutzt da, denn ich fühlte sofort mein Versehen: ich hätte aussprechen sollen: calfeutrées. Aber diese eu und ou sind eine wahre Qual für die meisten Angehörigen fremder Nationen.
Eine halbe Stunde später fragte Herr von Richelieu mich, welche von den beiden Hauptdarstellerinnen ich am schönsten fände.
„Diese da, mein Herr.“
„Aber sie hat häßliche Beine.“
„Man sieht sie nicht, mein Herr; außerdem, wenn ich die Schönheit einer Frau prüfe, schiebe ich zu allererst die Beine beiseite.“
Dieses zufällig hingeworfene Wort, an dessen Tragweite ich gar nicht gedacht hatte, machte die ganze Loge neugierig, mich kennen zu lernen. Der Marschall erfuhr von Herrn Morofini, wer ich sei, und dieser sagte mir im Auftrag des Herzogs, ich würde ihm Vergnügen machen, wenn ich mich ihm vorstellte. Mein zufällig gemachter Witz wurde berühmt, und der Herr Marschall empfing mich in der liebenswürdigsten Weise.
Unter den fremden Gesandten schloß ich mich besonders einem Botschafter des Königs von Preußen, Lordmarschall von Schottland, Keith, an. Ich werde noch Gelegenheit haben, von ihm zu sprechen.
Am Tage meiner Ankunft in Fontainebleau ging ich allein zu Hofe; ich sah Ludwig den Fünfzehnten, den schönen König, zur Messe gehen; ich sah die ganze königliche Familie und alle Hofdamen, deren Häßlichkeit mich ebensosehr überraschte, wie die Turiner Hofdamen mich durch ihre Schönheit überrascht hatten. Um so mehr erstaunte mich inmitten aller dieser Häßlichen der Anblick einer wirklichen Schönheit. Ich fragte, wer diese Dame sei. Ein Kavalier, der neben mir stand, antwortete mir: „Es ist Frau von Brionne, deren Tugendhaftigkeit noch größer ist als ihre Schönheit; denn es gibt nicht nur keine Skandalgeschichten über sie, sondern sie hat nicht einmal der Lästersucht den geringsten Anlaß geliefert, etwas über sie zu erfinden.“
„Vielleicht hat man nur nichts über sie erfahren.“
„Oh, mein Herr, bei Hofe erfährt man alles.“
Ich schlenderte allein in den inneren Gemächern umher, als ich plötzlich ein Dutzend häßliche Damen sah, die eher zu laufen als zu gehen schienen: sie standen so unsicher auf ihren Beinen, daß sie fortwährend vornüber zu fallen schienen. Da ein Herr in meiner Nähe stand, so trieb mich die Neugier, ihn zu fragen, woher die Damen kämen und warum sie so merkwürdig gingen.
„Sie kommen von der Königin, die gleich zum Essen gehen wird, und sie sind so schlecht auf den Füßen, weil ihre Schuhe sechs Zoll hohe Absätze haben, weshalb sie mit krummen Knieen gehen müssen, um nicht auf die Nase zu fallen.“
„Warum tragen sie keine niederen Absätze?“
„Es ist Mode.“
„Oh, die dumme Mode!“
Ich betrete aufs Geradewohl eine Galerie und sehe den König vorüberkommen, den einen Arm der Länge nach auf die Schultern des Herrn d’Argenson gestützt.
„Oh Knechtschaffenheit!“ dachte ich bei mir selber; „kann ein Mensch sich dazu hergeben, in solcher Weise das Joch zu tragen? Und kann ein Mensch sich so hoch über alle anderen erhaben glauben, daß er derartige Manieren annimmt?“
Ludwig hatte den schönsten Kopf, den man nur sehen kann, und er trug ihn mit ebensoviel Anmut wie Majestät. Niemals ist es dem geschicktesten Maler gelungen, den Ausdruck dieses wundervollen Kopfes wiederzugeben, wenn der Herrscher ihn wohlwollend zur Seite wandte, um jemanden anzusehen. Seine Schönheit und seine Anmut rissen auf den ersten Blick zur Liebe hin. Als ich ihn sah, glaubte ich, der idealen Majestät begegnet zu sein, die ich zu meiner Enttäuschung an dem König von Sardinien nicht gefunden hatte. Ich bezweifelte nicht, daß Frau von Pompadour in dieses schöne Gesicht verliebt war, als sie sich um die Bekanntschaft ihres Gebieters bemühte. Vielleicht täuschte ich mich; aber wer König Ludwigs Gesicht sah, der mußte so denken.
Ich kam in einen prachtvollen Saal und sah dort etwa ein Dutzend auf und abgehender Hofkavaliere und eine Tafel für mindestens zwölf Personen, die jedoch nur für eine einzige Person hegerichtet war.
„Für wen ist dieses Gedeck?“
„Für die Königin. Dort kommt sie.“
Ich sah die Königin von Frankreich; sie hatte kein Rot aufgelegt und war einfach gekleidet, den Kopf mit einer großen Mütze bedeckt. Ihr Gesicht war alt und ihre Miene fromm. Sie trat an den Tisch heran und dankte freundlich zwei Nonnen, die einen Teller mit frischer Butter hinsetzten. Die Königin nahm Platz und sofort stellten die zwölf Hofkavaliere sich zehn Schritte vom Tische entfernt in einem Halbkreis auf. Ich gesellte mich zu ihnen, indem ich ihr ehrfurchtsvolles Schweigen nachahmte.
Ihre Majestät begann zu essen, ohne jemanden anzusehen, denn sie hielt die Augen auf ihren Teller gesenkt. Eine Speise, die ihr vorgesetzt wurde, schmeckte ihr; sie ließ sich zum zweitenmal davon geben und nun durchmaßen ihre Augen den Halbkreis vor ihr, ohne Zweifel, um zu sehen, ob nicht unter diesen Beobachtern jemand wäre, dem sie über ihre Leckerhaftigkeit Rechenschaft geben müßte. Sie fand ihn und sagte: „Herr von Löwendal!“
Auf diesen Anruf trat eine prächtige Männergestalt vor, neigte den Kopf und sagte: „Madame.“
„Ich glaube, dieses Ragout ist ein Hühnerfrikassee.“
„Ich bin derselben Ansicht, Madame“.
Nach dieser Antwort, die im ernstesten Ton gegeben wurde, fuhr die Königin fort, zu essen, und der Marschall begab sich, rückwärts schreitend, wieder auf seinen Platz. Die Königin beendete ihre Mahlzeit, ohne ein weiteres Wort zu sagen, und kehrte in ihre Gemächer zurück, wie sie gekommen war. Ich dachte bei mir selber, wenn die Könige von Frankreich alle ihre Mahlzeiten in derselben Weise abhielten, so würde ich niemanden um die Ehre beneiden, ihr Tischgenosse zu sein.
Ich war entzückt, den berühmten Kriegsmann gesehen zu haben, dem Bergen-op-Zoom sich hatte ergeben müssen, aber mit innerem Schmerz hatte ich’s angehört, daß ein so großer Mann auf eine Frage wegen eines Hühnerfrikassees in demselben Tone antworten mußte, worin ein Richter ein Todesurteil ausspricht.
Um diese Anekdote bereichert, gab ich sie bei Sylvia während eines ausgezeichneten Diners zum besten, bei dem ich die Auslese der angenehmen Gesellschaft fand.
Einige Tage später war ich wieder früh morgens um zehn im Schloß und bildete mit einer Menge von Hofkavalieren Spalier, um das stets wieder neue Vergnügen zu haben, den König in die Messe gehen zu sehen; zu diesem Vergnügen muß ich noch ein zweites erwähnen, nämlich den ganzen Busen und die ganzen Schultern seiner Töchter Mesdames de France entblößt zu sehen. Plötzlich bemerkte ich die Cavamacchie, die ich in Cesena zuletzt unter dem Namen der Signora Querini gesehen hatte. Wenn ihr Anblick mich überraschte, so war sie nicht weniger erstaunt, mich an einem solchen Ort zu sehen. Der Marquis de St.-Simon, erster Kammerherr des Prinzen Conde, reichte ihr den Arm.
„Signora Querini! Sie hier!?“
„Ich erinnere mich des Wortes der Königin Elisabeth: Pauper ubique jacet.“
„Der Vergleich ist sehr richtig, gnädige Frau.“
„Ich scherze, mein lieber Freund; ich komme hierher, um den König zu sehen, der mich nicht kennt; aber morgen wird der Gesandte mich vorstellen.“
Sie trat fünf oder sechs Schritte von mir in die Reihe dicht bei der Tür, aus der der König heraustreten mußte. Seine Majestät erschienen, Herrn von Richelieu an Ihrer Seite und beäugelten die sogenannte Signora Querini. Ohne Zweifel gefiel sie ihm nicht, denn ohne stehen zu bleiben, sagte er zu seinem Freunde die bemerkenswerten Worte, die Giulietta hören mußte: „Wir haben hier schönere.“
Nach dem Essen ging ich zum venetianischen Botschafter. Ich fand ihn beim Dessert in großer Gesellschaft. Zu seiner Rechten saß Frau Querini, die mir die schmeichelhaftesten und freundschaftlichsten Sachen sagte. Dies war ganz außerordentlich von Seiten einer hitzköpfigen Person, die durchaus keinen Anlaß hatte, mich zu lieben; denn sie wußte, daß ich sie gründlich kannte und daß ich verstanden hatte, mit ihr fertig zu werden. Ich durchschaute jedoch den Grund ihres ganzen Verhaltens und beschloß, sie nicht zu enttäuschen, sondern sogar eine edle Rache zu nehmen, indem ich ihr alle Dienste erwiese, die in meiner Macht ständen.
Sie hatte das Gespräch auf Herrn Querini gebracht, und der Botschafter beglückwünschte sie dazu, daß er ihr durch die Heirat hätte Gerechtigkeit widerfahren lassen.
„Dies wußte ich nämlich nicht“, setzte er hinzu.
„Die Heirat ist aber schon länger als zwei Jahre her“, sagte Giulietta.
„Das ist eine Tatsache“, nahm nun ich das Wort; „denn vor zwei Jahren hat General Spada sie unter dem Namen und mit dem Titel Ihrer Exzellenz Frau Querini dem ganzen Adel von Cesena vorgestellt, wo ich die Ehre hatte, mich aufzuhalten.“
„Ich zweifle nicht daran“, fagte der Gesandte mit einem scharfen Blick auf mich; „denn Querini selber schrieb mir dies.“
Als ich einige Augenblicke später mich verabschieden wollte, sagte der Gesandte, er hätte mehrere Briefe erhalten, deren Inhalt er mir mitteilen möchte, und bat mich, mit ihm in sein Arbeitszimmer zu treten. Dort fragte er mich, was man in Venedig zu dieser Heirat sagte.
„Kein Mensch weiß ein Wort davon; man sagt sogar, der älteste des Hauses Querini werde eine Grimani heiraten, aber ich werde diese Nachricht nach Venedig schreiben.“
„Was für eine Nachricht?“
„Daß Giulietta wirklich Frau Querini ist, da Eure Exzellenz sie als solche dem König vorstellen werden.“
„Wer hat Ihnen das gesagt?“
„Giulietta selber.“
„Es kann wohl sein, daß sie ihre Absicht geändert hat.“
Ich erzählte ihm hierauf die Worte, die der König zu Herrn von Richelieu über Giulietta geäußert hatte.
„Ach so!“ sagte Seine Exzellenz; „jetzt errate ich auch, warum Giulietta ihm nicht mehr vorgestellt zu werden wünscht.“
Später habe ich erfahren, Herr de St.-Quintin, der Geheimminister der Privatwünsche des Königs, sei nach der Messe zur schönen Venetianerin gekommen und habe ihr gesagt, der König von Frankreich müsse einen recht schlechten Geschmack haben, denn er habe sie nicht schöner gefunden, als mehrere andere Damen, die sich an seinem Hof befänden.
Giulietta reiste am nächsten Tage von Fontainebleau ab.
Ich habe zu Beginn meiner Memoiren von Giuliettas Schönheit gesprochen: sie hatte in ihren Gesichtszügen außerordentliche Reize; aber sie hatte schon recht lange Zeit davon Gebrauch gemacht, und so waren sie schon ein bißchen verblüht, als sie nach Fontainebleau kam.
Ich sah sie in Paris beim Gesandten wieder, und sie sagte mir lachend, sie habe nur gescherzt, indem sie sich Frau Querini genannt und ich würde ihr Vergnügen machen, indem ich sie in Zukunft nur bei ihrem wahren Namen Gräfin Preati nennte. Sie bat mich, sie im Hotel du Luxembourg zu besuchen, wo sie wohnte. Ich ging oft hin, um mich über ihre Intrigen zu amüsieren, aber ich war zum Glück so vernünftig, mich niemals hineinzumischen.
Sie verbrachte vier Monate in Paris, und sie hatte das Talent, den Sekretär der venetianischen Botschaft, Herrn Zanchi, einen liebenswürdigen, vornehmen und gebildeten Mann, verliebt zu machen. Sie machte ihn so verliebt, daß er entschlossen war, sie zu heiraten; aber in einer Laune, die ihr vielleicht später leid tat, behandelte sie ihn schlecht, und der Dummkopf starb aus Kummer darüber. Der Botschafter der Kaiserin Maria Theresia, Graf Kaunitz, fand Geschmack an ihr; desgleichen der Graf von Zinzendorf. Der Vermittler bei diesen flüchtigen Liebeleien war ein gewisser Abbé Guasco, der wenig von Plutus begünstigt und obendrein häßlich war, daher nur durch seine Gefälligkeiten hier und da eine Gunst erhoffen konnte. Der Mann jedoch, auf den sie es ernstlich abgesehen hatte und dessen Frau sie werden wollte, war der Graf St.-Simon; dieser Graf hätte sie geheiratet, wenn sie ihm nicht falsche Adressen angegeben hätte, bei denen er sich nach ihrer Herkunft erkundigen könnte. Die Familie Preati von Verona verleugnete sie natürlich, und Herr von St.-Simon, der trotz seiner Liebe sich noch einige gesunde Vernunft bewahrt hatte, besaß die Kraft, sie zu verlassen. Kurz und gut, Paris war kein Dorado für meine schöne Landsmännin; denn sie mußte dort ihre Diamanten als Pfand zurücklassen. Sie kehrte nach Venedig zurück und heiratete dort den Sohn des nämlichen Uccelli, der sie sechzehn Jahre früher aus dem Elend gezogen hatte. Vor zehn Jahren ist sie gestorben. Ich nahm immer noch meine französischen Unterrichtsstunden bei meinem guten alten Crébillon. Trotzdem wimmelte meine Sprache von Italianismen, und ich sagte oft in Gesellschaft das Gegenteil von dem, was ich ausdrücken wollte; aber meine Quiproquo liefen fast immer auf eigentümliche Scherze hinaus, die Erfolg hatten, und das beste dabei war, daß mein Jargon mir keinen Schaden tat, indem er mich nicht als Dummkopf erscheinen ließ. Er verschaffte mir im Gegenteil schöne Bekanntschaften.
Mehrere Damen der ersten Kreise baten mich, sie Italienisch zu lehren, um, wie sie sagten, sich selber das Vergnügen zu verschaffen, mich Französisch zu lehren: bei diesem Austausch gewann ich mehr als sie.
Frau Préodot, eine meiner Schülerinnen, empfing mich eines Tages in ihrem Bett, indem sie mir sagte, sie habe keine Lust, ihre Stunde zu nehmen, weil sie am Abend vorher Medizin genommen habe. Dummerweise einen italienischen Ausdruck wörtlich übersetzend, fragte ich sie im Ton der tiefsten Teilnahme, ob sie tüchtig entladen (bien déchargé) habe.
„Mein Herr, was fragen Sie da! Sie sind unerträglich.“ Ich wiederhole meine Frage; neuer Zornausbruch auf Seiten der Dame: „Sprechen Sie niemals dies abscheuliche Wort aus!“
„Sie mögen sich entrüsten, so viel sie wollen: es ist gerade das passende Wort.“
„Im Gegenteil, höchst unpassend, mein Herr; aber lassen wir das Thema. Wollen Sie frühstücken?“
„Nein, ich habe schon; ich habe ein Kaffee mit Savoyarden genommen.“
„Ach, guter Gott! ich bin verloren! Was für ein rasendes Frühstück! Erklären Sie sich!“
„Ich habe ein Kaffee genommen und zwei Savoyarden gegessen, die ich hineingetaucht, wie ich es jeden Morgen mache.“
„Aber, das ist dumm, lieber Freund, ein Kaffee ist die Wirtschaft, worin man ihn verkauft; man trinkt eine Tasse Kaffee.“
„Gut! Trinken Sie die Tasse; wir sagen in Italien ein Kaffee und haben so viel Witz, nicht zu glauben, daß dies die Wirtschaft sei.“
„Er will durchaus recht haben! Und die beiden Savoyarden? Wie haben Sie denn die verschlungen?“
„Ich habe sie in den Kaffee gesteckt, denn sie waren nicht größer als die, die Sie hier auf dem Tische haben.“
„Und das nennen Sie Savoyarden? Sagen Sie Zwiebacke.“
„In Italien nennen wir sie Savoyarden, weil man sie in Savoyen erfunden hat, und es ist nicht meine Schuld, wenn Sie geglaubt haben, ich hätte zwei Dienstleute von der Ecke verschluckt, große Bengel, die Sie in Paris Savoyarden nennen und die oft genug niemals in Savoyen gewesen sind.“
In diesem Augenblick trat ihr Mann ein, und schleunigst erzählte sie ihm unsere ganze Unterhaltung.
Er lachte sehr darüber, aber er gab mir recht. Während wir noch darüber sprachen, kam seine Nichte, ein junges Mädchen von vierzehn Jahren, sittsam, bescheiden und klug. Ich hatte ihr fünf oder sechs Unterrichtsstunden gegeben und da sie die italienische Sprache sehr liebte und sich unaufhörlich darin übte, so begann sie schon zu sprechen. Sie wollte mir ein Kompliment auf italienisch machen und sagte. „Signore, sono incantata di vi vedere in buona salute.“
„Ich danke Ihnen, mein Fräulein; aber um zu übersetzen: ich bin entzückt, muß man sagen; ho piacere, und Sie zu sehen heißt: di vedervi.“
„Ich glaubte, mein Herr, man müßte das vi vorsetzen.“
„Nein, mein Fräulein, wir setzen es hinten.“
Sofort platzen Herr Préodot und seine Frau los; das Fräulein ist verwirrt, ich aber war sprachlos und ganz verzweifelt, eine so ungeheure Dummheit gesagt zu haben, aber es war nun einmal geschehen. Schmollend nahm ich ein Buch, in der Hoffnung, ihr Gelächter würde doch einmal aufhören: es dauerte eine Woche. Meine unbeabsichtigte Zote wurde in ganz Paris belacht und verschaffte mir eine Art von Berühmtheit, die erst dann sich verminderte, als es mir allmählich gelang, die Bedeutung der Sprache besser kennen zu lernen. Crébillon lachte sehr über meinen Schnitzer und sagte mir, ein anderes Mal müßte ich aprés sagen und nicht derriére; aber warum haben auch nicht alle Sprachen denselben Geist! Übrigens, wenn die Franzosen sich über die Fehler erheiterten, die ich in ihrer Sprache machte, so vergalt ich es ihnen nicht übel, indem ich gewisse lächerliche Gebräuche bloßstellte.
„Mein Herr“, sagte ich zu einem, „wie befindet sich Ihre Frau Gemahlin?“
„Sie erweisen ihr viel Ehre!“
„Ei, ich bitte Sie, um was für Ehre kann es sich handeln, wenn man nur von Gesundheit spricht?“
Ich sehe im Boulognerwäldchen einen jungen Mann sein Pferd tummeln; er hat es aber nicht in der Gewalt, und schließlich wirft es ihn ab. Ich halte das Pferd an und eile dem jungen Mann zu Hilfe, der sich mit meiner Unterstützung wieder aufrichtet.
„Haben Sie sich weh getan?“
„O! danke mein Herr, im Gegenteil!“
„Wie zum Teufel, im Gegenteil! Sie haben sich also wohlgetan, dann fangen Sie nur gleich wieder an, mein Herr!“
Und tausend Widersinnigkeiten dieser Art! Aber so ist nun einmal der Geist der Sprache.
Eines Tages war ich zum erstenmal bei der Frau Präsidentin de N., als ihr Neffe, ein glänzender Stutzer, eintrat; sie stellte mich ihm vor, indem sie ihm meinen Namen und meine Heimat nannte.
„Wie, mein Herr, Sie sind Italiener? Meiner Seel, Sie sehen so gut aus, daß ich hätte wetten mögen, Sie seien Franzose!“
„Mein Herr, bei ihrem Anblick bin ich in dieselbe Falle geraten. Ich hätte darauf schwören mögen, Sie seien Italiener.“
Ich war bei Lady Lambert mit zahlreicher und glänzender Gesellschaft zum Diner. Man bemerkte einen Karneol, den ich am Finger trug und worauf mit großer Kunst der Kopf Ludwigs des Fünfzehnten eingeschnitten war. Mein Ring machte die Runde um den Tisch, und jeder fand die Ähnlichkeit verblüffend.
Eine junge Marquise, die für besonders geistreich galt, fragte mich mit der ernstesten Miene:
„Ist es wirklich eine Antike?“
„Der Stein, gnädige Frau, ganz gewiß.“
Alle lachten, mit Ausnahme der liebenswürdigen Zerstreuten, die gar nicht darauf achtete. Beim Nachtisch sprach man vom Rhinozeros, das für vierundzwanzig Sous auf dem Jahrmarkt von St.-Germain zu sehen war.
„Gehen wir hin! Gehen wir hin!“
Wir stiegen in unsere Wagen und kamen an. Dort machten wir einige Rundgänge durch die Alleen, bis wir den richtigen Ort fanden. Ich war der einzige Kavalier und hatte zwei Damen gegen die Belästigungen der Menge zu beschützen, und die geistreiche Marquise ging vor uns. Am Ende der Allee, wo das Tier, wie man uns gesagt harte, sich befinden sollte, saß ein Mann, um das Eintrittsgeld einzunehmen. Dieser Mann, in afrikanischer Tracht, war allerdings sehr dunkel von Hautfarbe und riesig dick; trotzdem aber hatte er doch menschliche Gestalt und sogar ausgesprochen männliche, und die schöne Marquise hätte sich eigentlich nicht irren dürfen. Aber in ihrer Gedankenlosigkeit geht sie auf ihn zu und fragt ihn:
„Sind Sie, mein Herr, das Rhinozeros?“
„Nur herein, Madame, nur herein!“
Wir wären vor Lachen beinahe erstickt, besonders als nun die Marquise das Tier sah und sich verpflichtet fühlte, dessen Herrn um Entschuldigung zu bitten, indem sie ihm versicherte, sie hätte in ihrem Leben noch nie ein Rhinozeros gesehen, und er dürfte sich daher nicht beleidigt fühlen, wenn sie sich geirrt hätte.
Eines Tages war ich im Foyer der italienischen Komödie, wohin in den Zwischenakten die vornehmsten Herren kamen, um mit den Künstlerinnen zu plaudern und zu lachen, die da sitzen und auf den Augenblick ihres Auftretens warten. Ich saß neben Coralinens Schwester, Camille, die ich zum lachen brachte, indem ich ihr süßen Unsinn erzählte. Ein junger Rat ärgerte sich darüber, daß ich sie beschäftigte, und griff mich auf eine sehr selbstgefällige Weise an, indem er eine Bemerkung kritisierte, die ich über ein italienisches Stück gemacht hatte; dabei erlaubte er sich, seine schlechte Laune zu zeigen, indem er meine Nation kritisierte. Ich gab ihm jede Bemerkung zurück, indem ich dabei die lachende Camilla ansah. Um uns herum stand ein ganzer Kreis und verfolgte aufmerksam das Gefecht, das bis dahin nur mit den Waffen des Witzes geführt wurde und nichts Unangenehmes hatte. Es schien aber ernst werden zu wollen, als der Stutzer die Rede auf die städtische Polizei brachte und zu mir sagte, seit einiger Zeit sei es gefährlich, bei Nacht zu Fuß durch die Pariser Straßen zu gehen. „Im Laufe des vorigen Monats haben auf dem Grèveplatz sieben am Galgen gebaumelt, darunter fünf Italiener; das ist erstaunlich.“
„Dabei ist gar nichts erstaunlich“, versetzte ich, „denn anständige Leute lassen sich fern von ihrer Heimat hängen; so wurden zum Beispiel im Laufe des letzten Jahres zwischen Neapel, Rom und Venedig sechzig Franzosen gehängt; fünfmal zwölf sind sechzig; es ist also, wie Sie sehen, nur ein Tauschgeschäft.“
Die Lacher waren auf meiner Seite, und der schöne Herr Rat machte sich ein wenig verwirrt davon. Einer der Umstehenden fand meine Antwort gut, trat an Camille heran und fragte sie leise, wer ich sei. Damit war die Bekanntschaft gemacht. Es war Herr de Marigny. Ich war hocherfreut, seine Bekanntschaft zu machen, meines Bruders wegen, den ich jeden Tag erwartete. Herr von Marigny war Oberintendant der königlichen Gebäude, und die Malerakademie stand unter ihm. Ich sprach mit ihm über meinen Bruder, und er versprach mir huldvoll, ihn beschützen zu wollen. Ein anderer junger Kavalier, der mit mir in ein Gespräch geraten war, bat mich, ihn zu besuchen; es war der Herzog von Matalone. Ich sagte ihm, ich hätte ihn vor acht Jahren als Kind in Neapel gesehen, und ich hätte große Verpflichtungen gegen seinen Oheim Don Lelio; der junge Herzog war entzückt darüber, und wir wurden vertraute Freunde.
Im Frühling 1751 kam mein Bruder nach Paris und nahm Wohnung bei Frau Quinson, wo auch ich wohnte. Er begann mit Erfolg für Privatleute zu arbeiten; seine Hauptabsicht war jedoch, ein Gemälde zu vollenden, um es dem Urteil der Akademie zu unterbreiten.
Ich stellte ihn daher Herrn de Marigny vor, der ihn ausgezeichnet aufnahm und ihn ermutigte, indem er ihm seine Protektion versprach.
Infolgedessen legte mein Bruder sich wieder aufs Studium und betrieb es mit großem Eifer.
Herr de Morosini war nach Venedig zurückgekehrt, und an seiner Stelle war Herr von Mocenigo Botschafter geworden. Ich war an ihn durch Herrn von Bragadino empfohlen, und er öffnete mir sein Haus, wie auch meinem Bruder; denn er hielt es sür seine Pflicht, diesen als Venetianer und als jungen Künstler zu beschützen, der durch sein Talent sein Glück zu machen suchte.
Herr von Mocenigo war von sehr mildem Charakter. Er liebte das Spiel und verlor stets; er liebte die Frauen und war unglücklich, weil er sie nicht zu nehmen wußte. Zwei Jahre nach seiner Ankunft in Paris verliebte er sich in Madame de Colande und da er sich nicht ihre Gegenliebe erringen konnte, nahm er sich das Leben.
Die Frau Dauphine gebar den Herzog von Burgund, und die Freudenfeste, die bei dieser Gelegenheit stattfanden, erscheinen mir heute unglaublich, wenn ich sehe, was dieseselbe Nation gegen ihren König macht. Die Nation will sich frei machen; ihr Ehrgeiz ist edel, denn der Mensch ist nicht geschaffen, um Sklave des Willens eines anderen Menschen zu sein; aber was wird aus dieser Revolution werden unter einer volkreichen, großen, geistvollen und leichtfertigen Nation? Die Zeit muß es uns lehren.
Durch den Herzog von Matalone machte ich die Bekanntschaft der römischen Fürsten Don Marcantonio und Don Giambattista Vorghese, die sich in Paris amüsierten, wo sie ohne Verschwendung lebten.
Ich hatte Gelegenheit zu bemerken, daß man diesen römischen Principi, wenn sie am Hof von Frankreich vorgestellt wurden, nur den Titel Marquis gab. Man verweigerte den Fürstentitel auch den russischen Fürsten, die sich bei Hofe vorstellen ließen. Man nannte sie Knees und das war ihnen einerlei; denn dieses Wort bedeutet Fürst. Der französische Hof war stets in dummer Weise kleinlich in bezug auf Titel. Man geizte und geizt noch jetzt mit dem einfachen Titel Monsieur, den man auf allen Straßen hört: Man sagt Monsieur zu jeder Person, die keinen Adelstitel führt. Ich habe beobachtet, daß der König seine Bischöfe nur mit Abbé anredete, obgleich diese Herren sehr viel aus ihre Titel halten. Wenn ein adeliger Herr seines Reiches nicht seinen Namen in die Liste der Kavaliere eintragen ließ, die dem Hofe ihre Dienste zur Verfügung stellten so tat er, als kenne er ihn nicht.
Sein Hochmut war jedoch dem König Ludwig nur durch seine Erziehung eingeflößt; er war ihm nicht natürlich; wenn sein Gesandter ihm jemanden vorstellte, so zog der Vorgestellte sich mit der Gewißheit zurück, daß der König ihn gesehen hatte, aber das war auch alles. Im übrigen war der König sehr höflich, besonders gegen die Damen, auch gegen seine Mätressen bei öffentlichem Auftreten. Wer gegen sie den geringsten Verstoß beging, der fiel in Ungnade. Niemand besaß in höherem Maße als er die große königliche Tugend, die man Verstellung nennt. Er war ein getreuer Hüter eines Geheimnisses, und er war entzückt, wenn er sicher zu sein glaubte, daß niemand außer ihm es wüßte. Der Chevalier d’Eon ist ein kleines Beispiel dafür; denn der König allein wußte und hatte stets gewußt, daß er eine Frau war, und der ganze Streit des falschen Chevaliers mit dem Ministerium des Auswärtigen war eine Komödie, die der König zu seiner Belustigung sich bis zu ihrem Ende abspielen ließ.
Ludwig war groß in allem, und er wäre ohne Fehler gewesen, hätte nicht die Schmeichelei ihn gezwungen, welche zu haben. Aber wie hätte er Fehler an sich erkennen können, wenn man ihm jeden Tag wiederholte, er sei der beste aller Könige. Ein König aber, von der Art, wie er nach dem, was man ihm sagte, sich selber vorstellen mußte, war etwas so weit über die gewöhnliche Menschheit Erhabenes, daß er sich berechtigt glauben mußte, sich für eine Art Gott zu halten. Trauriges Geschick der Könige! Erbärmliche Schmeichler tun beständig alles, was erforderlich ist, sie noch unter den gewöhnlichen Menschen herabzudrücken.
Um diese Zeit bekam die Prinzessin von Ardore einen jungen Prinzen. Ihr Gemahl, der neapolitanischer Gesandter war, sprach den Wunsch aus, Ludwig der Fünfzehnte möchte Patenstelle übernehmen, und der König willigte ein. Er schenkte seinem Patensohn ein Regiment, aber die Mutter, die das Militär nicht liebte, wollte davon nichts wissen. Der Marschall von Richelieu erzählte mir, er habe den König niemals so herzlich lachen sehen, wie über diese eigentümliche Weigerung.
Bei der Herzogin de Fulvie lernte ich Fräulein Gaussin, genannt Lolotte, kennen. Sie war die Geliebte des englischen Botschafters Lord Albemarle, eines geistreichen, sehr edlen und sehr freigebigen Mannes. Er beklagte sich eines Abends bei seiner Freundin, daß sie die Schönheit der Sterne priese, die am Himmelsgewölbe glänzten, da sie doch wüßte, daß er sie ihr nicht schenken könnte. Wäre Lord Albemarle Gesandter in Paris gewesen, als es zum Bruch zwischen Frankreich und England kam, er würde alle Streitigkeiten beigelegt haben, und der unglückliche Krieg, durch den Frankreich ganz Kanada verlor, hätte nicht stattgefunden. Es ist nicht zu bezweifeln, daß das gute Einvernehmen zwischen zwei Nationen fast immer von ihren Gesandten abhängt, die sie an den Höfen unterhalten, wo die Gefahr eines Zerwürfnisses droht.
Über die Geliebte dieses edlen Lords herrschte nur eine Meinung. Sie hatte alle Eigenschaften, um seine Frau zu werden; die ersten Häuser Frankreichs haben nicht gefunden, daß der Titel einer Lady Albemarle notwendig sei, um sie mit Auszeichnung aufzunehmen, und keine Dame fand es anstößig, sie an ihrer Seite sitzen zu sehen, obgleich man wußte, daß sie keinen anderen Titel hatte, als den einer Geliebten des Lords. Sie war im Alter von dreizehn Jahren aus den Armen ihrer Mutter in die des Lords Albemarle übergegangen, und ihre Aufführung war stets achtungswert. Sie hatte Kinder, die der Lord anerkannte, und sie starb als Gräfin d’Eronville. Ich werde später von ihr sprechen.
Bei Herrn de Mocenigo hatte ich auch Gelegenheit, die Bekanntschaft einer venetianischen Dame zu machen, der Witwe des englischen Ritters Winne. Sie kam mit ihren Kindern von London, wohin sie hatte gehen müssen, um ihnen die Erbschaft ihres verstorbenen Gatten zu sichern, da sie alle ihre Rechte darauf verloren haben würden, wenn sie sich nicht zur anglikanischen Religion bekannt hätten. Zufrieden mit dem Erfolge ihrer Reise, kehrte Sie jetzt nach Venedig zurück. Ihre älteste Tochter, ein Kind von zwölf Jahren, trug trotz ihrer Jugend auf ihrem schönen Gesicht alle Kennzeichen der Vollendung. Sie lebt heutzutage in Venedig als Witwe des Grafen Rosenberg, der dort als Gesandter der Kaiserin und Königin Maria Theresia starb. Sie glänzt durch ihr sittsames Leben und durch alle gesellschaftlichen Tugenden, mit denen sie geschmückt ist. Niemand findet an ihr einen anderen Fehler, als den, daß sie nicht reich ist; aber sie selber bemerkt dies nur daran, daß sie sich nicht in der Lage befindet, alles Gute zu tun, das sie tun möchte.
Im folgenden Kapitel wird der Leser sehen, wie ich einen kleinen Handel mit der französischen Gerechtigkeit hatte.