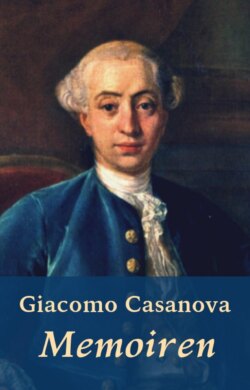Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 35
Achtes Kapitel
ОглавлениеMeine Lehrzeit in Paris. – Portraits. – Eigentümlichkeiten. – Allerlei.
Zur Feier der Ankunft ihres Sohnes gab Sylvia ein glänzendes Souper, bei welchem sie alle ihre Verwandten vereinigte, und dies war für mich eine glückliche Gelegenheit, ihre Bekanntschaft zu machen. Balettis Vater, der krank gewesen war und sich auf dem Wege der Genesung befand, nahm nicht an dem Feste teil, aber seine ältere Schwester war anwesend. Sie war unter ihrem Theaternamen Flaminia in der Republik der Wissenschaften durch einige Übersetzungen bekannt geworden; aber weniger deshalb hatte ich Lust, sie gründlich kennen zu lernen, als wegen der in ganz Italien bekannten Geschichte von dem Pariser Aufenthalt dreier bekannter Männer der Literatur. Diese drei Gelehrten waren der Marchese Maffei, Abbate Conti und Pietro Giacomo Martelli, die sich wegen ihrer Ansprüche auf die Huld der Schauspielerin verfeindet haben sollen. Als Gelehrte schlugen sie sich mit ihren Federn: Martelli schrieb gegen Maffei eine Satire, worin er ihn unter dem Anagramm Femia bezeichnete.
Da ich dieser Flaminia als Kandidat der literarischen Republik vorgestellt worden war, glaubte sie mich ehren zu müssen, indem sie sich mit ihrer Unterhaltung ganz besonders an mich wandte; aber sie hatte unrecht, denn ich fand an ihr Gesicht, Ton, Stil unangenehm, kurz und gut alles, sogar den Ton ihrer Stimme. Sie sagte es mir zwar nicht, gab es mir aber zu verstehen, daß sie als eine Berühmtheit der literarischen Welt wohl wisse, daß sie zu einem Insekt spräche. Sie gab allen ihren Aussprüchen etwas Apodiktisches, und sie glaubte in einem Alter von sechzig Jahren und mehr das Recht dazu zu haben, besonders einem jungen Neuling von fünfundzwanzig Jahren gegenüber, der noch keine Bibliothek bereichert hatte. Um ihr den Hof zu machen, sprach ich mit ihr über den Abbate Conti und zitierte bei irgend einem Anlaß zwei Verse dieses tiefen Denkers. Die Gnädige verbesserte mir mit gütiger Miene die Aussprache des Wortes scevra, das getrennt bedeutet, indem sie mir sagte, es müsse sceura ausgesprochen werden; sie fügte hinzu, es würde mir jedenfalls nicht unangenehm sein, in Paris schon am ersten Tage meiner Ankunft etwas gelernt zu haben; mit diesem Tag begänne ein neuer Zeitabschnitt meines Lebens.
„Gnädige Frau, ich bin hierher gekommen, um zu lernen und nicht um zu verlernen, und Sie werden mir erlauben, Ihnen zu sagen, daß man scevra mit v sagen muß und nicht sceura mit u; denn dieses Wort ist eine Zusammenziehung von sceverra.“
„Es kommt darauf an, wer von uns beiden sich irrt.“
„Sie, gnädige Frau; denn Ariosto reimt scevra mit perscevra, einem Wort, das Schlecht mit sceura zusammenklingen würde, denn dieses ist gar nicht italienisch.“
Sie wollte ihre Behauptung verteidigen, aber ihr Mann, ein alter Herr von achtzig Jahren, sagte ihr, sie hätte unrecht. So schwieg sie dann, aber von diesem Augenblick an sagte sie jedem, der es hören wollte, ich sei ein Betrüger.
Ihr Gatte, Luigi Riccoboni, wurde Lelio genannt. Er hatte im Jahre 1716 die Truppe nach Paris in den Dienst des Herzogs-Regenten gebracht. Er war ein verdienstvoller Mann. Er war früher sehr schön gewesen und genoß mit Recht der allgemeinen Achtung, sowohl wegen seines Talentes wie wegen der Reinheit seiner Sitten. Während der Mahlzeit war meine Hauptbeschäftigung, Sylvia zu studieren, die auf der Höhe ihres Ruhmes stand; nach meiner Meinung übertraf sie alles, was man über sie gedruckt hatte. Sie war ungefähr fünfzig Jahre alt, hatte einen eleganten Wuchs, edlen Gesichtsausdruck, gewandte Manieren, sie war liebenswürdig, lachlustig, fein in ihren Bemerkungen, entgegenkommend gegen jedermann, geistvoll und durchaus anspruchslos. Ihr Gesicht war ein Rätsel; denn es flößte ein sehr lebhaftes Interesse ein, gefiel allgemein und hatte trotzdem bei näherer Prüfung nicht einen einzigen ausgesprochenen schönen Zug. Man konnte nicht sagen, daß sie schön sei; aber ganz gewiß wäre es niemand eingefallen, sie häßlich zu finden; trotzdem gehörte sie nicht zu jenen Frauen, die weder schön noch häßlich sind; denn sie hatte ein gewisses unbeschreiblich Interessantes an sich, das in die Augen sprang und fesselte. Aber wie war sie denn nun eigentlich?
Schön – aber schön nach Gesetzen, die einem jeden unbekannt waren, der sich nicht durch unwiderstehliche Gewalt zu ihr hingezogen fühlte und sie lieben mußte, der infolgedessen nicht den Mut hatte, sie zu studieren, und nicht die Ausdauer, sie schließlich doch kennen zu lernen.
Sylvia war der Abgott Frankreichs, und ihr Talent war die Stütze aller Komödien, die die größten Schriftsteller für sie verfaßten, besonders Marivaux. Ohne sie wären diese Komödien nicht auf die Nachwelt gekommen. Man hat niemals eine Schauspielerin gefunden, die sie hätte ersetzen können, denn diese hätte alle Vorzüge vereinigen müssen, die Sylvia in ihrer schwierigen Kunst besaß: Beweglichkeit, Stimme, Geist, Gesichtsausdruck, Haltung und eine große Kenntnis des menschlichen Herzens. Alles an ihr war Natur, und die Kunst, die diese Natur vervollkommnete, blieb stets verborgen.
Zu den eben erwähnten Eigenschaften fügte Sylvia noch eine andere hinzu, die ihr einen neuen Glanz verlieh, obwohl sie auch ohne diesen Vorzug auf der Bühne stets an erster Stelle geglänzt haben würde: ihre Aufführung war stets makellos. Sie wollte nur Freunde haben, niemals Liebhaber. Somit lachte sie eines Vorrechtes, dessen sie hätte genießen können, das sie aber in ihren eigenen Augen verächtlich gemacht haben würde. Dieser Aufführung verdankte sie den Ruf einer achtbaren Frau in einem Alter, wo ein solcher allen ihren Berufsgenossinnen lächerlich oder gar beleidigend hätte erscheinen können. Zahlreiche Damen von höchstem Range beehrten sie mehr noch mit ihrer Freundschaft, als mit ihrer Protektion. Niemals wagte das launenhafte Parkett Sylvia auszuzischen, nicht einmal in den Rollen, die ihm nicht gefielen; man sagte einmütig, die berühmte Schauspielerin sei eine Frau, die hoch über ihrem Beruf stehe.
Sylvia war der Meinung, daß ihre gute Aufführung ihr nicht als Verdienst angerechnet werden könnte, denn sie wußte, daß sie auch deshalb so ehrbar war, weil ihr Selbstgefühl bei dieser Ehrbarkeit seine Rechnung fand; deshalb zeigte sie niemals Stolz oder Überlegenheit in ihren Beziehungen zu ihren Kolleginnen, obgleich diese sich wenig draus machten, durch Tugend berühmt zu werden, sondern zufrieden waren, wenn sie durch ihre Begabung oder ihre Schönheit glänzten. Sylvia hatte sie alle gern und wurde von allen wiedergeliebt; sie ließ ihrem Verdienst öffentlich Gerechtigkeit widerfahren und lobte sie aufrichtig; aber man fühlte, daß sie dabei nichts verlor, denn da sie sie an Talent übertraf und ihr Ruf unantastbar war, konnten die anderen sie nicht in den Schatten stellen.
Die Natur hat dieser einzigen Frau zehn Jahre ihres Lebens geraubt; denn im Alter von sechzig Jahren, zehn Jahre nach unserer Bekanntschaft, wurde sie schwindsüchtig; das Pariser Klima spielt den italienischen Schauspielerinnen ziemlich oft solche Streiche. Zwei Jahre vor ihrem Tode sah ich sie die Rolle der Marianna im Marivaurschen Stücke spielen, und trotz ihrem Alter und ihrem Zustand war die Illusion vollständig. Sie starb in meiner Gegenwart, ihre Tochter umschlungen haltend; fünf Minuten vor ihrem Verscheiden gab Sie ihre letzten Ratschläge. Sie erhielt ein ehrenvolles Begräbnis in Saint-Sauveur, ohne daß der ehrwürdige Geistliche den geringsten Widerspruch erhob; im Gegenteil, dieser würdige Seelenhirte, der von der unchristlichen Unduldsamkeit seiner meisten Amtsbrüder weit entfernt war, sagte: Trotz ihrem Beruf als Schauspielerin sei sie doch eine gute Christin gewesen, und die Erde sei die gemeinsame Mutter von uns allen, wie Jesus Christus der Heiland der ganzen Welt sei.
Du wirst mir verzeihen, lieber Leser, daß ich, ohne jede Absicht, ein Wunder zu vollbringen, dich zehn Jahre vor Sylvias Tode an ihrem Begräbnis habe teilnehmen lassen; hiefür werde ich dir diese Mühe ersparen, wenn wir so weit sind.
Ihre einzige Tochter, die sie zärtlich liebte, saß bei Tisch neben ihrer Mutter; sie war damals erst neun Jahre alt. Ganz in Anspruch genommen von der Aufmerksamkeit, die ich ihrer Mutter widmete, beachtete ich sie damals gar nicht; sie sollte mich aber später beschäftigen. Nach dem Abendessen, das sehr lange dauerte, begab ich mich zu meiner Wirtin, Frau Quinson, bei der ich mich sehr gut aufgehoben fand. Als ich am anderen Morgen erwachte, kam Frau Quinson in mein Zimmer und sagte mir, es wäre ein Bedienter draußen, der mir seine Dienste anbieten wollte. Ich ließ ihn eintreten und sah einen Menschen von sehr kleinem Wuchs, was mir nicht gefiel. Ich sagte es ihm.
„Meine Kleinheit, mein Prinz, wird Ihnen dafür bürgen, daß ich nicht Ihre Kleider anziehen werde, um auf Liebesabenteuer auszugehen.“
„Wie heißen Sie?“
„Wie Sie wollen!“
„Wie? Ich frage nach dem Namen, den Sie führen!“
„Ich habe gar keinen. Jeder Herr, dem ich diene, gibt mir einen nach seinem Gefallen, und ich habe in meinem Leben mehr als fünfzig gehabt. Ich werde bei Ihnen den Namen führen, den Sie mir geben.“
„Aber Sie müssen doch einen Familiennamen haben?“
„Ich habe niemals Familie gehabt. In meiner Jugend hatte ich einen Namen; aber in den zwanzig Jahren, seitdem ich diene und mit meinem Herrn auch meinen Namen wechsele, habe ich ihn vergessen.“
„Nun, ich werde Sie Esprit nennen.“
„Sie erweisen mir eine große Ehre.“
„Holen Sie mir für diesen Louis Kleingeld!“
„Hier, mein Herr.“
„Ich sehe, Sie sind reich.“
„Ganz zu Ihren Diensten.“
„Bei wem kann ich mich nach Ihnen erkundigen?“
„Im Stellenvermittlungsbureau. Übrigens wird Frau Quinson Ihnen Auskunft über mich geben können: ganz Paris kennt mich.“
„Das genügt. Ich gebe Ihnen täglich dreißig Sous; ich kleide Sie nicht, Sie schlafen, wo Sie wollen, und stehen jeden Morgen um sieben Uhr zu meinem Befehl.“
Baletti besuchte mich und bat mich, täglich bei ihm zu essen. Ich ließ mich nach dem Palais Royal führen und ließ Esprit am Eingang.
Neugierig auf diesen so viel gepriesenen Ort, begann ich zunächst alles ein bißchen zu beobachten. Ich sah einen ziemlich schönen Garten, Alleen von großen Bäumen, Wasserbecken, hohe Häuser rundherum, viele spazierengehende Herren und Damen und überall Verkaufsstände, wo man neuerschienene Druckschriften, wohlriechende Wässer, Zahnstocher und allerlei kleinen Kram haben konnte. Ich sah eine Menge Strohstühle, die für einen Sou vermietet wurden; Zeitungsleser, die im Schatten saßen, Freudenmädchen und Herren, die allein oder in Gesellschaft frühstückten, und Kaffeekellner, die schnell eine durch Gesträuch verdeckte kleine Treppe herauf und hinunter liefen.
Ich setzte mich an einen kleinen Tisch; sofort kam ein Kellner und fragte mich, was ich wünschte. Ich verlangte Wasserschokolade; er brachte mir eine abscheulich schlechte in einer prachtvollen Vermeiltasse. Ich bestellte Kaffee, wenn er guten hätte.
„Ausgezeichneten! Ich habe ihn selber gestern gemacht.“
„Gestern? Den will ich nicht.“
„Unsere Milch ist ausgezeichnet!“
„Milch? Die trinke ich niemals. Machen Sie mir eine Tasse Kaffee mit Wasser!“
„Mit Wasser? Solchen machen wir nur nachmittags. Wollen Sie eine gute Fruchtcreme, eine Karaffe Mandelmilch?“
„Jawohl! Mandelmilch.“
Ich fand das Getränk ausgezeichnet und beschloß, es täglich zum Frühstück zu nehmen; ich fragte den Kellner, ob es etwas Neues gäbe; er antwortete, die Dauphine sei mit einem Prinzen niedergekommen. Ein Abbé, der dicht nebenan an einem Tische saß, sagte zu ihm: „Unsinn! sie hat eine Prinzessin zur Welt gebracht.“
Ein Dritter trat heran und sagte: „Ich komme eben von Versailles; die Dauphine hat weder einen Prinzen noch eine Prinzessin geboren.“
Er sagte mir, ich schiene ihm ein Fremder zu sein, und als ich ihm geantwortet hatte, ich sei ein Italiener, begann er mit mir über den Hof, die Stadt, die Schauspiele zu sprechen und erbot sich schließlich, mich überall hin zu begleiten. Ich dankte ihm, stand auf und ging. Der Abbé begleitete mich und sagte mir die Namen aller Mädchen, die im Garten spazieren gingen.
Ein junger Mann begegnet ihm, sie umarmen sich, und der Abbé stellt ihn mir als einen gelehrten Kenner der italienischen Literatur vor. Ich sprach mit ihm italienisch; er antwortete mir geistvoll, aber ich mußte über seinen Stil lachen und sagte ihm den Grund. Er sprach nämlich genau in der Art des Boccaccio. Meine Bemerkung gefiel ihm; aber ich überzeugte ihn bald, daß man nicht so sprechen dürfte, obschon die Sprache dieses alten Schriftstellers vollkommen wäre. In weniger als einer Viertelstunde waren wir gute Freunde, weil wir bemerkten, daß wir dieselben Neigungen hatten. Er war Dichter, ich war es auch; er war neugierig auf die italienische Literatur, ich auf die französische. Wir tauschten unsere Adressen aus und versprachen uns gegenseitig, uns zu besuchen.
In einer Ecke des Gartens sah ich viele Leute, die unbeweglich dastanden und die Nase in die Luft streckten. Ich fragte meinem neuen Freund, was es denn da Wunderbares gäbe?
„Man paßt auf den Meridian auf; jeder hat seine Uhr in der Hand, um sie auf punkt 12 zu stellen.“
„Gibt es denn nicht überall einen Meridian?“
„Freilich; aber der vom Palais Royal ist der genaueste.“
Ich lachte laut auf.
„Warum lachen Sie?“
„Weil es unmöglich ist, daß nicht alle Meridiane gleich sind. Da haben Sie eine Pariser Gedankenlosigkeit nach allen Regeln.“
Er dachte einen Augenblick nach, lachte dann ebenfalls und lieferte mir reichlichen Stoff, an den guten Parisern Kritik zu üben.
Wir verließen das Palais Royal durch das Haupttor, und ich sah eine Menge Leute vor einem Laden sich drängen, der das Zeichen einer Zibetkatze trug.
„Was ist das?“
„Da werden Sie wieder einmal lachen. Alle diese guten Leute warten darauf, daß sie an die Reihe kommen, um sich ihre Tabaksdose füllen zu lassen.“
„Gibt es denn keinen anderen Tabakshändler?“
„Tabak wird überall verkauft; aber seit drei Wochen will man nur noch den Tabak von der Zibetkatze.“
„Ist er dort besser als anderswo?“
„Vielleicht nicht so gut! Aber seitdem die Herzogin von Chartres ihn in die Mode gebracht hat, will man keinen andern mehr.“
„Aber wie hat sie es gemacht, ihn in die Mode zu bringen?“
„Sie hat zwei- oder dreimal ihre Kutsche vor dem Laden halten lassen, um ihre Dose füllen zu lassen, und hat der jungen Person, die sie ihr wieder hinausbrachte, öffentlich gesagt, ihr Tabak sei der beste in ganz Paris. Die Müßiggänger, die sich stets am Wagenschlag eines Prinzen ansammeln, und wenn sie ihn auch hundertmal gesehen hätten, oder wenn er so häßlich wäre wie ein Affe, wiederholten in der Stadt die Worte der Herzogin, und mehr war nicht nötig, um alle Schnupfer der Hauptstadt auf die Beine zu bringen. Die Frau wird sich ein Vermögen erwerben, denn sie verkauft täglich für mehr als hundert Taler Tabak.“
„Die Herzogin hat natürlich keine Ahnung, welche Wohltat sie der Frau erzeigt hat.“
„Im Gegenteil, es ist eine Kriegslist von ihr. Die Herzogin interessiert sich für die junge Frau, die sich erst kürzlich verheiratet hat; sie wollte ihr auf eine zarte Art Gutes tun und ist auf dieses Mittel verfallen, das ja auch vollkommen eingeschlagen hat. Sie können nicht glauben, was für wackere und gute Leute die Pariser sind; Sie sind im einzigen Lande der Welt, wo es ganz einerlei ist, ob der Geist Wahres oder Falsches zu Markte bringt: er kann auf beide Arten sein Glück machen; denn im ersten Fall wird er von den geistreichen und verdienstvollen Leuten anerkannt, im zweiten ist stets die Dummheit da, bereit, ihn zu belohnen. Die Dummheit ist nämlich charakteristisch für Paris, und das Erstaunliche bei der Sache ist, daß diese Pariser Dummheit eine Tochter des Geistes ist. Es ist daher auch kein Paradox, wenn man sagt, daß der Franzose klüger sein würde, wenn er weniger Geist hätte.
Die Götter, die man hier anbetet, obgleich man ihnen keine Altäre errichtet, sind die Neuigkeit und die Mode. Ein Mensch braucht nur auf der Straße schnell zu laufen, und alles läuft hinter ihm her Die Menge bleibt erst stehen, wenn man entdeckt, daß der Mann verrückt ist; aber solche Entdeckungen können niemals ein Ende nehmen, denn wir haben hier eine Menge von Leuten, die von Geburt an verrückt sind, aber noch für vernünftig gelten.
Der Tabak der Zibetkatze ist nur ein schwaches Beispiel, wie der geringfügigste Umstand eine große Menschenmenge an einem Ort zusammenbringen kann. Eines Tages kam der König auf der Jagd nach Neuilly und bekam Lust auf ein Glas Ratafia. Er hält vor der Tür der Schenke an, und der allerglücklichste Zufall will es, daß der arme Schenkwirt wirklich eine Flasche hatte. Der König trank ein Gläschen und verlangte darauf ein zweites, indem er sagte, er habe in seinem ganzen Leben keinen so köstlichen Ratafia getrunken. Dies war mehr als genug, um den Ratafia des braven Wirtes von Neuilly in den Ruf zu bringen, er sei der beste in ganz Europa: Der König hatte es gesagt. Es kehrten denn auch ununterbrochen die glänzendsten Gesellschaften bei dem armen Schenkwirt ein; dieser ist heutzutage ein sehr reicher Mann und hat an derselben Stelle ein prachtvolles Haus bauen lassen. Es trägt eine ziemlich komische Inschrift, die wir einem der vierzig Unsterblichen verdanken: Ex liquidis solidum. Welches ist die Gottheit, die dieser Schenkwirt anbeten muß? Die Dummheit, die Leichtfertigkeit und die Lachlust.“
„Mir scheint“, versetzte ich ihm, „diese Art von Beifall, den man den Meinungen des Königs, der Prinzen von Geblüt usw. zollt, ist eher ein Beweis für die Liebe der Nation, die sie anbetet; denn die Franzosen halten ja geradezu diese Leute für unfehlbar.“
Ganz gewiß erweckt alles, was hier bei uns vorgeht, in den Fremden den Glauben, das Volk bete seinen König an; aber die Denkenden unter uns erkennen schließlich bald, daß es keine bare Münze ist; denn der Hof zählt dabei nicht mit.
Wenn der König nach Paris kommt, schreit alles: Es lebe der König!, weil eben ein Tagedieb damit den Anfang macht, oder weil irgend ein Polizist in der Menge das Zeichen dazu gegeben hat; aber diese Rufe haben keine Bedeutung, sie gehen aus lustiger Stimmung hervor, manchmal auch aus Furcht, und es fällt dem König gar nicht ein, sie für bare Münze zu nehmen. In Paris fühlt er sich gar nicht behaglich, und er befindet sich viel besser in Versailles inmitten von 25.000 Mann, die ihn vor der Wut desselben Volkes beschützen, das am Ende auch einmal vernünftig werden und ebensogut schreien könnte: Es sterbe der König! Ludwig der Vierzehnte wußte dies sehr wohl, und es hat einigen Räten der großen Kammer das Leben gekostet, daß sie davon zu sprechen wagten, die Generalstände einzuberufen, um für die Ubel, unter denen der Staat litt, Abhilfe zu schaffen. Frankreich hat niemals seine Könige geliebt, mit Ausnahme Ludwigs des Heiligen, Ludwigs des Zwölften und des guten und großen Heinrichs des Vierten; und bei diesem war die Liebe des Volkes ohnmächtig und nicht imstande, ihn vor dem Dolch der Jesuiten zu bewahren, dieser verfluchten Rasse, die ebensosehr die Feinde der Völker wie die der Könige sind. Der jetzige König, ein schwacher Mann, den seine Minister am Gängelbande führen, sagte einmal nach einer überstandenen Krankheit ganz aufrichtig: „Ich bin erstaunt über die lauten Freudenbezeigungen aus Anlaß meiner Genesung, denn ich kann mir nicht vorstellen, warum man mich so liebt“. – Viele Könige könnten dasselbe sagen, zum wenigsten, wenn das Maß der Liebe sich nach dem Maße des von ihnen geleisteten Guten richten würde. Man hat den naiven Ausspruch des Herrschers in den Himmel erhoben, aber ein philosophischer Hofmann hätte ihm sagen müssen, man liebe ihn so sehr, weil er den Beinamen des Vielgeliebten trage.
„Den Beinamen oder Spitznamen? Findet man übrigens bei Ihnen philosophische Hofleute?“
„Philosophen nein; denn das sind zwei Dinge, die einander ausschließen, wie Licht und Schatten; aber es gibt bei uns geistreiche Leute, die aus Ehrgeiz und Eigennutz in die Zügel beißen.“
Unter solchen Gesprächen führte Herr Patu – so hieß mein neuer Bekannter – mich bis an die Tür von Sylvias Haus, zu deren Bekanntschaft er mir Glück wünschte; hier trennten wir uns. Ich fand die liebenswürdige Schauspielerin in schöner Gesellschaft. Sie stellte mich allen Anwesenden vor und nannte mir die Namen jedes einzelnen. Der Name Crébillon erfüllte mich mit Freude.
„Wie, mein Herr“, rief ich, „so schnell glücklich? Seit acht Jahren bezaubern Sie mich; seit acht Jahren wünschte ich Sie kennen zu lernen. Bitte hören Sie!“
Und nun deklamierte ich ihm die schönste Stelle aus Cenobia und Rhadamiste, die ich in Blankverse übersetzt hatte.
Sylvia freute sich über das Vergnügen, das Crébillon empfand, als er mit achtzig Jahren sich in einer Sprache hörte, die er kannte und wie seine eigene liebte. Er deklamierte die gleiche Szene auf französisch und hob höflich die Stellen hervor, bei denen ich nach Seiner Meinung ihn verschönert hatte. Ich dankte ihm, ohne mich jedoch von dem Kompliment fangen zu lassen.
Wir setzten uns zu Tisch, und da man mich fragte, was ich denn in Paris Schönes gesehen hätte, erzählte ich alles, ausgenommen meine Unterhaltung mit Patu. Nachdem ich sehr lange gesprochen hatte, sagte Crébillon, der besser als alle anderen den von mir eingeschlagenen Weg, um die guten und schlechten Seiten seiner Nation kennen zu lernen, erkannt hatte, folgendes zu mir:
„Für einen ersten Tag, mein Herr, finde ich Ihre Beobachtungen vielversprechend, und ohne Zweifel werden Sie sehr schnelle Fortschritte machen. Sie erzählen gut, und Sie sprechen französisch auf eine Art, daß Sie sich vollkommen verständlich machen; aber alles, was Sie sagen, ist nur verkleidetes Italienisch. Man hört Ihnen mit Interesse zu, und durch die Neuheit Ihrer Sprechweise fesseln Sie doppelt die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer. Ich muß Ihnen sogar sagen, daß diese Sprechweise danach angetan ist, den Beifall der Hörer zu gewinnen; denn sie ist eigenartig und neu, und Sie befinden sich in dem Lande, wo man dem Eigenartigen und Neuen nachläuft. Aber Sie müssen sich schon von morgen ab die größte Mühe geben, unsere Sprache gut sprechen zu lernen; denn in zwei oder drei Monaten werden dieselben Leute, die Ihnen heute Beifall klatschen, anfangen, sich über Sie lustig zu machen.“
„Ich glaube es, mein Herr, und fürchte es; der Hauptzweck meiner Reise nach Paris ist ja auch, mich mit aller Kraft auf das Studium der französischen Sprache zu verlegen; aber mein Herr, wie soll ich es anfangen, einen Lehrer zu finden? Ich bin ein unerträglicher Schüler: fragelustig, neugierig, hartnäckig, unersättlich. Und angenommen, ich könnte wirklich den richtigen Lehrer finden, so bin ich nicht reich genug, um ihn bezahlen zu können.“
„Seit sechzig Jahren, mein Herr, suche ich einen solchen Schüler, wie Sie sich soeben selbst geschildert haben; und ich werde Sie sogar bezahlen, wenn Sie zu mir kommen und Unterricht bei mir nehmen wollen. Ich wohne im Marais in der Rue des douze portes; ich besitze die besten italienischen Dichter. Ich werde Sie diese ins Französische übersetzen lassen und werde Sie niemals unersättlich finden.“
Voller Freuden nahm ich an. Ich war in großer Verlegenheit, wie ich ihm meine Dankbarkeit ausdrücken sollte; aber das Anerbieten trug den Stempel der Aufrichtigkeit, ebenso wie die wenigen Worte, mit denen ich darauf antwortete.
Crébillon war ein Riese; er war sechs Fuß hoch; um drei Zoll größer als ich. Er aß gut und erzählte in scherzhafter Weise und ohne dabei zu lachen. Er war berühmt wegen seiner witzigen Aussprüche und war ein ausgezeichneter Gesellschafter; aber er verbrachte sein Leben in seinem Hause, ging selten aus und empfing fast niemals Besuch, weil er immer die Pfeife im Munde hatte und von etwa zwanzig Katzen umgeben war, mit denen er den größten Teil des Tages spielte. Er hatte eine alte Haushälterin, eine Köchin und einen Bedienten. Seine Haushälterin dachte an alles, ließ es ihm an nichts fehlen und legte ihm niemals Rechnung über sein Geld ab; dieses hatte sie ganz allein in Händen, weil er niemals etwas von ihr verlangte. In seinen Gesichtszügen ähnelte Crébillon einem Löwen oder einem Kater, was dasselbe ist. Er war königlicher Zensor, und diese Stelle machte ihm Spaß, wie er mir sagte. Seine Haushälterin las ihm die Werke vor, die bei ihm eingereicht wurden, und sie unterbrach die Vorlesung, wenn sie glaubte, daß etwas seine Zensur verdiente. Zuweilen waren sie aber auch verschiedener Meinung, dann wurde ihr Streit wirklich komisch. Eines Tages hörte ich, wie die Haushälterin jemand mit den Worten wegschickte: „Kommen Sie nächste Woche wieder; wir haben noch keine Zeit gehabt, Ihr Manuskript zu prüfen.“
Ein ganzes Jahr lang ging ich dreimal wöchentlich zu Herrn Crébillon, und ich lernte von ihm alles Französisch, das ich weiß; aber es ist mir stets unmöglich gewesen, mich von meinen italienischen Wendungen frei zu machen. Ich bemerke sie sehr gut, wenn ich ihnen bei anderen begegne; aber sie fließen mir beim Schreiben aus der Feder, und es will mir nicht gelingen, sie zu fühlen. Ich bin überzeugt, daß ich es niemals dahin bringen werde, sie zu erkennen, ebensowenig, wie ich jemals habe herausfinden können, worin die fehlerhafte Latinität bestehe, die man dem Titus Livius zum Vorwurf macht.
Ich machte aus irgend einem Anlaß einen Achtzeiler in freien Versen und zeigte ihn Herrn Crébillon, um ihn mir von diesem verbessern zu lassen. Er las die Verse aufmerksam und sagte mir: „Die acht Verse sind gut und sehr richtig, der Gedanke ist schön und sehr poetisch, die Sprache ist vollkommen; und trotzdem ist der Achtzeiler schlecht.“
„Wieso denn?“
„Das weiß ich nicht. Es fehlt ein gewisses Etwas. Stellen Sie sich vor, Sie sehen einen Mann, Sie finden ihn schön, wohlgewachsen, liebenswürdig, geistreich, mit einem Wort vollkommen, obgleich Sie den strengsten Maßstab anlegen. Eine Frau kommt dazu, sieht ihn, betrachtet ihn und geht, indem sie Ihnen sagt, der Mann gefalle ihr nicht. ›Aber welchen Fehler finden Sie denn?‹ – ›Keinen. Aber er mißfällt mir.‹ Sie wenden sich wieder zu jenem Mann, prüfen ihn noch einmal und finden, daß man, um ihm eine Engelsstimme zu geben, ihm das genommen hat, was den Mann ausmacht; und so müßten Sie einräumen, daß ihr unbewußtes Gefühl der Frau das Richtige eingegeben hatte.“
Durch dieses Gleichnis erklärte Crébillon mir eine fast unerklärliche Sache; denn wirklich, nur der Geschmack und das Gefühl können eine Erscheinung erklären, die aller Regeln spottet.
Wir sprachen bei Tisch viel von Ludwig dem Vierzehnten, um dessen Huld Crébillon fünfzehn Jahre sich beworben hatte, und er erzählte uns ganz eigentümliche Anekdoten, die kein Mensch kannte. Unter anderem versicherte er uns, die siamesischen Gesandten seien Betrüger gewesen, die von der Madame de Maintenon bezahlt gewesen wären. Er sagte uns, er hätte seine Tragödie Cromwell nicht vollendet, weil der König ihm eines Tages gesagt habe, er solle seine Feder nicht dazu mißbrauchen, einen Schelm zu verherrlichen.
Crébillon sprach mit uns auch über seinen Catilina, er sagte, er halte das Drama für das schwächste unter allen seinen Stücken; aber das Stück hätte nur gut werden können, wenn er Caesar als jungen Mann auf die Bühne gebracht hätte, und das hätte er nicht gewollt; denn dadurch würde Caesar lächerlich gewirkt haben, gerade wie Medea lächerlich wirken müßte, wenn man sie als junges Mädchen vor ihrer Bekanntschaft mit Jason auftreten ließe. Dem Talent Voltaires zollte er großes Lob, aber er beschuldigte ihn des Diebstahls; denn er hätte ihm die Senatsszene gestohlen. Doch sei er ein geborener Historiker und ganz der Mann dazu, Weltgeschichte sowohl wie Tragödien zu schreiben; leider verfälschte er die Geschichte, indem er sie mit kleinen Geschichtchen, Märchen und Anekdötchen anfülle, bloß um die Lektüre interessant zu machen. Nach Crébillon war der Mann mit der eisernen Maske ein Märchen, er sagte, Ludwig der Vierzehnte habe ihm dies mit eigenem Munde versichert.
Am Abend dieses Tages gab man im italienischen Theater das Drama Cenie von Frau von Grafigny. Ich ging zeitig hin, um einen guten Platz im Amphitheater zu bekommen.
Mich interessierten die Damen, die ganz mit Diamanten bedeckt in den vordersten Logen Platz nahmen, und ich beobachtete sie aufmerksam. Ich trug einen schönen Anzug, aber an meinen offenen Manschetten und meinen ganz bis unten herabgehenden Knöpfen erkannte ein jeder mich als Fremden, denn diese Mode gab es in Paris nicht. Während ich so dastand und auf meine Art Maulaffen feil hielt, trat ein reich gekleideter Herr, der dreimal so dick war wie ich, an mich heran und fragte mich höflich, ob ich fremd sei. Ich bejahte, und er fragte weiter, wie ich Paris fände. Während ich das Loblied von Paris fang, betrat eine mit Edelsteinen bedeckte, riesige Dame die Loge nebenan. Ihr ungeheuerer Umfang verblüffte mich, und ich sagte dummerweise zu dem Herrn:
„Was ist denn das für ein dickes Schwein?“
„Die Frau dieses dicken Schweins.“
„Oh, mein Herr, ich bitte Sie eine Million mal um Entschuldigung!“
Aber mein dicker Herr brauchte meine Entschuldigung nicht; weit entfernt, böse zu sein, wollte er vor Lachen platzen. Edle und glückliche Wirkung der praktischen und natürlichen Philosophie, von der die Franzosen unter dem Anschein der Leichtfertigkeit zum Glück des Lebens einen so edlen Gebrauch machen!
Ich war in Verzweiflung, und der dicke Herr hielt sich den Bauch vor Lachen. Endlich steht er auf und verläßt das Amphitheater; einen Augenblick darauf sehe ich ihn in die Loge treten und mit seiner Frau sprechen. Ich wagte nicht, ihnen ins Gesicht zu sehen und beobachtete sie aus den Augenwinkeln. Plötzlich sah ich die Dame in die Heiterkeit ihres Gemahls einstimmen und herzlich lachen. Ihre Heiterkeit vermehrte noch meine Verlegenheit, und ich beschloß, fortzugehen. Plötzlich aber hörte ich mich rufen: „Mein Herr! Mein Herr!“
Ich konnte nicht hinausgehen, ohne unhöflich zu sein, und trat an ihre Loge heran. Nun bat er mich mit ernster Miene und im edelsten Ton um Verzeihung, daß er so übermäßig gelacht habe. In der liebenswürdigsten Weise lud er mich ein, ich möchte ihm die Ehre erweisen, an demselben Abend noch bei ihm zu esen.
Ich dankte ihm höflich und entschuldigte mich, indem ich ihnen sagte, ich sei schon eingeladen. Er wiederholte seine dringenden Aufforderungen, und auch seine Frau lud mich in der zuvorkommendsten Weise ein. Um sie zu überzeugen, daß ich mich nicht unter einem leeren Vorwand ihrer Einladung zu entziehen suchte, sagte ich ihnen endlich, ich würde bei Sylvia erwartet.
„Ich bin überzeugt, Sie frei machen zu können, wenn es Ihnen nicht unangenehm ist. Ich werde persönlich zu ihr gehen.“
Es wäre unhöflich von mir gewesen, nicht nachzugeben. Er stand auf, ging hinaus und kam wenige Augenblicke darauf mit meinem Freunde Baletti wieder, der mir sagte, meine Mutter wäre entzückt, daß ich so schöne Bekanntschaften machte, und sie erwartete mich am nächsten Tage zum Mittagessen. Dann nahm mein Freund mich auf die Seite und sagte mir, der Herr sei der Generalsteuereinnehmer, Herr de Beauchamp.
Als der Vorhang gefallen war, reichte ich der gnädigen Frau meinen Arm, wir stiegen alle drei in eine prachtvolle Equipage und fuhren nach ihrem Palais. Es herrschte dort der Überfluß, oder vielmehr die Verschwendung, die man in Paris bei allen Leuten dieser Klasse findet: große Gesellschaft, hohes Kartenspiel, prachtvolles Essen und ungezwungene Heiterkeit bei Tisch. Das Souper dauerte bis ein Uhr nachts; die Kutsche der gnädigen Frau brachte mich nach Hause. Dieses Haus stand mir während der ganzen Zeit meines Pariser Aufenthaltes offen, und ich darf nicht versäumen zu sagen, daß es mir von großem Nutzen war. Wenn man sagt, ein Fremder langweile sich in Paris während der ersten vierzehn Tage, so hat man recht; denn man braucht Zeit, um eingeführt zu werden; ich jedoch hatte das Glück, schon in den ersten vierundzwanzig Stunden nach Wunsch untergebracht zu sein, und konnte daher gewiß sein, daß ich mich behaglich fühlen würde.
Am nächsten Morgen besuchte Patu mich und schenkte mir seine Prosalobrede auf den verstorbenen Marschall von Sachsen. Wir gingen miteinander aus und machten einen Spaziergang im Garten der Tuilerien, wo er mich der Madame Boccage vorstellte, die eine gute Bemerkung über den Marschall von Sachsen machte:
„Es ist eigentümlich, daß wir nicht ein De profundis für diesen Mann sagen können, der der Anlaß war, daß wir so oft Te Deum gesungen haben.“
Von den Tuilerien führte Patu mich zu einer berühmten Opernsängerin, Fräulein Le Fel, dem Liebling von ganz Paris und Mitglied der königlichen Akademie der Musik. Sie hatte drei reizende Kinder im zartesten Alter, die im Hause herumhüpften.
„Ich bete sie an!“ sagte sie zu mir.
„Sie verdienen es wegen ihrer Schönheit“, antwortete ich ihr, „obgleich jedes Kind einen verschiedenen Ausdruck hat.“
„Das will ich wohl glauben! Der älteste ist der Sohn des Herzogs von Annecy, der zweite ist der Sohn des Grafen Egmont, und der jüngste stammt von Maison-Rouge, der kürzlich die Romainville geheiratet hat.“
„Ach, entschuldigen Sie bitte; ich glaubte, Sie seien die Mutter von allen dreien.“
„Sie haben sich durchaus nicht getäuscht; ich bin es.“
Bei diesen Worten sah sie Patu an und brach mit ihm in ein Gelächter aus, das mich zwar nicht zum Erröten brachte, aber mich über meinen Schnitzer aufklärte. Ich war Neuling und noch nicht gewöhnt Frauen sich gewisse Vorrechte der Männer anmaßen zu sehen. Fräulein Le Fel war jedoch nicht schamlos; sie gehörte sogar zur guten Gesellschaft; aber sie war, wie man so sagt, über Vorurteile erhaben. Hätte ich die Sitten der Zeit besser gekannt, so würde ich gewußt haben, daß derartige Dinge ganz in der Ordnung waren, und daß die großen Herren, die auf solche Weise ihre edle Nachkommenschaft ausstreuten, ihre Kinder in den Händen der Mutter ließen, denen sie dafür beträchtliche Erziehungsgelder auszahlten. Diese Damen lebten daher um so behaglicher, je mehr eigene Kinder sie ansammelten.
Infolge meiner Unbekanntheit mit den Pariser Sitten machte ich zuweilen böse Mißgriffe, und Fräulein Le Fel würde ohne Zweifel nach der täppischen Antwort, die ich mir hatte zuschulden kommen lassen, jedem ins Gesicht gelacht haben, der ihr gesagt hätte, ich besäße Geist.
An einem anderen Tage war ich beim Ballettmeister der Oper, Lani. Ich sah dort fünf oder sechs junge Personen von dreizehn oder vierzehn Jahren, die alle von ihren Müttern begleitet wurden und alle das bescheidene Aussehen hatten, das von einer guten Erziehung spricht. Ich sagte ihnen Schmeicheleien, und sie antworteten mir mit niedergeschlagenen Augen. Als eine von ihnen über Kopfweh klagte, bot ich ihr mein Riechfläschchen an, und eine von ihren Kameradinnen sagte zu ihr: „Du hast gewiß nicht gut geschlafen.“ – „Oh! Das ist es nicht“, antwortete meine Agnes; „aber ich glaube, ich bin schwanger.“ Auf diese unerwartete Antwort von Seiten einer jungen Person, die ich nach ihrem Alter und nach ihrem Aussehen für eine Jungfrau gehalten hatte, bemerkte ich: „Ich glaubte nicht, daß Madame verheiratet wären.“
Sie sah mich einen Augenblick überrascht an, wandte sich dann zu ihrer Freundin, und beide lachten aus vollem Halse. Beschämt, aber mehr ihret- als meinerwegen, ging ich fort, fest entschlossen, nicht mehr freiwillig an Tugend bei einer Klasse von Weibern zu glauben, wo sie so selten ist. Bei Kulissennymphen Schamhaftigkeit zu suchen oder auch nur zu vermuten, dazu muß man doch gar zu einfältig sein; sie suchen eine Ehre darin, gar keine Scham zu haben, und machen sich über jeden lustig, der ihnen noch welche zutraut.
Patu machte mich mit allen Mädchen bekannt, die in Paris in einigem Rufe standen. Er liebte das schöne Geschlecht, aber zum Unglück für ihn hatte er kein Temperament wie ich, und die Liebe zum Vergnügen kostete ihm in jungen Jahren das Leben. Wäre er am Leben geblieben, so hätte er Voltaire nicht viel nachgegeben; aber mit dreißig Jahren bezahlte er der Natur den verhängnisvollen Tribut, dem niemand entrinnt. Ich erfuhr von dem Gelehrten ein Geheimnis, das mehrere französische junge Literaten anwenden, um einer ganz vollkommenen Prosa sicher zu sein, wenn sie etwas schreiben wollen, was eine möglichst schöne Prosa erfordert, wie zum Beispiel Nachrufe, Leichenpredigten, Widmungsvorreden und dergleichen. Ich entriß ihm dieses Geheimnis gewissermaßen durch Überraschung.
Als ich eines Morgens bei ihm war, sah ich auf seinem Tisch mehrere lose Blätter, die mit zweisilbigen Blankversen beschrieben waren, ich las etwa ein Dutzend davon und sagte ihm dann, die Verse seien zwar schön, aber sie zu lesen bereite mir mehr Mühe als Genuß.
„Es sind die gleichen Gedanken, wie in dem Nachruf auf den Marschall von Sachsen, aber ich gestehe dir, daß die Prosa mir viel mehr Vergnügen macht.“
„Meine Prosa hätte dir nicht so gut gefallen, wenn sie nicht vorher in Blankversen geschrieben gewesen wäre.“
„Du hast dir da eine große Mühe rein vergebens gemacht.“
„Von Mühe ist nicht die Rede, denn Blankverse machen mir keine. Man schreibt sie wie Prosa.“
„Du glaubst also, die Prosa wäre schöner, wenn du sie deinen eigenen Versen entnimmst?“
„Daran ist nicht zu zweifeln; sie wird schöner und ich sichere mir den Vorteil, daß alsdann meine Prosa nicht von jenen Halbversen wimmelt, die dem Schriftsteller aus der Feder fließen, ohne daß er’s merkt.“
„Ist dies ein Fehler?“
„Ein sehr großer, ein unverzeihlicher; eine Prosa, die mit unbeabsichtigten Versen gespickt ist, ist schlechter als eine prosaische Poesie.“
„Allerdings müssen Verse, die sich als Parasiten in eine Trauerrede eingeschlichen haben, sich übel ausnehmen.“
„Ganz gewiß. Nimm zum Beispiel Tacitus; dessen Geschichtswerk beginnt mit dem Satz: Urbem Romam a principio reges habuere. Dies ist ein sehr schlechter lateinischer Hexameter, den der große Historiker ganz gewiß nicht absichtlich gemacht hat und den er bei der Durchsicht seines Werkes nicht entdeckt hat; denn ohne allen Zweifel hätte er dann dem Satz eine andere Wendung gegeben. Ist nicht auch die italienische Prosa schlecht, wenn man unbeabsichtigte Verse darin findet?“
„Sehr schlecht. Aber ich muß dir sagen, daß viele armselige Geister absichtlich Verse anbringen, weil sie sie dadurch wohlklingender zu machen gedenken. Es ist im allgemeinen gerade dieser Klingklang, den ihr uns zum Vorwurf macht. Übrigens bist du, glaube ich, der einzige, der sich diese Mühe macht.“
„Der einzige? Nein gewiß nicht. Alle Schriftsteller, denen wie mir Blankverse keine Mühe machen, wenden dieses Mittel an. Frage Crébillon, den Abbé de Voisenon, La Harpe, frage wen du willst, und man wird dir dasselbe sagen wie ich. Voltaire ist der erste, der in den kleinen Stücken, worin seine Prosa zauberhaft ist, dieses Mittel angewandt hat. Dazu gehört zum Beispiel die Epistel an Madame du Châtelet: sie ist prachtvoll. Lies sie, und wenn du einen einzigen Halbvers darin findest, so magst du sagen, ich habe unrecht.“
Dieses Gespräch machte mich neugierig, und ich fragte Crébillon danach; er sagte mir dasselbe, aber er versicherte mir, daß er selber es nie getan habe.
Patu konnte es kaum erwarten, mich in die Oper zu führen, um zu sehen, welchen Eindruck dieses Schauspiel auf meinen Geist machen würde. Ein Italiener muß es allerdings außerordentlich finden. Man gab eine Oper, Venetianische Feste, deren Titel mich interessierte. Wir gingen für unsere vierzig Sous ins Parterre, wo man, obgleich man stehen mußte, gute Gesellschaft traf, denn dieses Schauspiel war das Lieblingsvergnügen der Franzosen.
Nachdem ein ausgezeichnetes Orchester eine in ihrer Art sehr schöne Ouvertüre gespielt hatte, ging der Vorhang auf, und ich sah eine schöne Dekoration, die den Markusplatz von der kleinen Insel San Giorgio darstellte; aber ich sah zu meinem Verdruß den Dogenpalast zu meiner Linken und den großen Glockenturm zu meiner Rechten: also genau umgekehrt wie in Wirklichkeit. Über diesen komischen Fehler, der in unserem Jahrhundert nicht vorkommen sollte, mußte ich lachen, und Patu, dem ich den Grund sagte, lachte ebenfalls darüber. Die Musik war zwar schön nach dem alten Geschmack, aber sie unterhielt mich nur im Anfang ein bißchen, weil sie mir neu war, später langweilte sie mich. Die Gesangssprache ermüdete mich bald durch ihre Eintönigkeit und durch die am unrechten Ort hervorgestoßenen lauten Schreie. Diese Gesangssprache der Franzosen ersetzt nach ihrer Behauptung die griechische Gesangssprache und unser Rezitativ, das sie abscheulich finden, das sie aber lieben würden, wenn sie unsere Sprache verständen.
Die Handlung stellte einen Karnevalstag dar, an welchem die Venetianer maskiert auf dem Markusplatz spazieren gehen. Auf der Bühne traten Liebhaber, Kupplerinnen und Mädchen auf, welche Intriguen anknüpften und wieder lösten. Die Kostüme waren sonderbar und falsch; aber das ganze war unterhaltend. Besonders über eins mußte ich herzlich lachen, und es war auch für einen Venetianer sehr lächerlich: ich sah nämlich aus den Kulissen den Dogen und die zwölf Mitglieder des Rates, alle in sonderbaren Talaren herauskommen und einen großen Rundtanz aufführen. Plötzlich hörte ich das Parterre heftig Beifall klatschen; es erschien ein großer und schöner Tänzer in Maske und mit einer ungeheueren schwarzen Perücke, die ihm über den halben Oberleib herabfiel; bekleidet war er mit einem vorne offenen Talar, der bis an die Absätze reichte. Patu sagte mir mit einer Art von Verehrung: „Das ist der unnachahmliche Duprès.“ Ich hatte von ihm sprechen hören und paßte genau auf. Ich sah die schöne Gestalt mit abgemessenen Schritten sich vorwärts bewegen; vorne auf der Bühne angekommen, erhob der Tänzer langsam seine gerundeten Arme, bewegte sie voller Anmut, streckte sie aus, verschränke sie, machte leichte und genaue Fußbewegungen, kleine Schritte, einen Kreuzsprung, eine Pirouette und verschwand hierauf wie ein Zephyr. Das Ganze hatte keine halbe Minute gedauert. Beifallsklatschen, Bravorufen von allen Ecken und Enden des Saales! Ich war darüber erstaunt und fragte meinen Freund nach dem Grunde.
„Der Beifall gilt der Anmut unseres Dupès und der göttlichen Harmonie seiner Bewegungen. Er ist sechzig Jahre alt, und wer ihn vor vierzig Jahren gesehen hat, der findet, er sei immer noch der gleiche.“
„Wie? Er hat niemals anders getanzt?“
„Er kann nicht besser getanzt haben; denn die Entwicklung, die du gesehen hast, ist vollkommen, und was kennst du, das über das Vollkommene hinausginge?“
„Nichts, das heißt, vorausgesetzt, daß die Vollkommenheit nicht nur eine relative ist.“
„Hier ist sie absolut. Duprès macht immer dasselbe, und jeden Tag glauben wir es zum erstenmal zu sehen. Das ist die Macht des Schönen und des Guten, des Erhabenen und des Wahren. Dieser Tanz ist eine Harmonie; er ist der echte Tanz, von dem ihr in Italien keinen Begriff habt.“
Beim Ende des zweiten Aktes erschien von neuem Duprès, das Gesicht von einer Maske verdeckt. Er tanzte nach einer anderen Melodie, machte aber in meinen Augen genau das gleiche. Er trat bis dicht an die Rampe vor und stand einen Augenblick in einer vollendet schön gezeichneten Stellung da. Patu verlangte von mir, ich solle ihn bewundern; ich gab es ihm zu; plötzich hörte ich im Parterre hundert Stimmen rufen: „Ah, mein Gott, mein Gott, er entwickelt sich, er entwickelt sich!“ Er schien allerdings ein elastischer Körper zu sein, der sich entwickelte und dadurch größer erschien. Ich machte Patu glücklich, indem ich ihm sagte, Duprès besitze wirklich in allem eine vollendete Anmut. Unmittelbar darauf sah ich eme Tänzerin, die wie eine Furie über die Bühne raste und Kreuzsprünge nach rechts und nach links und nach allen Richtungen machte, jedoch nur von geringer Höhe. Trotzdem wurde sie mit einer Art von Wut beklatscht.
„Dies ist“, sagte Patu zu mir, „die berühmte Camargo. Ich wünsche dir Glück, mein Freund, daß du noch rechtzeitig nach Paris gekommen bist, um sie zu sehen, denn sie hat ihr zwölftes Lustrum hinter sich!“
Ich gab zu, daß ihr Tanz wunderbar sei.
„Sie ist“, fuhr mein Freund fort, „die erste Tänzerin, die auf unserem Theater gewagt hat, Sprünge zu machen; denn vor ihr taten die Tänzerinnen das nicht. Bewunderungswürdig aber ist, daß sie keine Unterhosen trägt.“
„Verzeihung, ich sah…“
„Was hast du gesehen? Das war ihre Haut, die allerdings nicht von Lilien und Rosen ist.“
„Die Camargo“, sagte ich zu ihm mit zerknirschter Miene, „gefällt mir nicht. Duprès ist mir lieber.“ Ein alter Bewunderer, der links neben mir stand, sagte mir, in ihrer Jugend habe sie den Baskensprung und sogar Gargouillade gemacht, und man habe niemals ihre Schenkel gesehen, obgleich sie mit bloßen Beinen tanzte. „Aber wenn Sie niemals ihre Schenkel gesehen haben, wie können Sie dann wissen, daß sie keine Trikots trug?“
„Oh! Das sind Dinge, die man wohl wissen kann; ich sehe, der Herr ist hier fremd.“
„Oh! In dieser Beziehung sehr fremd.“
Was mir sehr an der französischen Oper gefiel, das war die Schnelligkeit, womit auf einmal alle Dekorationen auf einen Pfiff hin gewechselt wurden. Hiervon hat man in Italien gar keinen Begriff. Entzückend fand ich auch den Beginn des Orchesters mit einem Bogenstrich; aber der Dirigent mit seinem Taktstock, der mit rasenden Bewegungen nach rechts und links schlug, wie wenn bloß durch die Kraft seines Armes alle Instrumente ganz von selber gehen müßten – der war mir geradezu ekelhaft. Ich bewunderte auch die Stille der Zuschauer, was für einen Italiener ganz selten war; denn mit vollem Recht ärgert man sich in Italien über den Lärm, der dort gemacht wird, während die Künstler singen; und man kann gar nicht genug hervorheben, wie lächerlich dann das Schweigen ist, das auf diesen Lärm folgt, sobald die Tänzer auftreten; man möchte sagen, daß die Italiener ihre ganze Intelligenz in den Augen haben. Übrigens gibt es in der ganzen Welt kein Land, wo der Beobachter nichts Sonderbares und Unvernünftiges finden könnte, und zwar einfach deshalb, weil er vergleichen kann; die Einheimischen können diese Fehler nicht bemerken. Alles in allem genommen, machte die Oper mir Spaß; mein ganzes Herz aber gewann die französische Komödie. Hier sind die Franzosen wirklich in ihrem Element; sie spielen meisterhaft, und die anderen Völker dürfen ihnen nicht die Palme streitig machen, welche Geist und guter Geschmack ihnen zusprechen müssen.
Ich ging alle Tage in die Komödie, und obgleich manchmal nicht zweihundert Zuschauer anwesend waren, gab man doch die klassischen Stücke, und in ausgezeichneter Darstellung. So sah ich den Menschenfeind, den Geizhals, den Tartüff, den Spieler, den Prahler und viele andere; und obgleich ich sie oft sah, glaubte ich sie stets zum erstenmal zu sehen. Ich kam gerade noch rechtzeitig nach Paris, um Sarasin, die Dangeville, die Dumesnil, die Gaussin, die Clairon, Preville, zu sehen; auch lernte ich mehrere Schauspieler kennen, die sich vom Theater zurückgezogen hatten und von ihren Ruhegeldern lebten, aber immer noch die Gesellschaft bezauberten, die die bei sich empfingen. Unter anderen lernte ich die berühmte Le Vasseur kennen; ich besuchte diese Damen mit Vergnügen, und sie erzählten mir außerordentlich merkwürdige Anekdoten. Sie waren im allgemeinen sehr dienstbereit und zwar in jeder Beziehung. Eines Tages saß ich in einer Loge mit der Vasseur, man gab eine Tragödie, worin ein hübsches Mädchen die stumme Rolle einer Priesterin spielte.
„Wie hübsch sie ist!“ sagte ich zu ihr.
„Ja, reizend. Sie ist die Tochter des Künstlers, der den Vertrauten spielt. Sie ist sehr liebenswürdig in Gesellschaft und verspricht sehr viel.“
„Ich würde gern ihre Bekanntschaft machen.“
„O mein Gott, das ist nicht schwierig. Ihr Vater und ihre Mutter sind sehr ehrenwerte Leute, und ich bin überzeugt, sie werden entzückt sein, wenn Sie sich bei ihnen zum Abendessen einladen. Sie werden Ihnen nicht lästig fallen, sie werden zu Bett gehen und Sie frei mit ihrer Tochter bei Tisch plaudern lassen, solange Sie Lust haben. Sie sind in Frankreich, mein Herr, und hier kennt man den Wert des Lebens und sucht es zu genießen. Wir lieben den Genuß und schätzen uns glücklich, wenn wir den Genuß verschaffen können.“
„Diese Denkweise ist reizend, gnädige Frau; aber wie könnte ich wohl die Stirn haben, mich zum Essen einzuladen bei Leuten, die ich gar nicht kenne und die mich ebensowenig kennen?“
„O du lieber Gott, was sagen Sie da? Wir kennen alle Welt! Sie sehen doch, wie ich Sie behandle. Nach der Aufführung werde ich Sie vorstellen, und die Bekanntschaft wird gemacht sein.“
„Ich werde Sie bitten, mir diese Ehre ein anderes Mal zu erweisen.“
„Wann Sie wollen.“