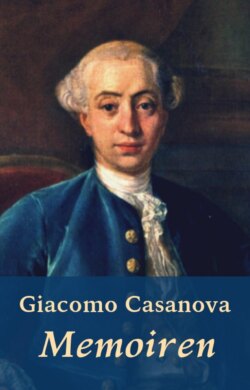Читать книгу Giacomo Casanova - Memoiren - Giacomo Casanova - Страница 40
Dreizehntes Kapitel
ОглавлениеIch gebe das von Wien mitgenommene Porträt heraus. – Ich gehe nach Padua; Abenteuer auf der Rückreise; Folgen dieses Abenteuers. – Ich finde Teresa Imer wieder. – Ich mache die Bekannschaft von Fräulein C.C.
Ich sah meine Vaterstadt mit jenem köstlichen Gefühl wieder, das alle wackeren Herzen empfinden, wenn sie die Stellen wieder begrüßen, wo sie die ersten dauernden Eindrücke empfangen haben. Ich hatte Erfahrungen gesammelt; ich kannte die Gebote der Ehre und der Höflichkeit; ich fühlte mich fast allen meinesgleichen überlegen und sehnte mich danach, meine alten Gewohnheiten wieder aufzunehmen; aber ich nahm mir vor, dabei in Zukunft mich mehr geregelt und zurückhaltend zu benehmen.
Mit Vergnügen sah ich beim Bieten meines Arbeitszimmers, daß dort der Status quo in höchster Vollkommenheit aufrecht erhalten worden war. Eine fingerdicke Staubschicht, die auf meinen Papieren lag, bezeugte zur Genüge, daß keine unbefugte Hand diese berührt hatte.
Am zweiten Tage nach meiner Ankunft überbrachte mir ein Barkarole einen Brief, gerade in dem Augenblick, als ich im Begriff war, auszugehen, um den Bucentoro zu begleiten, auf dem der Doge die gewohnte alljährliche Fahrt machen wollte, um sich der Adria zu vermählen, der Witwe so vieler Gatten, die trotzdem noch so frisch ist wie am Tage der Schöpfung. Der Brief war von einem jungen Nobile, Giovanni Grimani, dem es sehr wohl bewußt war, daß er kein Recht hatte, mich vor sich zu zitieren, und der mich daher sehr höflich bat, ich möchte doch freundlichst bei ihm vorsprechen, um einen Brief in Empfang zu nehmen, den er mir zu eigenen Händen zu übergeben beauftragt sei. Ich ging augenblicklich zu ihm, und nachdem wir die üblichen Komplimente ausgetauscht hatten, übergab er mir einen unversiegelten Brief, den er Tags zuvor erhalten hatte.
Dieser Brief lautete:
„Mein Herr, ich habe nach Ihrer Abreise vergeblich mein Porträt gesucht, und da ich nicht die Gewohnheit habe, Diebe bei mir zu empfangen, so bin ich überzeugt, daß es sich nur in Ihren Händen hefinden kann; ich bitte Sie, es der Person zu übergeben, von der Sie diesen Brief erhalten werden.
Fogliazzi.“
Zu meiner großen Freude hatte ich das Bild bei mir; ich zog es aus der Tasche und lieferte es sofort Herrn Grimani aus, der es mit großer Befriedigung, aber auch mit Überraschung in Empfang nahm; denn er hatte geglaubt, sein Auftrag werde schwieriger auszuführen sein.
„Offenbar hat die Liebe Sie dazu getrieben, diesen kleinen Raub zu begehen“, sagte er zu mir. „Nun, ich wünsche Ihnen Glück, daß sie offenbar nicht sehr stark ist.“
„Woraus schließen Sie das?“
„Aus der Bereitwilligkeit, womit Sie das Bild herausgeben.“
„Nicht jedem würde ich es so willig ausliefern.“
„Dafür danke ich Ihnen, und ich bitte Sie, in Zukunft zum Ersatz für diese Liebe auf meine Freundschaft rechnen zu wollen.“
„Ich schätze diese unendlich viel höher als das Porträt, ja sogar als das Original. Darf ich die Bitte wagen, ihr meine Antwort zuschicken zu wollen?“
„Das verspreche ich Ihnen. Hier haben Sie Papier, schreiben Sie sie sofort; Sie brauchen sie nicht zu versiegeln.“
Ich schrieb nun folgendes:
„Indem er das Bildnis herausgibt, empfindet Casanova eine viel innigere Freude, als in dem Augenblick, wo er, von einer elenden phantastischen Laune angetrieben, die Torheit beging, es in die Tasche zu stecken.“
Infolge des schlechten Wetters mußte die Wunderhochzeit auf den Sonntag verschoben werden, und da Herr von Bragadino am nächsten Tage nach Padua reiste, so begleitete ich ihn dorthin. Der liebenswürdige alte Herr überließ der Jugend die rauschenden Vergnügungen, die sich für ihn nicht mehr schickten, und verbrachte lieber in friedlicher Ruhe die Tage der venetianischen Feste, bei denen er sich nur noch langweilte.
Am nächsten Sonnabend speiste ich mit ihm zusammen; nach dem Essen küßte ich ihm die Hand, ging dann nach der Post und nahm einen Wagen, um nach Venedig zurückzukehren. Wäre ich von Padua zwei Minuten früher oder später abgereist, so wäre alles ganz anders gekommen, und mein Leben hätte eine ganz andere Wendung genommen – wenn anders es wahr ist, daß unser Leben von Zufällen abhängt. Möge der Leser selber urteilen.
Ich fuhr also in diesem verhängnisvollen Augenblick von Padua ab und begegnete bei Oriago einem Kabriolett, das mit zwei Postpferden bespannt in scharfem Trabe daher kam. In ihm saßen eine sehr hübsche Frau und ein Herr in deutscher Uniform. Einige Schritte von mir entfernt warf das neben dem Fluß entlangfahrende Kabriolett um, und die Frau, die über ihren Begleiter hinweggeschleudert wurde, schwebte in der größten Gefahr, in die Brenta zu rollen. Ich sprang aus meinem Wagen, ohne diesen erst halten zu lassen, und eilte der Dame zu Hilfe, indem ich zugleich mit züchtiger Hand die durch den Sturz verursachte Unordnung ihrer Kleider beseitigte.
Ihr Begleiter war unversehrt aufgestanden; er eilte herzu und fand seine Schöne ganz verblüfft auf der Erde sitzen; doch rührte ihre Verwirrung weniger von dem Sturz her als von ihrer Scham wegen ihrer Entblößung; ich hatte in der Tat gesehen, was eine anständige Frau niemals einem Unbekannten zeigt. Bei ihren Dankesbeteuerungen, die so lange dauerten, als ihr und mein Postillon brauchten, um das Kabriolett wieder aufzurichten, nannte sie mich oft ihren Retter, ihren Schutzengel. Nachdem der Schaden wieder ausgebessert war, setzte die Dame ihre Fahrt nach Padua und ich die meinige nach Venedig fort, wo ich nach meiner Ankunft kaum noch so viel Zeit hatte, um mich zu maskieren, um in die Oper zu gehen.
Am nächsten Morgen maskierte ich mich schon zu früher Stunde, um dem Bucentoro zu folgen, der bei dem schönen Wetter nach dem Lido fahren sollte, wo die große und lächerliche Feierlichkeit vor sich geht. Diese nicht nur eigentümliche, sondern geradezu einzige Feier hängt von dem Mut des Arsenaladmirals ab, denn dieser muß mit seinem Kopf dafür einstehen, daß beständig schönes Wetter sein wird. Der geringste widrige Wind könnte nämlich das Schiff zum Kentern bringen; dann ertränke der Doge mit dem ganzen durchlauchtigsten Senat, den fremden Gesandten und dem Nuntius des Papstes, des Trauzeugen dieser Ulkhochzeit, für die die Venetianer eine an Aberglauben grenzende Verehrung hegen. Das Unglück würde dadurch besonders empfindlich werden, daß ganz Europa darüber lachen und unfehlbar sagen würde, der Doge von Venedig habe endlich seine Ehe wirklich vollzogen.
Ich trank entblößten Gesichtes meinen Kaffee unter den Prokurazien des Markusplatzes, als eine schöne weibliche Maske mir einen galanten Fächerschlag auf die Schulter gab. Da ich die Maske nicht kannte, achtete ich nicht sonderlich auf die Neckerei; ich trank meinen Kaffee aus, nahm meine Maske wieder vors Gesicht und ging nach dem Bestattungsquai, wo die Gondel des Herrn von Bragadino auf mich wartete. In der Nähe der Strohbrücke bemerkte ich dieselbe Maske, die aufmerksam das Bild eines für zehn Soldi zur Schau gestellten Ungeheuers betrachtete. Ich trat an sie heran und fragte sie, mit welchem Recht sie mich geschlagen habe.
„Um Sie dafür zu strafen, daß Sie mich nicht kennen, nachdem Sie mir das Leben gerettet haben.“ Ich erriet, daß sie die Schöne sein mußte, der ich am Tage vorher am Ufer der Brenta zu Hilfe gekommen war. Ich machte ihr mein Kompliment und fragte sie, ob sie mit dem Bucentoro hinausfahre.
„Das würde ich gerne tun, wenn ich eine sichere Gondel hätte“, antwortete sie.
Ich bot ihr die meinige an, die sehr groß war; sie beriet sich einen Augenblick mit ihrem ebenfalls maskierten Begleiter und nahm dann an. Als sie einsteigen wollten, lud ich sie ein, sich zu demaskieren, sie sagten mir jedoch, sie wünschten aus gewissen Gründen unerkannt zu bleiben. Hierauf bat ich sie, mir zu sagen, ob sie irgend einem Gesandten angehörten, denn in diesem Fall müßte ich sie, wenn gleich mit Bedauern, auszusteigen bitten; sie versicherten mir jedoch, sie seien Venetianer. Da die Gondel von den Bediensteten eines Patriziers geführt wurde, so hätte ich mich den Staatsinquisitoren gegenüber bloßstellen können, und dies wünschte ich zu vermeiden.
Wir fuhren also denm Bucentoro nach; neben der Dame sitzend erlaubte ich mir einige Freiheiten, sie brachte mich jedoch etwas aus der Fassung, indem sie den Platz wechselte. Nach der Feierlichkeit kehrten wir nach Venedig zurück, und der Offizier sagte mir, ich würde sie zu Dank verpflichten, wenn ich ihnen die Ehre erweisen wollte, mit ihnen im „Wilden Mann“ zu speisen. Ich nahm die Einladung an, denn ich war neugierig, die Dame kennen zu lernen; was ich von ihr bei dem Sturz gesehen hatte, machte diese Neugierde sehr erklärlich. Der Offizier ließ mich mit ihr allein und ging voraus, um das Essen zu bestellen.
Sobald ich mit der Schönen allein war, sagte ich ihr unter dem Schutz der Maskensreiheit, ich sei in sie verliebt; ich besitze eine Loge in der Oper, die ich ihr zur Verfügung stelle, und wenn sie mir einige Hoffnung geben wolle, daß ich meine Zeit nicht verlieren werde, so sei ich bereit, während des ganzen Karnevals ihr zu dienen. Wenn sie aber die Absicht habe, grausam zu sein, so bitte ich sie, es mir offen heraus zu sagen.
„Und ich bitte Sie, mir zu sagen, mit wem Sie zu tun zu haben glauben.“
„Mit einer durchaus liebenswürdigen Frau, mögen Sie nun eine Prinzessin oder von niedrigstem Stande sein. Dabei wage ich zu hoffen, daß Sie mir schon heute Beweise Ihrer Güte geben werden; anderenfalls werde ich nach dem Essen die Ehre haben, mich Ihnen bestens zu empfehlen.“
„Tun Sie, was Sie wollen, ich hoffe indessen, Sie werden nach dem Essen eine andere Sprache führen; denn der Ton, den Sie jetzt anschlagen, ist nicht gerade ermunternd. Mir scheint, man müßte sich doch erst kennen lernen, bevor man zu einer derartigen Auseinandersetzung kommt. Fühlen Sie das nicht?“
„Gewiß fühle ich das; aber ich fürchte angeführt zu werden.“
„Das ist ja recht eigentümlich. Und wegen dieser Furcht fangen Sie damit an, womit man sonst aufhört?“
„Ich verlange für heute nur ein Wort der Ermutigung. Sagen Sie es mir, und Sie werden sehen, daß ich bescheiden, unterwürfig und verschwiegen bin.“
„Mäßigen Sie sich!“
Wir fanden den Offizier vor der Tür des „Wilden Mannes“, und wir gingen hinein. Sobald wir im Zimmer waren, nahm sie die Maske ab, und ich fand sie noch viel hübscher als am Tage zuvor. Der Form wegen mußte ich noch herausbringen, ob der Offizier ihr Gatte, ihr Liebhaber, ihr Verwandter oder ihr Zuhälter war; ich hatte schon so manches Abenteuer hinter mir und wünschte daher zu erfahren, von welcher Art dieses neu begonnene war.
Wir gingen zu Tisch, und das Benehmen des Herrn und der Dame nötigte mich, Obacht auf mich selber zu geben. Ich bot daher ihm meine Loge an, und er nahm sie an; da ich aber gar keine hatte, so schützte ich nach dem Essen Geschäfte vor und ging fort, um mir eine zu besorgen. Ich mietete eine Loge in der Komischen Oper, wo damals Pertici und Laschi glänzten. Nach der Vorstellung gab ich ihnen ein Abendessen in einem Gasthof und brachte sie dann in meiner Gondel nach Hause, wobei ich unter dem Schutze des nächtlichen Dunkels von der Schönen alle Gunstbezeigungen erhielt, die man in Gegenwart eines dritten, auf den Rücksicht genommen werden muß, bewilligen kann. Als wir uns trennten, sagte der Offizier zu mir: „Sie werden morgen von mir hören.“
„Wo und wie denn?“
„Machen Sie sich darum keine Sorge.“
Am nächsten Morgen meldete man mir einen Offizier; er war es selber. Nachdem wir die üblichen Komplimente ausgetauscht hatten, dankte ich ihm für die Ehre, die er mir am Tage vorher erwiesen hätte, und bat ihn, mir zu sagen, mit wem ich das Vergnügen hätte zu sprechen. Er antwortete mir hierauf in wohlgesetzten Worten, jedoch ohne mich anzusehen.
„Ich heiße P. C. Mein Vater ist reich und steht bei der Börse in gutem Ansehen; wir sind jedoch entzweit. Ich wohne am Markusufer. Die Dame, die Sie sahen, ist eine geborene O.; sie ist die Frau des Maklers C., und ihre Schwester ist die Gattin des Patriziers P. M. Frau C. hat sich meinetwegen mit ihrem Gemahl entzweit, wie ich ihretwegen in Unfrieden mit meinem Vater lebe. Ich trage meine Uniform dank einem österreichischen Hauptmannspatent; doch habe ich niemals gedient. Ich habe die Ochsenlieferung für den Staat Venedig, und ich beziehe meine Ware aus Steiermark und Ungarn. Diese Unternehmung ist ein glattes Geschäft, das mir einen jährlichen Nutzen von zehntausend Gulden sichert. Aber eine unvorhergesehene Verlegenheit, der ich sofort abhelfen muß, ein betrügerischer Bankerott und außerordentliche Ausgaben sind schuld, daß ich mich augenblicklich in großer Geldnot befinde. Vor vier Jahren hörte ich von Ihnen sprechen, und seitdem hatte ich stets den Wunsch, Ihre Bekanntschaft zu machen; ich glaube, der Himmel selber hat Sie vorgestern herbeigeführt. Ich bitte Sie daher ohne Zaudern um eine bedeutende Gefälligkeit, die uns zu innigster Freundschaft verbinden wird. Sie können mir beispringen, ohne das geringste Risiko einzugehen, indem Sie diese drei Wechsel akzeptieren; und Sie brauchen nicht zu befürchten, daß Sie sie einlösen müssen; denn ich gebe Ihnen dafür diese drei anderen, die vor den Ihrigen fällig sind. Außerdem verpfände ich Ihnen die Ochsenlieferung für das ganze Jahr; Sie könnten, wenn ich Ihnen nicht Wort hielte, alle meine Ochsen in Triest mit Beschlag belegen; auf einem anderen Wege können sie nämlich nicht kommen.“
Ich war erstaunt über diese Rede und über den Plan, der mir auf unsicheren Füßen zu stehen schien und mir nur Verlegenheiten in Aussicht stellte; und vor solchen hatte ich Abscheu. Eigentümlich fand ich auch den Einfall dieses Menschen, sich einzubilden, ich würde leicht auf den Leim gehen, und mir daher den Vorzug vor hundert anderen zu geben, die er besser kennen mußte. Ich sagte ihm daher ohne Zögern, ich würde sein Anerbieten niemals annehmen. Er verdoppelte seine Beredsamkeit, um mich zu überzeugen, aber ich brachte ihn in Verlegenheit, als ich ihm sagte, ich müßte mich doch sehr darüber wundern, daß er mich allen seinen Bekannten vorzöge, da ich doch erst seit zwei Tagen die Ehre hätte, ihm bekannt zu sein. Er antwortete mir jedoch mit frecher Stirn: „Mein Herr, ich erkannte in Ihnen einen sehr klugen Mann und war daher überzeugt, Sie würden sofort das Vorteilhafte meines Anerbietens erkennen und daher ohne Schwierigkeit zur Annahme desselben bereit sein.“
„Sie müssen sich jetzt überzeugt haben, daß Sie sich in Ihrer Annahme irrten, und Sie werden mich ohne Zweifel für einen Dummkopf halten, indem Sie jetzt sehen, daß ich von Ihnen angeführt zu werden fürchte, wenn ich auf Ihren Vorschlag einginge.“
Er bat mich um Entschuldigung und ging, nachdem er mir noch gesagt hatte, er hoffe mich abends aus dem Markusplatz zu sehen; er werde mit Frau C. dort sein. Er hinterließ mir seine Adresse, indem er mir sagte, er habe ohne Wissen seines Vaters seine alte Wohnung im väterlichen Hause beibehalten. Dies hieß soviel, als daß ich seinen Besuch erwidern sollte; wäre ich vernünftig gewesen, so hätte ich mir dies geschenkt.
Ich ärgerte mich, daß der Mensch seine Absichten gerade auf mich geworfen hatte, und verspürte durchaus keine Lust mehr, mein Glück bei seiner Schönen zu versuchen; denn es kam mir vor, als habe das Pärchen beschlossen, mich auszubeuten, und da ich nicht die geringste Lust hatte, mich ausbeuten zu lassen, so vermied ich es, am Abend auf dem Markusplatze mit ihnen zusammenzutreffen. Bei diesem Verhalten hätte ich bleiben sollen; am nächsten Tage aber trieb mich mein böser Geist, ihn zu besuchen; ich dachte, ein Höflichkeitsbesuch würde nichts zu bedeuten haben.
Ein Bedienter führte mich in C.’s Zimmer; er empfing mich sehr liebenswürdig und machte mir freundliche Vorwürfe, daß ich mich am vorigen Abend nicht hätte sehen lassen. Hierauf sprach er wieder von seiner Unternehmung und zeigte mir einen ganzen Haufen von Papieren, was mich sehr langweilte. „Wenn Sie die drei Wechsel akzeptieren wollen“, sagte er, „mache ich Sie zum Teilhaber bei meinem Unternehmen.“ Durch diesen außerordentlichen Freundschaftsbeweis schenkte er mir nach seiner Behauptung fünftausend Gulden jährlich; meine ganze Antwort bestand jedoch darin, daß ich ihn bat, niemals mehr mit mir davon zu sprechen. Als ich mich verabschiedete, sagte er mir, er wolle mich seiner Mutter und Schwester vorstellen.
Er ging und kam nach zwei Minuten mit ihnen wieder. Die Mutter war eine Frau von unbefangenem und ehrlichem Aussehen, die Schwester geradezu ein Muster von Schönheit. Ich war wie geblendet. Eine Viertelstunde darauf bat die allzu vertrauensselige Mutter mich um Erlaubnis, sich zurückziehen zu dürfen; die Tochter aber blieb. Sie brauchte keine halbe Stunde, um mich völlig zu fesseln. Ich war bezaubert von allen ihren Vollkommenheiten, und ihr lebhafter Geist, von einer naiven, mir ganz neuen Art, ihre Unschuld und Treuherzigkeit, ihr natürliches und doch hohes Gefühl, ihre fröhliche und unschuldige Lebhaftigkeit, mit einem Wort ihr ganzes Wesen voll Schönheit, Klugheit und Unschuld – ein Wesen, dem ich niemals habe widerstehen können – dies alles machte mich zum Sklaven des vollkommensten Weibes, das die Phantasie sich ersinnen kann.
Fräulein C. C. ging stets nur mit ihrer Mutter aus, welche fromm und trotzdem nachsichtig war. Zum Lesen hatte sie nur die Bücher ihres Vaters, der als verständiger Mann gar keine Romane besaß; sie aber brannte vor Begierde, grade Solche Bücher zu lesen. Sie hatte auch die größte Lust, Venedig kennen zu lernen; da kein Mensch ihr Haus besuchte, so hatte ihr auch noch niemand gesagt, daß sie ein wahres Wunder war. Während ihr Bruder mit Schreiben beschäftigt war, unterhielt ich mich mit ihr, besser gesagt: ich beantwortete die zahlreichen Fragen, die sie an mich stellte; dies konnte ich nur tun, indem ich ihre Begriffe, die sie zu ihrem eigenen großen Erstaunen als schon vorhanden erkannte, noch erweiterte; ihre Seele befand sich noch im Zustande des Chaos. Nur eins sagte ich ihr nicht: daß sie schön sei und ich mich im höchsten Grade für sie interessiere; ich hatte dies schon so vielen anderen vorgelogen und fürchtete grade bei ihr, mich durch solche Äußerungen verdächtig zu machen.
Traurig und nachdenklich verließ ich ihr Haus; die seltenen Eigenschaften, die ich an der entzückenden Person entdeckt hatte, machten auf mich einen tiefen Eindruck, und ich nahm mir vor, sie niemals wiederzusehen; denn ich glaubte zu fühlen, daß ich nicht der Mann dazu war, ihr ganz und gar meine Freiheit zu opfern, indem ich sie zur Gattin verlangte; und doch hielt ich sie für geschaffen, mich glücklich zu machen.
Ich hatte seit meiner Rückkehr Frau Manzoni noch nicht wiedergesehen und lenkte nun meine Schritte ihrer Behausung zu. Ich fand die würdige Frau genau so, wie sie immer zu mir gewesen war, und sie empfing mich in der freundschaftlichsten Weise. Sie erzählte mir, Teresa Imer, das hübsche Mädchen, um dessentwillen ich vor dreizehn Jahren von Herrn von Malipiero einen Hieb mit dem Rohrstock erhalten, sei soeben von Bayreuth zurückgekehrt, wo sie als Geliebte des Markgrafen ein Vermögen erworben habe. Da sie Frau Manzoni gegenüber wohnte, beschloß diese, sie auf scherzhafte Art zu überraschen, und ließ sie bitten, auf einen Augenblick herüber zu kommen. Wirklich kam sie einige Augenblicke darauf mit einem bildschönen achtjährigen Knaben an der Hand. Er war ihr einziges Kind und stammte von ihrem Mann, der in Bayreuth Tänzer war. Unsere Überraschung bei diesem Wiedersehen war ebenso groß wie unser Vergnügen an den Erinnerungen unserer Kinderjahre. Diese Erinnerungen konnten sich freilich nur auf Kindereien beziehen. Ich beglückwünschte sie zu dem erlangten Vermögen, und sie glaubte, nach dem äußeren Anschein urteilend, mir dies Kompliment erwidern zu müssen. Ihr Glück wäre jedoch von festerem Bestande gewesen als das meinige, wenn sie in den späteren Jahren sich vernünftig benommen hätte. Aber sie hatte Launen, von denen ich dem Leser fünf Jahre später erzählen werde. Sie war eine große Sängerin geworden; doch verdankte sie keineswegs ihr ganzes Vermögen ihrem Talent; ihre Reize hatten dazu mehr als alles andere beigetragen. Sie erzählte mir ihre Erlebnisse, zweifelsohne mit einigen Ausschmückungen, und wir trennten uns erst, nachdem wir zwei volle Stunden geplaudert hatten. Sie lud mich ein, ihr das Vergnügen zu machen und am nächsten Morgen bei ihr zu frühstücken. Der Markgraf ließe sie beobachten, wie sie sagte; aber da ich ein alter Bekannter wäre, so könnte ich keinen Verdacht erregen. Das ist die Redensart aller galanten Damen. Sie sagte mir ferner, ich könnte sie am selben Abend in ihrer Loge besuchen; Herr Papafava würde mich mit Vergnügen sehen. Dieser war ihr Pate. Am nächsten Tage ging ich schon in der Frühe zu ihr. Ich fand sie im Bett mit ihrem Sohn, der als wohlerzogener Knabe sofort aufstand und hinausging, als er mich neben ihrem Bett Platz nehmen sah. Ich verbrachte mit ihr drei Stunden, von denen die letzte – dessen erinnere ich mich noch – köstlich war; in fünf Jahren wird der Leser die Folgen davon kennen lernen. Ich sah sie während der vierzehn Tage, die sie in Venedig verbrachte, noch ein zweites Mal, und bei ihrer Abreise versprach ich ihr, sie in Bayreuth zu besuchen; ich habe ihr aber nicht Wort gehalten.
Um diese Zeit mußte ich mich mit den Angelegenheiten meines nachgeborenen Bruders beschäftigen, der nach seiner Behauptung eine ganz göttliche Berufung zum Priestertum empfand; er brauchte aber dazu ein Vermögen. Unwissend, ganz unerzogen und ohne alle Vorzüge, außer einem hübschen Gesicht, erblickte er im geistlichen Stande sein Glück; er setzte große Hoffnungen auf das Predigen, wofür er nach der Behauptung der Frauen seiner Bekanntenkreise ein ausgesprochenes Talent besaß. Ich tat alle von ihm gewünschten Schritte, und es gelang mir, den Abbate Grimani dahin zu bringen, daß er ihm ein Einkommen aussetzte. Er war nämlich in unserer Schuld für alle Möbel unseres elterlichen Hauses, worüber er niemals Rechenschaft abgelegt hatte. Er übertrug ihm den lebenslänglichen Nießbrauch eines Hauses, und zwei Jahre später erhielt mein Bruder als Besitzer eines väterlichen Erbteils die Weihen. Übrigens war dieses Erbteil nur zum Schein vorhanden, denn das Haus war bereits in Höhe seines Wertes mit Hypotheken belastet; aber Herr Abbate Grimani war ein Stück Jesuit, und diesen heiligen Dienern Gottes sind alle Mittel recht, wenn sie ihnen nur Vorteil bringen. Ich werde von der Aufführung dieses unglücklichen Bruders sprechen, sobald wir an die Periode kommen, wo er in die Wechselfälle meines eigenen Lebens eintritt.
Zwei Tage nach meinem Besuch bei P. C. traf ich ihn auf der Straße. Er sagte mir, seine Schwester spreche unaufhörlich von mir, sie habe von meinen Bemerkungen eine Menge behalten, und ihre Mutter sei entzückt, daß sie meine Bekanntschaft gemacht habe. „Sie wäre“, sagte er, „eine gute Partie für Sie, denn sie bekommt eine Mitgift von zehntausend Silberdukaten. Wenn Sie morgen zu mir kommen, können wir mit meiner Mutter und mit meiner Schwester Kaffee trinken.“
Ich hatte mir vorgenommen, seine Wohnung nicht wieder zu betreten, aber ich hielt mir nicht Wort. Ubrigens kommt in dergleichen Fällen ein Mensch leicht dazu, seinem Vorsatz untreu zu werden. Ich verbrachte drei Stunden im Geplauder mit dem reizenden Kinde, und als ich von ihr ging, war ich verliebt bis über die Ohren. Beim Abschied sagte ich zu ihr, ich beneidete den Mann, der sie zur Frau gewinnen würde, und dieses Kompliment – das erste der Art, das ihr je gemacht wurde – bedeckte ihr schönes Gesicht mit hellster Röte. Als ich draußen war, prüfte ich den Charakter des Gefühles, das ich für sie empfand, und erschrak darüber, denn ich konnte C. C. gegenüber weder als ehrlicher Mensch noch als Wüstling handeln. Ich konnte mir nicht mit der Hoffnung schmeicheln, ihre Hand zu erlangen, und mir war zumute, als würde ich jeden erdolchen, der mir den Rat gäbe, sie zu verführen. – Ich empfand das Bedürfnis, mich zu zerstreuen; so ging ich spielen. Das Spiel ist zuweilen ein ausgezeichnetes Linderungsmittel gegen Aufregungen der Liebe. Ich spielte glücklich und ging mit einer goldgefüllten Börse nach Hause.
Auf dem Heimweg begegnete mir in einem menschenleeren Gäßchen ein Mann, dem das Alter und noch mehr das Elend den Rücken gebeugt hatte. Näherkommend erkannte ich in ihm den Grafen Bonafede. Sein Anblick erregte mein Mitleid. Er erkannte mich ebenfalls und erzählte mir allerlei; zum Schluß aber schilderte er mir das Elend, worin er durch die Notwendigkeit, für den Unterhalt seiner zahlreichen Familie zu sorgen, sich befände. „Ich schäme mich nicht, Sie um eine Zechine zu bitten, von der ich fünf oder sechs Tage werde leben können.“ Ich beeilte mich, ihm zehn zu geben, und hielt mit Mühe die Ausbrüche seiner Dankbarkeit zurück; aber ich konnte ihn nicht verhindern, Tränen zu vergießen. Beim Abschied sagte er mir, um sein Unglück voll zu machen, sei seine Tochter eine Schönheit geworden; sie wolle aber lieber sterben als ihre Tugend der Not opfern. „Ich kann“, so schloß er, „sie in diesen Gefühlen weder bestärken noch sie dafür belohnen.“
Ich glaubte die Wünsche zu verstehen, die er in seiner Not hegen mußte, und ließ mir seine Adresse geben, indem ich ihm versprach, ihn besuchen zu wollen. Ich war neugierig zu sehen, was wohl aus einer Tugend geworden sein mochte, von der ich in den zehn Jahren, seitdem ich das Mädchen nicht gesehen, niemals eine große Meinung gehabt hatte. Am nächsten Tage ging ich hin. Ich fand ein Haus, worin fast jedes Hausgerät fehlte; das Mädchen war allein, was mich jedoch keineswegs überraschte. Die junge Gräfin hatte mich kommen sehen und empfing mich auf das liebenswürdigste oben an der Treppe. Sie war ziemlich gut gekleidet, und ich fand sie ebenso schön, lebhaft und liebenswürdig wie damals, als ich sie im Fort Sant’ Andrea zum letztenmal gesehen hatte. Ihr Vater hatte ihr gesagt, daß ich sie besuchen würde, sie strahlte vor Freude und umarmte mich so zärtlich, wie man nur einen angebeteten Liebhaber umarmen kann. Sie führte mich in ihr Zimmer. Nachdem sie mir gesagt hatte, ihre Mutter liege krank im Bett und könne sich nicht sehen lassen, überließ sie sich einem neuen Freudenausbruch über das Glück, das ihr, wie sie sagte, unser Wiedersehen bereitete. Unter dem Vorwande der Freundschaft wurden stürmische Küsse gegeben und empfangen, die bald unsere Sinne entflammten, so daß mir schon nach der ersten Viertelstunde nichts mehr zu wünschen übrig blieb. Nachdem es geschehen war, mußten wir uns natürlich überrascht zeigen oder wenigstens stellen, und ehrenhalber konnte ich nicht umhin, der armen Gräfin zu versichern, daß ich in ihrer Hingabe nur das erste Pfand einer dauernden Liebe sehe. Sie glaubte mir dies oder tat doch so, wie übrigens auch ich in jenem Augenblick selber es glaubte. Als wir wieder ruhiger geworden waren, sprach sie mit mir von ihrer fürchterlichen Lage; sie erzählte mir, ihre Brüder trieben sich barfuß in den Straßen umher, und ihr Vater könnte ihnen tatsächlich nicht das tägliche Brot geben.
„Sie haben also keinen Liebhaber?“
„Wie? Einen Liebhaber? Welcher Mann hätte wohl den Mut, in einem derartigen Hause mein Liebhaber sein zu wollen? Und bin ich etwa dazu da, um schnöden Vorteils willen mich dem ersten besten für dreißig Soldi preiszugeben? Höher aber kann mich in Venedig niemand einschätzen, wenn er mich in diesem Hause sieht. Übrigens fühle ich keinen Beruf, mich zu prostituieren!“
Eine Unterhaltung solcher Art ist nicht lustig, sie vergoß Tränen, und das Bild ihrer Traurigkeit im Verein mit der elenden Umgebung, die ich vor Augen hatte, war nicht danach angetan, meine Liebe wieder zu erwecken. Beim Abschied versprach ich ihr, wiederzukommen, und drückte ihr dabei zwölf Zechinen in die Hand. Sie war erstaunt über eine derartige Summe, niemals hatte sie sich so reich gesehen. Ich habe stets bedauert, ihr nicht das Doppelte gegeben zu haben.
Am nächsten Tage besuchte P. C. mich und sagte mit freudestrahlendem Gesicht, seine Mutter habe ihrer Tochter erlaubt, mit ihm in die Oper zu gehen; die Kleine sei ganz entzückt davon, weil sie noch niemals dort gewesen sei, und wenn es mir Vergnügen mache, könne ich sie irgendwo erwarten.
„Aber weiß Ihre Schwester denn, daß Sie mich als Teilnehmer zulassen wollen?“
„Sie freut sich schon darauf.“
„Und Ihre Frau Mutter? Weiß die es?“
„Nein; aber wenn sie es erfahren sollte, wird es ihr nicht unangenehm sein, denn Sie haben ihr hohe Achtung eingeflößt.“
„Ich will versuchen, eine Loge zu beschaffen.“
„Vortrefflich. Erwarten Sie uns da und da.“
Der Bursche sprach nicht mehr von Wechseln. Da er sah, daß ich seiner Dame nicht mehr den Hof machte, dagegen in seine Schwester verliebt war, so hatte er den schönen Plan ausgeheckt, mir diese zu verkaufen. Ich beklagte Mutter und Tochter, die einem solchen Subjekt ihr Vertrauen Schenkten, aber ich war nicht tugendhaft genug, die Einladung abzulehnen. Ich überredete mich sogar, daß ich, eben weil ich C. C. liebte, die Einladung annehmen müßte, um sie vor anderen Hinterhalten zu bewahren; denn wenn ich abgelehnt hätte, so würde er vielleicht einen weniger Gewissenhaften und Feinfühlenden gefunden haben, und dieser Gedanke war mir unerträglich. Mir schien, von meiner Seite hätte sie keinerlei Gefahr zu besorgen.
Ich mietete eine Loge in der Oper San Samuele und erwartete sie lange vor der festgesetzten Zeit am verabredeten Orte. Sie kamen, und der Anblick meiner jungen Freundin entzückte mich. Sie war elegant maskiert, und ihr Bruder trug seine Uniform. Um das reizende Mädchen nicht der Gefahr auszusetzen, daß sie als Begleiterin ihres Bruders erkannt würde, ließ ich sie schnell in meine Gondel einsteigen. Er bat mich, ihn bei der Wohnung seiner Geliebten abzusetzen; sie wäre krank; wir möchten nur in unsere Loge gehen, er würde nachkommen. Zu meinem Erstaunen bekundete C. C. weder Überraschung noch Widerstreben, mit mir allein in der Gondel zu bleiben; über das Verschwinden ihres Bruders wunderte ich mich jedoch durchaus nicht, denn er verfolgte dabei offenbar seine Absichten. Ich sagte C. C., wir wollten bis zum Beginn der Vorstellung spazieren fahren; bei der starken Hitze müßte sie die Maske abnehmen. Dies tat sie denn auch augenblicklich. Ich hatte mir die Pflicht auferlegt, ihre Unschuld zu achten, und die edle Zuversicht, die aus ihren schönen Zügen und aus ihren vertrauensvollen Blicken leuchtete, die unschuldige Freude, die sie kundgab – dies alles vermehrte noch meine Liebe zu ihr.
Natürlich konnte ich ihr nur von meiner Liebe sprechen, da aber dies ein heikler Punkt war, so wußte ich nicht, was ich sagen sollte; ich begnügte mich daher damit, ihr reizendes Gesicht zu betrachten, denn aus Furcht, ihre Schamhaftigkeit zu beunruhigen, wagte ich nicht, meine Blicke auf zwei knospende Halbkugeln zu heften, die von den Liebesgöttern selber gerundet waren.
„Erzählen Sie mir doch irgend was!“ rief sie; „Sie sehen mich ja nur immerfort an und sagen kein Wort; Sie bringen mir heute ein Opfer, denn mein Bruder hätte Sie sonst zu seiner Dame mitgenommen, die nach seiner Schilderung schön wie ein Engel sein muß.“
„Ich habe die Dame gesehen.“
„Sie muß sehr geistvoll sein.“
„Das mag sein. Ich habe davon nichts bemerken können, denn ich war niemals bei ihr, und habe auch nicht die Absicht, sie je zu besuchen. Glauben Sie also ja nicht, schöne C., daß ich Ihnen das geringste Opfer bringe!“
„Ich glaubte es; denn da Sie nicht sprachen, so dachte ich, Sie seien traurig.“
„Wenn ich nicht zu Ihnen spreche, so geschieht es vor Bewegung über das Glück, das Ihr engelhaftes Vertrauen mir bereitet.“
„Das freut mich außerordentlich. Aber wie sollte ich denn nicht Vertrauen zu Ihnen haben? Ich fühle mich bei Ihnen freier und viel sicherer als in Gegenwart meines Bruders. Meine Mutter selber sagt, man könne sich in Ihnen nicht täuschen, und Sie seien ganz gewiß ein hochanständiger Mann. Übrigens sind Sie unverheiratet; das war das erste, wonach ich meinen Bruder fragte. Erinnern Sie sich Ihrer Worte, Sie beneideten den, der mich zur Frau bekommen würde, um sein Glück? Ich sagte in demselben Augenblick, das Mädchen, das Sie einmal zum Gatten erhalte, werde die glücklichste Frau in ganz Venedig sein.“
Diese Worte, die sie mit der unbefangensten Naivität und in einem von Herzen kommenden Ton der Aufrichtigkeit sagte, machten auf mich einen Eindruck, den ich schwer beschreiben kann. Leider konnte ich nicht wagen, den zärtlichsten Kuß auf die Rosenlippen zu drücken, die diese Worte ausgesprochen hatten; zugleich aber empfand ich einen köstlichen Genuß, mich von diesem Engel geliebt zu sehen.
„Da also unsere Gefühle so übereinstimmen“, sagte ich, „so könnten wir, liebenswürdige C., das vollkommenste Glück erlangen, wenn wir untrennbar verbunden werden könnten. Aber ich könnte ja Ihr Vater sein!“
„Sie mein Vater! Welch ein Unsinn! Wissen Sie denn nicht, daß ich vierzehn Jahre alt bin.“
„Und wissen Sie nicht, daß ich achtundzwanzig zähle?“
„Nun, welcher Mann Ihres Alters hätte wohl ein Kind, so alt wie ich! Ich muß lachen, wenn ich daran denke, daß ich ganz gewiß niemals Angst vor meinem Vater haben würde, wenn er Ihnen ähnlich sähe. Ich könnte mich dann ihm gegenüber gar nicht mehr zurückhalten!“
Da es Zeit war, ins Theater zu gehen, so verließen wir die Gondel. Die Vorstellung nahm sie ganz und gar in Anspruch. Ihr Bruder erschien erst gegen Ende; so paßte es ihm in seinen Plan. Ich gab ihnen ein Abendessen in einem Gasthof, und über dem Vergnügen, das reizende Kind mit sehr gutem Appetit essen zu sehen, vergaß ich ganz, daß ich nicht zu Mittag gegessen hatte. Ich sprach während der ganzen Mahlzeit fast kein Wort, denn ich war liebeskrank und in einem Zustande der Erregung, der unmöglich lange dauern konnte. Zur Entschuldigung meines Schweigens schützte ich Zahnschmerzen vor; sie bedauerten mich und ließen mich schweigen.
Nach dem Essen sagte P. zu seiner Schwester, ich sei in sie verliebt und würde Erleichterung verspüren, wenn sie mir erlaubte, sie zu küssen. Ihre ganze Antwort bestand darin, daß sie mit lachenden, kußheischenden Lippen sich mir zuwandte. Ich glühte; aber ich hatte solche Achtung vor dem unschuldigen ahnungslosen Geschöpf, daß ich sie nur auf die Wange küßte, noch dazu auf anscheinend ganz kalte Art.
„Was ist das für ein Kuß!“ rief da aber P. „Vorwärts, vorwärts, einen tüchtigen Liebeskuß!“
Ich rührte mich nicht; der schamlose Kuppler war mir lästig. Aber seine Schwester wandte den Kopf zur Seite und sagte traurig: „Dränge ihn nicht, ich habe nicht das Glück, ihm zu gefallen!“
Dieser Ausdruck brachte meine ganze Verliebtheit in Aufruhr; ich verlor die Selbstbeherrschung und rief feurig: „Wie, schöne C.? Sie wollen meine Zurückhaltung nicht dem Gefühl zuschreiben, das Sie mir eingeflößt haben? Sie glauben, Sie gefallen mir nicht? Wenn es nur eines Kusses bedarf, um Sie darüber zu beruhigen, so empfangen Sie ihn als Zeichen der innigen Gefühle, die ich für Sie empfinde.“
Mit diesen Worten schloß ich sie in meine Arme, preßte sie liebestrunken an meine Brust und drückte ihr auf den Mund einen langen, glühenden Kuß, den ihr zu geben mich schon längst die Sehnsucht verzehrte. Aber an diesem Kuß merkte die schüchterne Taube, daß sie in die Klauen des Geiers gefallen war. Ganz erstaunt, auf diese Weise meine Verliebtheit entdeckt zu haben, entwand sie sich meinen Armen. Ihr Bruder klatschte beifällig in die Hände, während sie ihre Maske wieder vornahm, um ihre Verwirrung zu verbergen. Ich fragte sie, ob sie noch immer glaube, daß sie mir nicht gefalle.
„Sie haben mich überzeugt; aber Sie dürfen mich nicht dafür strafen, daß Sie mir meinen Irrtum benommen haben.“
Ich fand diese Antwort sehr zartfühlend, denn sie war ihr vom Gefühl eingegeben. Ihr Bruder aber war nicht damit zufrieden und erklärte sie für dummes Gerede.
Wir legten unsere Masken an und gingen. Ich begleitete sie nach Hause und begab mich dann selber heim. Ich war sehr verliebt, im Grunde meines Herzens zufrieden und dennoch sehr traurig.
Der Leser wird in den nächsten Kapiteln sehen, welchen Fortgang meine Liebschaft nahm und in welche Abenteuer ich durch sie geriet.