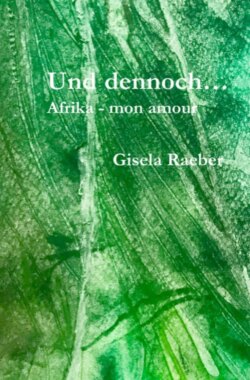Читать книгу Und dennoch ... - Gisela Raeber - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEine Ruine
Im Juni 1996 kam Nel allein in Kameruns Hauptstadt Yaoundé an. Olaf musste vorher beruflich noch eine Woche nach Burundi zum vollständigen Abschluss des vorigen Projekts.
Da in Yaoundé derzeit ein großer internationaler Kongress stattfand, waren alle Hotels belegt und die GTZ brachte Nel am Stadtrand in einem riesigen Haus unter, dessen Besitzer gerade in Europa seine Ferien verbrachte. Es gab dort neun Schlafzimmer, jedes mit einem eigenen Bad, was wohl einiges über die Größe aussagte. Dazu eine Meute Doggen, die ständig kläfften und verköstigt werden mussten.
Da saß sie nun und wartete und langweilte sich und stellte sich zum zwanzigsten Mal die Frage, ob Olaf überhaupt irgendwann erscheinen würde.
Er traf tatsächlich nach acht Tagen ein. Und dann brachen sie sofort nach Yokadouma auf, in den Südosten des Landes nicht weit von der Grenze zur Zentralafrikanischen Republik.
Die Stadt und die ganze Gegend lebten hauptsächlich vom Holzabbau in den nahegelegenen Tropenwäldern. Die angesiedelten, vor allem europäischen Holzfirmen, betrieben hier den sogenannten selektiven Holzeinschlag.
Sechshundertfünfzig Kilometer betrug die Entfernung von Yaoundé. Einhundertfünfzig davon waren asphaltiert.
Danach gab es nur noch Piste, riesige Schlaglöcher, tiefe Fahrrinnen und Brücken mit maroden Brettern. Täglich donnerten hier in beiden Richtungen bis zu siebenhundert Holzlaster durch. Sie brachten ihre Ladung in die Hafenstadt Douala zur Verschiffung.
Zwölf Stunden dauerte im Durchschnitt die Fahrt von der Hauptstadt bis nach Yokadouma. Es war ratsam unterwegs einmal zu übernachten, weil die Route einfach zu aufreibend war.
In Yokadouma angekommen, machten sich die beiden auf die Suche nach einem Haus. Die ersten Monate verbrachten sie in einer bescheidenen Herberge. Sie belegten dort zwei Räume, einen für Kisten, Koffer, Hausrat und sonstige Artikel, die sie mitgebracht hatten. Den anderen benutzten sie als Schlafzimmer mit Bett, Tisch und einer primitiven Dusche. Eine Glühbirne baumelte von der Decke, der einzige verfügbare Stuhl wackelte bedrohlich.
Die LKW-Fahrer waren dort Stammgäste. Wenn sie im Morgengrauen ihre Fahrt aufnahmen, wurden Olaf und Nel von dem Lärm der Holzlaster und ihrem Abgasgestank geweckt. Das alles wirkte deprimierend auf Nel, die außer Ferien in Burundi noch keine Afrikaerfahrung hatte. Manchmal fragte sie sich, was sie hier überhaupt mache und kam sich vor wie im falschen Film.
Endlich im September fand Olaf ein Haus. Aber was für eines! Eine Ruine, die aus der Kolonialzeit stammte und im ehemaligen administrativen Teil der Stadt auf einem Hügel gelegen war. Groß war es, mit riesigem Grundstück, aber völlig heruntergewirtschaftet. Kein Strom. Kein Wasser. Das Dach war eingefallen, die meisten Fenster und Türen fehlten. Sie waren wohl irgendwann als Brennholz verwendet worden.
„Olaf, wie sollen wir denn hier bloß leben? Das ist doch völlig desolat. Hier muss alles, aber auch alles, erneuert werden.” hielt Nel ihm entgegen. „Zuerst diese miese Herberge und jetzt ein Trümmerhaufen. Da habe ich mich zwei Jahre beurlauben lassen und falle hier allmählich einer Depression zum Opfer.“
„Ach komm schon“, meinte Olaf, „wir schaffen das. Du bist doch sonst immer so optimistisch. Ich gebe zu, das Haus verlangt eine Menge Arbeit, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es dann nachher aussehen wird. Eine schöne Terrasse, große, helle Zimmer, viel Platz, ein Garten.... Eine Waschmaschine haben wir ja schon.“
„Also, ich weiß nicht. Ich fühle mich völlig überfordert.“
„Du wirst doch jetzt nicht verzagen, Schatz, das ist eben Afrika! Da müssen wir durch!“ Olaf nahm Nel in die Arme und wirbelte sie herum. Dann lachte er und vollführte eine kreisrunde Armbewegung.
„Schau dir mal die Lage an. All das für uns alleine. Schön auf dem Hügel gelegen mit herrlicher Aussicht. Und Nachbarn stören uns auch keine. Wo sonst findest du so etwas?“
Und so lebten sie anderthalb Jahren lang auf einer Baustelle. Sie schliefen auf Matratzen am Boden. Elektrizität und Wasserleitungen wurden angelegt, das Dach gedeckt. Nel hatte Bilder aus einem alten Ikea-Katalog ausgeschnitten und sie zu den einheimischen Schreinern gebracht, damit sie Tische, Stühle, Schränke, Fenster, Türen und Betten anfertigen konnten. Alle sechs Wochen fuhren sie nach Yaoundé, kauften dort Baumaterial, Werkzeug, Geräte, Stoffe und Farben und kamen mit einem vollgepackten Pick-up zurück.
Sie zeichneten, maßen, berechneten, schnitten zu, schraubten, hobelten, bauten, strichen, und ab und zu fluchten sie wie die Fuhrkutscher.
Hinzu kam, daß es oft fünf Tage lang keinen Strom gab. Kam er endlich wieder, passierte das in Stößen, da es keinen Spannungsregler gab. Die Nähmaschine ging von alleine los. Es erinnerte Nel an den alten Charly Chaplin Film „Moderne Zeiten“.
War sie gerade beim Wäschewaschen, fiel das Wasser aus und nach ein oder zwei Tagen brauchte das Naß seine Zeit, um bis auf ihren Hügel zu gelangen. Welcome to Africa!
Aber sie schafften es. Nel machte sogar einen kleinen Teil des Geländes urbar, um einen Gemüsegarten anzulegen. Die Beete wurden mit Brettern eingefasst, damit die Erde in der Regenzeit nicht fortgeschwemmt würde. Gemüse und Salat brachten zwar nicht viel. Mal war es zu warm und zu trocken, dann wieder zu nass. Oder verschiedene Plagegeister fraßen über Nacht die zarten Triebe ab. Doch Schnittlauch, Zitronenmelisse, Koriander, Dill und Minze gediehen wunderbar.
Gleich daneben baute Olaf einen Kaninchenstall.
Nel stöberte ein gemütliches Sofa auf, auch ein paar Bilder zur Dekoration. Sie kaufte ein gutes Duzend Kerzen, nicht nur für die Romantik sondern auch für den Stromausfall. Musik-CDs hatte sie von zu Hause dabei.
Sogar Kissen und Vorhänge nähte sie und war froh, daß sie eine Nähmaschine mitgebracht hatte. Irgendwann war die dann kaputt. Nel brachte sie zur Reparatur nach Yaoundé. Vier Wochen später holte sie sie wieder ab. Das Ding funktionierte immer noch nicht. Es fehlte ein Teil. Das wurde einfach ausgebaut, um eine andere Maschine zu reparieren. Nochmals welcome to Africa.
Mit Olaf war Nel oft im Projektgelände unterwegs. Rund um den Park wurden Holzkonzessionen an europäische Firmen vergeben, um den Abschlag kontrollierbar zu gestalten. Es wurde eine Pufferzone zwischen dem Nationalparkgelände und den Dörfern angelegt.
Die beiden lernten in der Gegend viele einflussreiche einheimische und ausländische Akteure kennen. Das war sehr wichtig. Man war solidarisch und konnte sich gegenseitig helfen. Zum Beispiel hatten die Holzgesellschaften immer ihre eigenen Flugpisten. Wenn man mal ernsthaft krank wäre, könnte man so schnell wegkommen.
Olaf hatte ihr gesagt, sie könne sicherlich an seinem Projekt mitarbeiten. Leider stellte sich heraus, daß dies wegen ihrer damals noch mangelhaften Französischkenntnisse praktisch nicht möglich war. Trotzdem fühlte sie sich frustriert, als Olaf die Frau eines kamerunischen Mitarbeiters als Sekretärin engagierte.
„Olaf, ich glaube es ist an der Zeit, daß ich mich anderswo umsehe, wie ich mich nützlich machen kann. Ich möchte gern eine sinnvolle Aufgabe übernehmen. Wir kennen ja inzwischen viele Leute und ich bin praktisch veranlagt. Irgendwo werde ich sicherlich einen Job finden.“
Und das ergab sich auch bald. Als sie das nächste Mal in Yaoundé waren hörte sie, daß die GTZ gerade plante, eine Bibliothek für die Projektverwaltung einzurichten. Hier sollten sämtliche Dokumente, Unterlagen, Berichte und Veröffentlichungen aus den Projekten zusammengetragen werden. Es gab bereits ein Computerprogramm für Klassifizierung, Nummerierung und Stichwortsuche. Nel sprach vor und wurde sofort engagiert. Vor Ort arbeitete sie sich ein und nahm jede Menge Kartons voller Material mit nach Yokadouma, wo sie die Arbeit verrichtete und beim nächsten Besuch in Yaoundé ablieferte. Das dauerte mehrere Monate und wurde recht gut bezahlt.
Anschließend beauftragte die GTZ sie damit, ein modernes Organisationssystem für den neuen Büroleiter umzusetzen. Es ging vor allem darum, das Ablagesystem zu überarbeiten, Ordner zu sortieren und neu zu beschriften. Das war zwar keine umwerfend spannende Arbeit, überbrückte aber die Zeit und brachte ebenfalls etwas Geld ein.
In der benachbarten Zentralafrikanischen Republik besaß die GTZ im Dzanga-Sangha Park eine Lodge, die noch in den Anfängen steckte. An diesem Projekt war der WWF ebenfalls beteiligt. Hier lag ein neuer und wesentlich anspruchsvollerer Auftrag für Nel. Sie sollte die ersten Touristen betreuen und die vorgeschlagenen Programme evaluieren. Die Gäste machten mit den einheimischen Pygmäen stundenlange Streifzüge durch den Urwald, beobachteten Tiere oder wohnten der Palmweingewinnung bei. Das absolute Highlight war eine eindrucksvolle Saline, wo der WWF eine große Aussichtsplattform für etwa zwanzig Personen eingerichtet hatte. Salinen sind durch ihre Mineral- und Salzvorkommen ein magischer Anziehungspunkt für Waldelefanten, Büffel, Bongos, Antilopen und unzählige Vögel, die man von der Plattform aus beobachten konnte. Dort arbeitete Nel einige Monate, empfand es als einen Traumjob. Sie verstand sich auch recht gut mit einem jungen Schweizer Ehepaar, das im National-park arbeitete.
Wenig später wurde die Lodge privatisiert und von einer deutschen Pächterin übernommen. Sie war allerdings selten vor Ort, sondern organisierte und dirigierte alles von der Hauptstadt Bangui aus. Deshalb brauchte sie einen Manager, der sich um Lodge und Gäste kümmerte.
„Können Sie das vorübergehend für die ersten vier bis fünf Wochen machen?” fragte sie Nel, „bis ich einen Einheimischen für den Posten finde? Auf die Dauer sind Sie mir nämlich zu teuer!“
„Diplomatie ist wohl nicht gerade ihre Stärke.” dachte sich Nel bei dieser Bemerkung.
Die Schwierigkeiten fingen an. Nel hatte fast keinen Spielraum mehr. Für alles musste sie bei der neuen Pächterin die Bewilligung einholen. Das Essen wurde in Bangui vorgekocht, eingefroren und per Flugzeug geschickt. Gut war es auch nicht, und der ansässige Koch war sauer. Kreativität wurde nicht mehr gefragt. Speisen aufwärmen war nicht sein Ding.
Einmal in der Woche wollte die Chefin alle Einzelheiten mit Nel per Funk regeln, aber Nel bekam dann immer nur ihren Assistenten an die Strippe.
Sie stritten sich wegen aller möglichen Kleinigkeiten. Dann wurde Nel auch noch Geld aus der Kasse gestohlen, als sie einmal dringend nach draußen gerufen wurde und das Büro abzuschließen vergaß.
„Na gut, das ziehe ich Ihnen einfach von Ihrem Gehalt ab!” meinte die Chefin aus der Hauptstadt kaltblütig.
Die ständigen Reibereien und Ärgernisse mit dieser Frau führten schließlich dazu, daß Nel den Job auf-gab. Sie kündigte und fuhr wieder zurück nach Yoka-douma.
Ihre Schweizer Freunde brachten sie bis zur Grenzstation. Dort musste sie eine Piroge nehmen, die sie in einer Stunde ans andere Flussufer übersetzte. Für die Zollbeamten hatte sie einen Kasten Bier dabei. Der beschleunigte die Formalitäten.
Im nächsten Ort fragte sie bei den ansässigen Holzfirmen nach, ob sie in einem ihrer Lastwagen bis Yokadouma mitfahren könne. Das wurde dann für den nächsten Tag organisiert.
Inzwischen war ihr hundselend zumute, sie fühlte sich schwach und hatte Kopf- und Gliederschmerzen. Schweißausbrüche wurden von Schüttelfrost abgelöst.
Dazu kam hohes Fieber. Malaria.
Sie hatte schon vorher Malaria gehabt und wusste, daß es auch diesmal vorübergehen würde.
Zu Hause angekommen, kurierte sie sich erst einmal aus. Und dann musste sie feststellen, daß Olaf sie betrog....