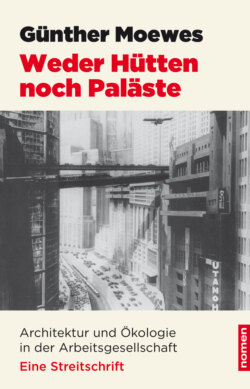Читать книгу Weder Hütten noch Paläste - Günther Moewes - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sonnennutzung und Sonnenschutz
ОглавлениеNach den zu kleinen Volumina entstand hier der zweite große Fehler in der jüngeren Entwicklung vermeintlich energiesparender Architektur: man sucht das Heil zu sehr in technischen Zusatzeinrichtungen und unterschätzt die Bedeutung der entwurflichen Möglichkeiten. Auch das gilt wiederum in erster Linie für die Frage der Volumengröße der Gebäude. Es gilt aber auch und vor allem für die zweite wichtige Maßnahme, mit der sich Energieeinsparungen bei Gebäuden erzielen lassen: die sogenannte passive Solarnutzung. Während Dämmung und geringer Außenwandanteil der Verlustminimierung dienen, ist Solarnutzung eine Form der Energiegewinnung.
Ihr ist vor allem die konventionelle Architekturästhetik im Wege. Denn passive Solarnutzung führt in erster Linie zu einer Südpräferenz der Gebäude, zu einer extrem unterschiedlichen Ausbildung der Nord- und Südfassaden und zu einer ungewohnten und unsymmetrischen Ausbildung des Sonnenschutzes. Daraus folgt aber, dass nahezu die gesamte visuelle Mimik der bisherigen Architektur überwunden werden muss, weitgehend auch die des sogenannten »ökologischen Bauens«.
Die einfachste und billigste Art der passiven Solarnutzung ist immer noch das möglichst große Südfenster. Es soll die Sonneneinstrahlung in der Übergangszeit und im Winter direkt in den Nutzungsbereich führen. Dazu ist es zwingend notwendig, die unerwünschte Sommersonne durch einen genau bemessenen und angeordneten Sonnenschutz abzuhalten. Dieser zugehörige horizontale Sonnenschutz darf nicht direkt an der Oberkante des Fensters sitzen, sondern muss um so viel höher installiert werden, dass seine Schattenkante von Oktober bis April mit der Oberkante des Fensters zusammenfällt. Andernfalls entsteht einer der häufigsten Fehler konventioneller Architektur: es wird teures und schlecht dämmendes Glas angeordnet, das dann aber durch den ebenfalls aufwendigen Sonnenschutz auch im Winter verschattet wird (Abb. 5 u. 11).
Ein funktionierender Sonnenschutz ist also integraler Bestandteil des Wärmehaushalts aller Architekturen, insbesondere aber bei passiver Solarnutzung. Sonnenschutz ist Bestandteil der Ökologie von Gebäuden.
Nun gibt es ästhetische Zielvorstellungen, die viele Architekten bewegen, den Sonnenschutz zu umgehen. Es ist dies vor allem die ästhetische Vorstellung von der Architektur als Kristall, von transparenten und glänzenden Glasflächen, die das Licht und die Umgebung reflektieren. Solche Vorstellungen gehen vor allem auf die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts zurück, auf Pilot-Projekte wie Mies van der Rohes gläsernen Wolkenkratzer oder Bruno Tauts Glashaus. Solche Vorstellungen verheißen auch heute noch Modernität.
Das Fehlen von Sonnenschutz erzeugt jedoch eine unerwünschte passive Solarnutzung an heißen Sommertagen und zwingt zu aufwendigen Ersatzmaßnahmen: Das sind entweder Vorschalträume mit höheren zulässigen Temperaturen, die deshalb nicht für dauerndes Wohnen und dauernden Aufenthalt geeignet sind. Hierzu zählen vor allem Wintergärten. Oder aber es muss für einen permanenten Abtransport der überschüssigen Einstrahlungshitze im Sommer gesorgt werden, sei es durch mechanische Entlüftung oder passive Zirkulation. Der Verzicht auf funktionierenden Sonnenschutz ist also in der Regel aufwendiger als seine Installation. Dies sollte dem Bauherrn ehrlicherweise gesagt werden. Fehlentwicklungen auf diesem Gebiet hängen vor allem mit der Branchenstruktur zusammen: es gibt eine etablierte Glasindustrie, eine Wintergartenindustrie und eine Industrie für »Structural Glazing«, aber keine etablierte Industrie für Sonnenschutz.
Nur wenn sich kein entsprechender Sonnenschutz anordnen lässt, kann eine sogenannte »Pufferzone« eingerichtet werden, in die die Sonne dann auch im Sommer einstrahlen kann. Pufferzonen sind Vorschalträume, die vom eigentlichen Nutzungsbereich durch eine zweite Glaswand getrennt sind. In Pufferzonen darf deshalb eine höhere Temperatur entstehen, als im Nutzungsbereich erträglich wäre. Durch die Sonne lassen sich Speicher aufheizen (Fußboden, Brüstung o. ä.). Es entsteht eine sogenannte Wärmefalle: das Glas lässt das Sonnenlicht leichter herein, die von den Speichern reflektierte Wärmestrahlung aber nicht so leicht wieder heraus.
Aus den Wintergärten wird die von der Sonne erwärmte Luft durch mechanische Lüftung oder natürliche Zirkulation in die Wohnräume geleitet. Sie können mit Sonnenschutz versehen, notfalls aber auch ohne Sonnenschutz errichtet werden, wenn eine zeitweise höhere Sommertemperatur in Kauf genommen wird. Sie verbessern durch die zweite Glaswand auch den Kälteschutz (K-Wert), ähnlich wie dies Doppelfenster tun. Der Versuch, im Sommer und Winter durchgehend Wohntemperatur aufrecht zu erhalten, würde Wintergärten jedoch zu Energieschleudern machen.
Es muss unterschieden werden zwischen eingebauten und angebauten Wintergärten. Eingebaute sind einfach große Südfenster mit einer zweiten Glaswand hinter der Pufferzone. Angebaute Wintergärten haben in der Regel fünf Verlustflächen, wo der eingebaute nur eine hat. Der Verlust dieser Fläche kann überdies durch einen sogenannten temporären Wärmeschutz (z. B. gedämmte Klappläden) mit wenig Aufwand noch vermindert werden, zumal der eingebaute Wintergarten nur eine vertikale Außenhaut hat.
Im Gegensatz zu solchen eingebauten Wintergärten amortisieren sich angebaute Wintergärten bei den heutigen Energiepreisen nicht. Enthalten sie frostempfindliche Pflanzen, ist ihre Kostenbilanz noch negativer. Untersuchungen im Auftrag des BMFT am Berliner Demonstrationsbauvorhaben Woltmannweg ergaben 25 % Einsparung für den Wohnraum, d. h. 9 % für das ganze Haus.
Auch Schrägverglasungen sind unsinnig, weil sie nur die unerwünschte steile Sommereinstrahlung im Fußbodenbereich vergrößern. Bei Horizontalverglasungen beträgt die Sommereinstrahlung das zwanzigfache der Wintereinstrahlung. Horizontal- und Schrägverglasungen steigern also die Sommereinstrahlung und den Sommer-Winter-Gegensatz, Vertikalverglasungen verringern sie.
Durchgehende vertikale Südverglasungen mit wirksamem Sommer-Sonnenschutz und temporärem Wärmeschutz stellen die derzeit wirksamste und wirtschaftlichste Form der passiven Solarnutzung dar. Sie sind in der Übergangszeit auch bei bedecktem Himmel überaus wirksam. Insgesamt können durch rein entwurfliche Maßnahmen bis zu 70 % der Heizenergie konventioneller Bauten eingespart werden.
Auch geometrische Sonderformen von Grundrissen bringen keine Verbesserungen, also etwa Süd-Hufeisen. Die tägliche Einstrahlungssumme ist lediglich vom Silhouettenintegral der Einstrahlung abhängig, nicht aber von der Form. Eine Krümmung erhöht zwar bei flachem Einstrahlungswinkel die auftreffende Energiemenge auf der sonnenzugewandten Seite. In genau gleichem Maße wird die Einstrahlungsmenge jedoch auf der abgewandten Seite verringert. Die Erbauer des Freiburger Ökohauses haben durch Computer-Modellrechnungen ermittelt, dass eine leichte Krümmung der Südseite eine um 7 % höhere Einstrahlungsausbeute ergibt. Die Erklärung dieses Phänomens wird wohl auf ewig ein Geheimnis der Physiker bleiben. Ganz abgesehen von der Frage, wann 7 % Einsparung bei dem geringen Restenergiebedarf den Mehraufwand an Konstruktion amortisieren.