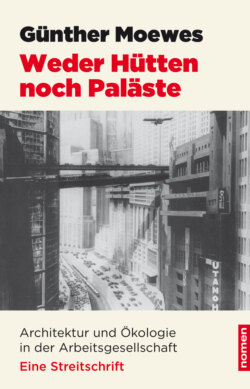Читать книгу Weder Hütten noch Paläste - Günther Moewes - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Traum vom Glaskristall
ОглавлениеEine besondere Rolle bei vermeintlich progressiver Architektur spielen »Ganzumglasungen«. Angefangen hat damit Bengt Warne mit seinem berühmt gewordenen »Naturhuset«: Das ganze Haus wird sozusagen in einen Wintergarten eingebaut, in der Hoffnung, sowohl maximale passive Solarnutzung als auch einen ausreichenden Kälteschutz zu erzielen. Gleichzeitig kommt die Transparenz der Vorstellung vom Wohnen in der Natur entgegen, die allerdings extrem anti-ökologisch ist. Insbesondere Einfamilienhäuser mit Ganzumglasung sind auch wohl kaum auf größere Bevölkerungsteile übertragbar und dürften in die Baugeschichte wohl nur als kostbare Irrwege aus der ökologischen Experimentierphase eingehen.
Schwieriger zu beurteilen sind die energetischen Zukunftsaussichten der Ganzglasfassaden von Hochhäusern. Auch hier muss der fehlende Sonnenschutz durch aufwendigen Abtransport der überschüssigen Einstrahlungsenergie ersetzt werden. Auch hier wird gleichzeitig versucht, durch Doppelfassaden mit Pufferzonen den Kälteschutz zu verbessern. Auch hier sind derartige Konstruktionen bei den heutigen Energiepreisen niemals wirtschaftlich. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei Hochhäusern auch ein funktionierender Sonnenschutz nicht unproblematisch ist. Die hohen Windgeschwindigkeiten insbesondere der Aufwinde erzeugen zum einen Geräusche. Sie machen es zum anderen erforderlich, den Sonnenschutz so massiv auszubilden, dass eine Befestigung außerhalb der Wärmehaut nur schwer möglich ist. Schließlich wird auch die Außenreinigung der Fassade erschwert, da es nicht zuletzt wegen der Windgeschwindigkeiten problematisch ist, die Fenster mit Öffnungsflügeln zu versehen. Gleichwohl muss es möglich sein, auch Hochhäuser mit funktionierendem Sonnenschutz zu bauen.
Derzeit machen jedoch die Ganzglasfassaden mindestens ebenso große Probleme. Die abzutransportierende Einstrahlungsmenge im Sommer ist gigantisch. Unabhängig von den Energiepreisen muss bezweifelt werden, dass sich die immense Herstellungsenergie des Glases jemals in einem Zeitraum amortisiert, der ökologisch genannt werden kann. Im Grunde kann von ökologischen Glasfassaden erst gesprochen werden, wenn das Glas nicht mehr mit fossilen Energien hergestellt werden muss. Hinzu kommen gesundheitliche Probleme: eine bloße Entlüftung führt selbst bei Einsatz von Wärmetauschern zu Energieverlusten. Die Wiederverwendung der Abluft führt dagegen zu den bekannten »sick-building« Problemen (»Befeuchterlunge« etc.).
Gleichwohl sind die Experimente von Norman Foster, Rogers und Future Systems auf diesem Gebiet außerordentlich spannend. In einem Klappentext zu dem Buch »Future Systems« heißt es: »Sie versuchen auf spektakuläre, visuell frappierende Art und Weise … den Zeitgeist des neuen Jahrzehnts einzufangen.« Mag ja sein. Die spannenden Fragen lauten aber: Wird es jemals eine Ganzglasfassade ohne Sonnenschutz geben, die ökologisch genannt werden kann? Und: Wird es jemals Hochhäuser geben, die ökologisch genannt werden können?
In gewissem Umfang wird diese Frage auch von der technischen Entwicklung neuer Glaseigenschaften abhängig sein. Durch einseitige Bedampfung des Glases hofft man, den Wärmefalleneffekt zu steigern. Eine große Bedeutung könnte die »Lichtlenkung« bekommen, wenn sie eines Tages wirtschaftlich zu bewerkstelligen ist. Dabei wird das Licht durch Spiegel, Spiegellamellen, »Sonnenschaufeln« oder Hologrammgläser in die tieferen Zonen der Räume und Gebäude gelenkt, nicht nur auf der Südseite, sondern auch im Osten, Westen und Norden. Dies verbessert physiologisch und psychologisch die Tagesbelichtung und erlaubt größere, energetisch günstigere Gebäudetiefen. Dabei darf das Licht nur durch die Oberlichtzonen, also oberhalb der menschlichen Augenhöhe an die Decke gelenkt werden, um Blendwirkungen zu vermeiden. Der Preis für Hologrammgläser liegt allerdings derzeit noch bei 3000,00 DM/m2. Aber so hat ja die Photovoltaik auch einmal angefangen.
Sehr aussichtsreich ist die Entwicklung sogenannter transluzenter Wärmedämmung (TWD). Das ist eine undurchsichtige, aber lichtdurchlässige Wärmedämmung, die auch bei geschlossenen Außenwänden eine passive Solarnutzung erlaubt. Bisher wurde eine solche passive Solarnutzung bei gedämmten Wänden durch die außenliegende Dämmung völlig verhindert. Bei ungedämmten Wänden war zwar eine passive Solarnutzung gegeben. Dafür waren aber die Nacht- und Heizwärmeverluste zu groß. Und selbst von der passiv gewonnenen Energie wurde die Hälfte sofort wieder nach außen abgegeben. Derzeit ist TWD noch nicht wirtschaftlich herstellbar und es bestehen noch Probleme infolge der hohen Temperaturspannungen und der Taupunkt- und Atmungseigenschaften. Wären diese zu lösen, wäre TWD vor allem ein ideales Mittel bei der Altbausanierung, da ja dort die Südfassaden nicht nachträglich mit größeren Fenstern versehen werden können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auch in unseren Breiten die Verglasung der gesamten Südfläche zur passiven Solarnutzung eher schon zu viel des Guten ist. Bei richtigem Einsatz der Maßnahmen kann die Brüstungszone ohne weiteres massiv ausgebildet werden.