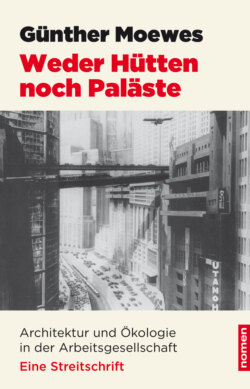Читать книгу Weder Hütten noch Paläste - Günther Moewes - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Neubauten sparen niemals Energie
ОглавлениеEnergie kann niemals mit Neubauten, sondern nur mit Altbauten oder reinen Ersatzbauten eingespart werden. Auch Energiesparhäuser sparen keine Energie, sondern verringern nur den Mehrverbrauch. Die gesamte visuelle Mimik der meisten herkömmlichen Architektur und des sogenannten »ökologischen Bauens« ist in energetischer Hinsicht weitgehend falsch.
Das Bauwesen ist die Branche, die die größte Energie-Entropie erzeugt: In Deutschland werden 50 % aller Endenergie im Bauwesen verbraucht. (Im gesamten Verkehr, einschließlich Flug- und Schiffsverkehr werden nur 11 % verbraucht; das große Problem beim Verkehr sind freilich die Schadstoffe.) Diese verbrauchte Energie kann niemals zurückgewonnen werden. Sie wird zum größten Teil durch fossile Brennstoffe erzeugt. Dabei ist nicht so sehr der Sauerstoffverbrauch problematisch: Selbst bei Verbrauch aller fossilen Energieträger würde der Sauerstoffverbrauch unter 1 % des Weltvorrats bleiben. Problematisch ist die CO2-Erzeugung: Der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist seit 1800 um 36 % gestiegen. Die Folgen für das Weltklima sind nicht abzuschätzen. Die Hälfte dieses CO2-Ausstoßes wurde und wird von Bauten erzeugt.
Da es prinzipiell unmöglich ist, den heutigen Umfang des Energie-Verbrauchs durch Solar-Energie oder andere alternative Energien zu ersetzen, steht und fällt unsere Zukunft mit der Fähigkeit zur Energie-Einsparung. Die Enquete-Kommission (Lit.) fordert deshalb eine Einsparung im Gebäudebereich von 70–90 %. Die neue Wärmeschutzverordnung zielt auf eine Halbierung des Heizaufwandes bei Neubauten und Umnutzungen ab 1995 ab.
Die gesamte Energiepolitik in der Bundesrepublik der letzten Jahrzehnte war falsch. Im Laufe der Jahre wurden allein in den alten Bundesländern 100 Mrd. DM aus Subventionen in den Bergbau gepumpt und 40 Mrd. Entwicklungskosten allein vom Bund in die Kernkraft. Rechnet man die Kosten der Länder und die Baukosten für 185 Kraftwerke seit 1975 (davon 18 Kernkraftwerke), sowie die Kosten für Kalkar, für Stilllegungen und die nicht funktionierende Entsorgung, so kommt man auf eine unvorstellbare Summe von 200 bis 250 Mrd. DM ohne Betriebskosten. Nicht auszudenken, wie unsere Energielandschaft aussähe, wenn diese Summe sukzessive in bauliche Einsparungsmaßnahmen und alternative Energien gesteckt worden wäre. An der Kerntechnik hängt inzwischen eine Lobby von 30 000 Beschäftigten mit einer überdurchschnittlichen Qualifikationsstruktur. Nicht auszudenken, wenn sich diese Lobby auf Einsparungsmaßnahmen konzentriert hätte. Infolge des Nachlaufeffekts wird die Hauptwirkung dieser falschen Politik erst in den nächsten Jahrzehnten von den nachfolgenden Generationen verkraftet werden müssen.
Bauten verbrauchen etwa 50 % der gesamten Endenergie. Für den Stromanteil dieser Endenergie kommt noch einmal das zweifache an Primärenergie hinzu: die Produktions- und Transportverluste vor allem der Großkraftwerke. Bauten verbrauchen also weit über die Hälfte der Primärenergie. Ein erhebliches Einsparungspotential im Bauwesen steckt also bereits im Versorgungsbereich: Kleinkraftwerke statt Großkraftwerke, Kraft-Wärme-Kopplung, Block-Heizkraftwerke usw.
Energieeinsparung mit Neubauten ist grundsätzlich nicht möglich. Alle Neubauten erhöhen das Bauvolumen und damit den Energiebedarf, auch Niedrigenergie- und Passivhäuser. Gesenkt werden kann der Energiebedarf grundsätzlich nur durch Vermeidung von Neubauten und durch Maßnahmen bei Altbauten oder reinen Ersatzbauten. Auch die neue Wärmeschutzverordnung wird deshalb nicht zu einer Senkung des Energiebedarfs führen, sondern nur zu einer Drosselung des Mehrbedarfs. Sie wird ja nur teilweise und schrittweise auf Altbauten angewendet. Zur Einlösung des Versprechens von Rio trägt sie nichts bei. Der Begriff »Energiesparhaus« ist deshalb unglücklich. Von »Niedrigenergiehäusern« spricht man, wenn der Energiebedarf weniger als 50 % des heutigen Standards beträgt.
Die tatsächliche Bedeutung der Entwürfe für energiegünstige Architekturen wird dadurch stark relativiert. Selbst Null-Energie-Häuser – wenn es die denn wirtschaftlich gäbe – trügen nichts zur Energie-Einsparung bei, würden die Katastrophen nicht im Mindesten mildern, die über die folgenden Generationen hereinzubrechen drohen. Sofern es rationale Anstrengungen mit dem Ziel energiegünstigerer Architektur überhaupt gibt, werden deren Auswirkungen sich frühestens bei den übernächsten Generationen bemerkbar machen. Diese Erkenntnis darf natürlich nicht dazu führen, die Anstrengungen zu verringern oder gar einzustellen. Im Gegenteil: sie verdeutlicht ihre Dringlichkeit.
Obgleich die Probleme seit Jahrzehnten bekannt sind, war die neuere Architektur auf kaum einem Gebiet so falsch wie auf dem energetischen. Falsch war nicht nur die konventionelle Architektur, die sich um die Probleme wenig kümmerte. Falsch war die Architektur auch meist da, wo sie ausdrücklich etwas für die Verbesserung der Energiebilanz tun wollte: Auch das sogenannte »ökologische Bauen« war im Hinblick auf den Energie-Aspekt zumeist Vorspiegelung falscher Tatsachen. Wie sollte es auch anders sein: Wie soll aus einer falschen Energie- Politik eine gute Architektur entstehen?
Ein Hauptfehler war hier die Unterschätzung der Bedeutung des Außenwandanteils, des sogenannten A/V-Verhältnisses (Außenwand/Volumen). Dieses A/V-Verhältnis ist in erster Linie abhängig von der absoluten Größe eines Gebäudes. An ihm lassen sich fast unmittelbar die Heizkosten ablesen. Bei einem idealen, frei schwebenden Würfel gilt etwa: doppelte Kantenlänge = doppelt so gutes A/V-Verhältnis = halb so große Heizkosten, 10-fache Kantenlänge = 10-fach geringere Heizkosten (Abb. 2). Die Einberechnung der weniger verlustreichen Bodenfläche von Gebäuden verschiebt diese Gesetzmäßigkeit nur geringfügig.
Großvolumige Gebäude sind also energetisch immer erheblich günstiger als kleinvolumige. Oder umgekehrt formuliert: Das freistehende Einfamilienhaus ist in jedem Fall die energetisch ungünstigste Gebäudeart.
Bei Geschossbauten ist die Tendenz zu großen Volumina durch die maximalen Belichtungstiefen begrenzt. Ab vier Geschossen lassen sich keine würfelförmigen Baukörper mehr bilden. Gebäude werden mehr und mehr zur Scheibe. Gleichwohl gilt: je höher und länger die Scheibe, desto geringer der Transmissionsverlust pro m3. 64 Wohneinheiten in 64 freistehenden Einfamilienhäusern verbrauchen dreimal so viel Energie wie die gleichen 64 Wohneinheiten in einem einzigen Geschossbau (Abb. 3). Dabei erzielt die Form der viergeschossigen Blockrandbebauung etwa gleich gute Werte wie eine 16-geschossige Hochhausscheibe. Da die Hochhausscheibe von der Wohnqualität her problematisch ist, stellt die Blockrandbebauung eine energiepolitisch optimale Bauform dar. Ihre Energiebilanz kann noch gesteigert werden durch Innenhofüberglasungen (Abb. 4).
Gegenüber der absoluten Größe eines Gebäudes ist die Geometrie seiner Form fast ohne Bedeutung. Geometrische Sonderformen verbessern das A/V-Verhältnis nur unwesentlich. Nicht auszurotten sind die völlig unsinnigen Halbkugelhäuser (Abb. 6 bis 10). Ihr A/V-Verhältnis verbessert sich bei gleicher Grundfläche gegenüber dem Halbwürfel um 7 %, bei gleichem Volumen um 15,4 %. Diese Rechnung geht jedoch völlig am Problem vorbei: Denn in der Regel können Halbkugelhäuser mit einer vertretbaren Belichtung und Gebäudetiefe wieder nur die energetisch ungünstigen Einfamilienhäuser sein. Denn bei energetisch günstigeren Geschoßbauten entstünden zu große Dunkelzonen im Innern. Die energetische Bedeutung der absoluten Gebäudegröße zwingt zu einem Umdenken auch im städtebaulichen Bereich. Die Vorstellung von der dezentralisierten, »aufgelockerten«, flächenintensiven Gartenstadt aus freistehenden, begrünten Einfamilienhäuschen ist in mehrfacher Hinsicht antiökologisch. Sie ist energetisch falsch, nicht nur im Hinblick auf die zu hohen Transmissionsverluste infolge des zu hohen Außenwandanteils, sondern auch im Hinblick auf Versorgungsgesichtspunkte, Transportverluste oder etwaige Kraft-Wärme-Kopplung. Sie ist auch falsch hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Verkehrserzeugung, Infrastrukturaufwand und Landschaftsverbrauch (vgl. Kapitel »Die Ursachen der Flächenvergeudung«). Dezentralisiert werden müssen Produktionen und Ballungsgebiete, nicht die Quartiere.
Das freistehende Einfamilienhaus ist aber auch aus Gründen des Landschaftsschutzes nicht mehr zu verantworten. Das bedeutet nicht die Aufgabe des Einfamilienhausgedankens. Es bedeutet nur die Entwicklung intelligenterer Kombinationsformen und -typen, also Stadthäuser, differenzierte Reihenhäuser etc. Es bedeutet aber auch fließendere Übergänge zu Geschosswohnungsbau und Etageneigentum. Es bedeutet einen höheren Einfamilienhaus-Charakter von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, insbesondere in Erdgeschoss- und Dachzonen. In diesen Bereichen stecken große, ungenutzte Entwurfsreserven.