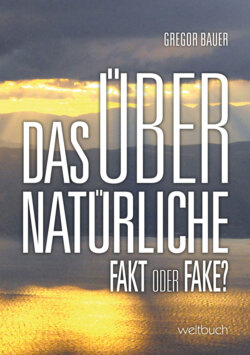Читать книгу Das Übernatürliche - Gregor Bauer - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Was hat die Religion zu ihrer Verteidigung vorzutragen?
ОглавлениеZurück zu den Naturphilosophen der griechischen Antike: Haben sie wirklich die Religion verworfen, um die Welt aus rein natürlichen Ursachen zu erklären?
Im Grunde lässt sich das von keinem einzigen der Vorsokratiker behaupten:
•Thales, der früheste unter den ionischen Revolutionären, bekannte, dass alles erfüllt von Göttern sei.
•Anaximander – der mit den platzenden Druckluftwolken – sah in der Natur ein religiöses Grundgesetz am Werk: das nicht menschengemachte moralische Prinzip von Schuld und Sühne.
•Xenophanes (ca. 570–475) attackierte zwar die überlieferten Götter, bekannte sich aber zum Glauben an eine unveränderliche Gottheit.
•Pythagoras (ca. 570 bis nach 510) galt als der Begründer einer zahlenmystischen Heilslehre.
•Heraklit (ca. 544–484) lehrte einen Gott, der „sich wandelt wie das Feuer“.
•Parmenides (ca. 540–470) glaubte, hinter den trügerischen Sinnestäuschungen das ewige Sein zu erkennen.
•Empedokles (*ca. 494) sah in Liebe und Hass elementare Kräfte des Weltalls und lehrte die Seelenwanderung.
•Demokrit, angeblich ein Materialist, lehrte, dass die Menschen alles Gute den Göttern verdankten, während sie das Schlechte sich selbst zuzuschreiben hätten.
•Anaxagoras hielt den Geist nicht – wie heutige Naturalisten – für ein spätes Nebenprodukt komplexer Materie, sondern für ewig: „Alles hat der Geist angeordnet, wie es werden sollte, war und ist“.
Grundsätzlich skeptisch gegenüber der Religion waren wohl erst die Sophisten (ca. 450 bis ca. 380 v. Chr.), eine Gruppe pragmatischer Gebildeter, die nützliche Kenntnisse gegen Geld weitergaben. Doch auch sie haben die Existenz der Götter nicht ausgeschlossen.
Ihr Zeitgenosse Sokrates (469–399) war zwar berüchtigt für seine Methode, alles zu hinterfragen und in Zweifel zu ziehen, auch das Weiterleben nach dem Tod. Dennoch bekannte er sich bis zuletzt zum Glauben an die Götter. Und Epikur (um 341 bis 271 oder 270) glaubte zwar nicht an ein Leben nach dem Tod, aber eben doch an Götter – die sich freilich für die Schicksale der Menschen nicht interessieren.
Aber warum erwähnen wir das hier überhaupt? Versteht es sich nicht von selbst, dass die Philosophen der Antike keine Atheisten waren? Damals war nun mal der Glaube an Götter so selbstverständlich wie heute das Vertrauen in die Wissenschaften. Kann uns das nicht egal sein? Der religiöse Glaube der Naturphilosophen ist heute überholt. Worauf es ankommt, ist das Neue: die Beiträge, die sie zu einer wissenschaftlichen Welterklärung geleistet haben, die ohne Götter auskommt.
Stimmt das? Oder steckt auch in dem Teil des antiken Erbes, den wir als vorwissenschaftlich abtun, ein Schatz, der uns verloren gegangen ist und den es wieder zu finden gilt?
Warum eigentlich sollten wir nicht nach den Erfahrungen fragen, auf denen die religiöse Zuversicht der Menschen in früheren Zeiten gründete? Denn so erfolgreich moderne Naturwissenschaft und Technik auch sind: Vielleicht ist es ja gerade ihr Erfolg, der sie so sehr berauscht, dass sie die Defizite ihres Welt- und Menschenbildes gar nicht mehr wahrnehmen können?
Doch zurück zum Glauben der alten Griechen: Sokrates und Platon haben gegen die sophistische Skepsis für religiöse Überzeugungen Position bezogen. Und Aristoteles glaubte zwar nicht an ein Weiterleben der Seele nach dem Tod, aber doch an einen Gott, den „unbewegten Beweger“.
Was die Kirche in ihren Anfängen angeht: Sicherlich hat ihre religiöse Borniertheit dazu beigetragen, dass das Mittelalter hinter den hellenistischen Stand des Wissens zurückfiel. Doch gab es dafür auch andere Gründe, wie auch Jaeger betont. Insbesondere haben sich die Römer bereits vor der Christianisierung wenig für die abstrakten Naturkenntnisse der hellenistischen Gelehrten interessiert. Worauf sie aus waren, das war der praktische Nutzen, sei er wirtschaftlich, verwaltungstechnisch oder militärisch. Wo der nicht zu erkennen war, gerieten die überlieferten Erkenntnisse in Vergessenheit. Die Römer zerschlugen die hellenistischen Zentren und versklavten große Teile der dortigen griechischen Bevölkerung, lange bevor die Christen an Einfluss gewannen.
Zugegeben: Im Mittelalter hat die strenge Religion den wissenschaftlichen Fortschritt gebremst. Aber es gab auch damals schon Geister, die die Vernunft betonten: die Vertreter der Scholastik, einer streng rationalen, vor allem an Beweisführungen interessierten Denkweise. Auch sie waren religiös, wie Anselm von Canterbury (ca. 1033–1109) und Petrus Abaelardus (1079–1142) sowie später Thomas von Aquin (1225–1274) und sein Lehrer Albertus Magnus (1200–1280), zwei Wegbereiter der modernen Naturwissenschaft.
Als die Scholastik schließlich wegen ihrer fehlenden empirischen Grundlagen und ihrer extremen Theorielastigkeit kritisiert wurde, geschah dies durch einen Franziskanermönch, der sich sehr für Mystik begeisterte: Roger Bacon (1214–1292).
Und was ist mit dem Verfall der arabischen Wissenschaft seit dem 13. Jahrhundert, Folge der rigorosen Strenggläubigkeit der islamischen Ash’ari-Schule? Auch hier sind andere Gründe zumindest mitverantwortlich, die auch Jaeger nicht verschweigt: Vorangegangen waren verheerende Kreuzzüge sowie die Zerstörung Bagdads durch die Mongolen im Jahr 1257. Seit der Entdeckung Amerikas Ende des 15. Jahrhunderts verschaffte sich zudem Westeuropa durch die Ausbeutung des neuen Kontinents wirtschaftliche Vorteile, an denen die islamische Welt nicht teilhatte.
Fromme spätmittelalterliche Theologen waren es, die mit ihren scharfsinnigen Überlegungen den Weg bereiteten für die Einsicht, „dass Gott rational nicht greifbar, dass er nicht in der Art einer logischen Ableitung ‚beweisbar‘ ist“ (von Ditfurth 1982, Seite 193). Ihrer Vorarbeit verdanken wir, dass die Naturwissenschaft sich schließlich von der Theologie lösen und selbstständig forschen konnte.
Im 16. und 17. Jahrhundert hatten die Naturwissenschaftler diese Trennung vollzogen. Sie untersuchten alles, was sich wiegen und messen lässt, experimentell, ohne sich darum zu kümmern, was die Kirche lehrt und was in der Bibel steht. Das bedeutet aber nicht, dass sie alle Bereiche der Wirklichkeit für messbar hielten: Sie unterschieden zwischen der naturwissenschaftlich erfassbaren Welt und der Dimension des Transzendenten, die sie der Kirche und den Theologen überließen.
So sahen das auch die vier Begründer des physikalischen Weltbilds, das bis ins 20. Jahrhundert gültig blieb. Sie wollten keineswegs dem Atheismus den Weg bereiten, der sich heute auf sie beruft. Denn alle vier waren eifrige Christen:
•Kopernikus war Domherr, Doktor des Kirchenrechts und fasziniert von neuplatonischen Spekulationen über die Sonne als materielles Abbild Gottes.
•Kepler war evangelischer Theologe.
•Galilei stand über viele Jahre mit führenden Vertretern der katholischen Kirche in regem Austausch.
•Isaac Newton (1643–1727) beschäftigte sich intensiv mit der Bibel und den Kirchenvätern.
Mit der Zeit stellten die Naturwissenschaftler fest, dass ihre Methoden überwältigend erfolgreich waren. Auf der anderen Seite schafften es die Theologen nicht, über die transzendente Welt irgendwelche beweisbaren Ergebnisse zu erzielen. War also nicht doch die Erklärung von allem, was es gibt, bei den Naturwissenschaftlern am besten aufgehoben?
Früher hatte man übernatürliche Erklärungen für physikalische Phänomene nur aus methodischen Gründen ausgeschlossen: Man wollte ausprobieren, wie weit man mit einer rein natürlichen Erklärung der Welt kommen würde. Doch je besser das klappte, desto mehr Wissenschaftler fragten sich, warum sie überhaupt noch an das Übernatürliche glauben sollten.
So wurde auch Darwin im 19. Jahrhundert in seinem religiösen Glauben durch seine naturwissenschaftliche Beschäftigung stark verunsichert. Er konnte sich keinen freundlichen Schöpfergott vorstellen, der Wesen erschaffen würde wie die parasitären Wespen: Diese lähmen andere Insekten und legen ihre Eier in ihnen ab. Die paralysierten Tiere werden dann von den Wespenlarven aufgefressen, von innen heraus, langsam, bei lebendigem Leib. Solche Monstren sollte dieser Gott erschaffen haben?
Darwin kannte noch viele andere Beispiele für die Grausamkeit der Natur. Auch Schicksalsschläge hatten an der Erschütterung seines Glaubens Anteil, besonders der Tod seiner zehnjährigen Lieblingstocher Annie (1851). Ein entschiedener Atheist war Darwin dennoch nicht. In seinen späten Jahren hat er sich als Agnostiker bezeichnet.
Zugegeben also: Es gibt in den Naturwissenschaften eine historische Entwicklung weg vom Glauben. Aber diese Entwicklung ergriff längst nicht alle Naturwissenschaftler. Gegen diesen Trend stellte sich beispielsweise der Naturforscher, der beinahe zeitgleich mit Darwin eine ganz ähnliche Theorie der Evolution durch natürliche Selektion entwickelt hatte: Alfred Russel Wallace (1823–1913).
Wallace hatte auf seinen Forschungsreisen südostasiatische Stammesgesellschaften kennen gelernt. Dabei fiel ihm auf, dass die Menschen in seiner Heimat England roher und weniger mitfühlend waren. Ob es daran lag, dass die neue, naturwissenschaftliche Weltsicht den Menschen mit ihrer Religion auch ihren moralischen Halt genommen hatte? War der Naturalismus also ungenügend?
Diese Sorge trieb Wallace um, als er 1865 zum ersten Mal an einer spiritistischen Sitzung teilnahm. Sehr zum Ärger Darwins entwickelte er die Überzeugung, dass die menschliche Seele nicht naturalistisch zu erklären sei, sondern einen übernatürlichen Ursprung habe, und vermutete hinter dem Universum einen göttlichen Plan.
An eine unsterbliche Seele glaubte also immerhin einer der beiden „Väter der Evolutionstheorie“. Und er war nicht der einzige, der damals schon die Evolutionstheorie mit der Religion für vereinbar hielt: Von Anfang an zählten zu Darwins Unterstützern auch etliche hochrangige Kleriker der anglikanischen Kirche.
Auch nach Wallace hatten keineswegs alle Vordenker der Naturwissenschaften ein naturalistisches Weltbild. Albert Einstein (1879–1955), der mit seiner Relativitätstheorie die Newtonsche Physik ablöste, glaubte zwar nicht an einen persönlichen Gott. Aber er hat offenbar doch eine höhere Intelligenz als Ursache des Universums angenommen. Und von den Pionieren der Quantentheorie glaubten etliche, dass das Bewusstsein der Materie vorausgehe.
Was einige der größten Physiker des 20. Jahrhunderts über Naturwissenschaft und Religion gedacht haben, lässt sich in dem Sammelband „Physik und Transzendenz“ von 1986 nachlesen. Herausgeber ist Hans-Peter Dürr (1929–2014), zeitweise der engste Mitarbeiter der Physiker-Legende Werner Heisenberg. Hier beispielhaft einige Stimmen:
•Max Planck (1858–1947), mit seinem „Planck‘schen Wirkungsquantum“ der Begründer der Quantenphysik, empört sich, dass „die Gottlosenbewegung […] sich mit Eifer die fortschreitende naturwissenschaftliche Erkenntnis zunutze macht und im angeblichen Bunde mit ihr in immer schnellerem Tempo ihre zersetzende Wirkung auf die Völker der Erde in allen ihren Schichten vorantreibt“ (Seite 23).
•James Jeans (1877–1946), für seine Beiträge zur Kosmogonie ausgezeichnet mit der Goldmedaille der Royal Astronomical Society of London, deutet den Stand der Wissenschaft im Jahr 1931 so: „Der Geist erscheint im Reich der Materie nicht mehr als ein zufälliger Eindringling; wir beginnen zu ahnen, dass wir ihn eher als den Schöpfer und Beherrscher des Reiches der Materie begrüßen sollten […]“ (Seite 64).
•Arthur Eddington (1882–1944), mehrfach von renommierten astronomischen Gesellschaften mit Preisen ausgezeichneter Astrophysiker, mahnt zur Bescheidenheit: Was die Physik zu bieten hat, ist „nicht die Realität selbst, sondern nur ihr Skelett“ (Seite 99). Würde ein Engel „die Erde mit Einsteins Augen sehen“, so würde er „das Wesentliche übersehen“ (Seite 127).
•Pascual Jordan (1902–1980), als theoretischer Physiker maßgeblich an der Entwicklung und mathematischen Formulierung der Quantenmechanik beteiligt, hebt hervor, dass „die Vorstellung, dass die Entzauberung der Welt durch die Naturwissenschaft ein unvermeidliches Ergebnis naturwissenschaftlicher Forschung sei, auf zeitgebundenem Irrtum beruht“. Die „materialistische Naturphilosophie“ sei heute „nicht mehr, wie ihre Anhänger gern in Anspruch nehmen, im Einklang mit naturwissenschaftlicher Erkenntnis“ (Seite 227).
Bis heute ist es keineswegs so, dass alle Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler naturalistisch dächten. Der Philosoph Thomas Nagel (*1937), ein atheistischer Kritiker des Neo-Darwinismus, bestreitet, dass heute unter Forscherinnen und Forschern der Naturalismus die vorherrschende Geisteshaltung sei. Nach allem, was er wisse, verträten sie dazu meist keine bestimmte Meinung (Nagel 2016, S. 12f). Nur unter denjenigen Naturwissenschaftlern, die sich überhaupt dazu äußerten, gelte der „reduktive Materialismus“ im Allgemeinen als „die einzige ernsthafte Möglichkeit“, so Nagel weiter. Aber auch unter ihnen findet man Offenheit für religiöse und spirituelle Auffassungen. Das gilt insbesonders zu Themen der Kosmologie und Quantenphysik, weniger für Evolutionsbiologie und Hirnforschung.
So weit Skizze 2. Vernachlässigen wir nun die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler, die der Religion neutral oder positiv gegenberstehen, und halten wir uns an die tonangebenden, die den naturalistischen Standpunkt vertreten. Nach ihnen sind Religionen überholte Systeme aus einer Zeit, in der die Menschen noch keine rationalen Erklärungen für die Rätsel der Welt hatten. Unsere Vorfahren haben sich fromme Geschichten ausgedacht, weil sie es nicht besser wussten. Heute sind wir weiter und müssen deshalb die Religionen hinter uns lassen. Was ergibt sich aus einer solchen Auffassung?