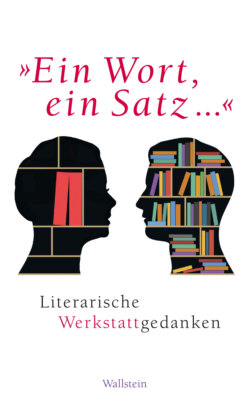Читать книгу "Ein Wort, ein Satz…" - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HEINRICH DETERING
Im Spiegel
ОглавлениеZwischen meinem ersten und meinem zweiten Gedichtband vergingen fünfundzwanzig Jahre. Die Veröffentlichung des Bändchens Zeichensprache im Jahr meines Abiturs gehörte zu einem kleinen Literaturpreis, den ich dank eines engagierten Deutschlehrers erhalten hatte. Nach diesem ermutigenden Anfang schrieb ich weiter Gedichte, veröffentlichte auch etwas in Zeitschriften und Anthologien. Aber es dauerte nur wenige Jahre bis zu der entmutigenden Ermahnung, dass so etwas den Berufsaussichten für akademische Literaturwissenschaftler sehr im Wege stehen werde. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz vom Schuster und den Leisten in diesen Studienjahren gehört habe – als wäre ich, gedichteschreibend, vom rechten akademischen Weg abgewichen und nicht vielmehr (wenn schon) im akademischen Umgang mit der Literatur vom lyrischen. Dass für mich beides zusammengehörte wie rechter und linker Fuß, empfand ich, aber ich konnte es nicht sagen. Ohne Vorsatz ergab es sich, dass ich meine Gedichte als Privatsache zu betrachten begann, als Teil einer Intimsphäre, die nur vertraute Menschen etwas anging.
Dass ein gleichaltriger Verleger – Literaturwissenschaftler wie ich, wir hatten uns in einem Hauptseminar über Lyrik-Rezensionen kennengelernt – eines Tages diese Gedichte las, professionell und produktiv kritisierte und veröffentlichen wollte, war der Anfang eines Comingout. Es entstand nicht so sehr aus den Worten als vielmehr aus den Objekten. Der Spiegel, vor dem ich zu sagen übte: »Ich bin ein Lyriker, und das ist auch gut so«, waren die ersten Druckfahnen, die er mir schickte, genau fünfundzwanzig Jahre nach dem ersten Bändchen. Die Bestätigung, die der Spiegel mir zurückgab wie eine Belohnung meines Mutes, war der fertige Band. Ich empfand etwas wie Verblüffung, als meine eigenen Verse mich von diesen Blättern fremd ansahen, in schöner Typografie und unter einem gemeinsamen Buchtitel, als Format und Einband festzulegen waren, als meine Gedichte in Beziehung traten zu anderen im selben Verlagsprogramm und ähnlicher Gestaltung. Das damalige Erstaunen spüre ich noch immer.
Der Verleger, der in dieser frühen Phase auch der Lektor war, half mir, den Satz, den ich beim Blick in die Druckfahnen für mich zu sagen geübt hatte, auch öffentlich zu wiederholen. Er tat es in Tat und Wort, mit der unwidersprechlichen Feststellung »You can’t have your cake and eat it« und mit der Ermutigung zu Fortsetzungen. So erschien 2004 mein zweiter Gedichtband; so folgten 2009 der dritte und dann noch drei weitere. Das Comingout war da schon Vergangenheit; aber das Erlebnis einer produktiven Rückkoppelung blieb.
Dieser Vorgang setzt sich aus einfachen Dingen zusammen, Alltagsgeschäften: Gesprächen mit dem Lektor, kritischen Nachfragen und Korrekturgängen, grafischen Vorschlägen, Farben und Formaten, Vorschautexten und Blurbs. Von Band zu Band wiederholte sich dabei die Erfahrung, die ich zuerst über den Druckfahnen gemacht hatte. Sie wurde sogar intensiver, und sie differenzierte sich aus. Der Blick auf das dreidimensionale Artefakt entwickelte ein Magnetfeld, in dem sich die einzelnen Gedichte zu Gruppen und die Gruppen zu Bänden zu ordnen begannen. Und noch etwas geschah in dem Maße, in dem aus dem einen Band eine Reihe wurde: Der Fortgang ermöglichte und verlangte eine Reflexion des Geschriebenen und des zu Schreibenden, die allmählich zu einer Art von Werkempfinden führte. Wo Ideen und Motive gewesen waren, Datensätze, Zettel und Kritzeleien, da wurde es Buch; wo ein einzelnes Buch gewesen war, entstand (klein, aber mein) eine Art Werk. Linien ergaben sich, die ich nicht geplant, aber doch offenkundig gezogen hatte, Ideen und Motive stellten sich ein, aus Zetteln und Daten der nächste Band. So wurde aus Einzelteilen eine Gestalt.
In einem Masterseminar in Göttingen sprach ich vor Kurzem von einem Gedicht der Annette von Droste-Hülshoff, Das Spiegelbild, und von derjenigen kindlichen Entwicklungsphase, die Jacques Lacan das »Spiegelstadium« nennt. Es ging also um die mit der Entdeckung des eigenen Spiegelbildes einhergehende Konstituierung des ersten Selbstbewusstseins, wenn aus lauter disparaten Einzelteilen und Impulsen das zusammenschießt, was der Spiegel als Gestalt zeigt, um Allmachtsfantasien eines Größenselbst und um die damit einhergehende, unausweichlich gleichzeitige Entfremdungserfahrung und Zerstückelungsangst.
Im Spiegel lautete anfangs des 20. Jahrhunderts der Titel einer jahrelang laufenden Kolumne im Litterarischen Echo, in der sich der junge Thomas Mann und andere Schriftsteller, die mich in meinem akademischen Dasein beschäftigten, im Spiegel ihrer Bücher ansehen und beschreiben sollten. Wenn ich so etwas entwickelt habe wie ein Werkempfinden, Werkbewusstsein, dann ist das »im Spiegel« geschehen: in der Reihe meiner erwachsenen Gedichtbände in ihrer Typografie, ihren Umschlägen, der Kontinuität des Formats; in all dem, was das Lektorat, die Herstellung, die Werbeabteilung, der Verleger mir, nein: meinen Texten als Spiegel vorhielt. Es ähnelt tatsächlich dem Spiegel Lacans, seinen Versprechen, auch seinen Schrecken. Einer seiner Leitbegriffe, das Wort »libidinös«, passt hierher.