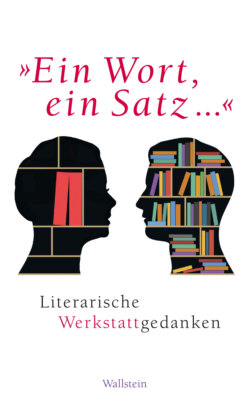Читать книгу "Ein Wort, ein Satz…" - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DANIELA DANZ
Das Geschriebene / das zu Schreibende
ОглавлениеWer wäre ich geworden, wenn 1990 das Land, in dem ich aufgewachsen bin, nicht aufgehört hätte zu existieren? Ich frage mich das oft, habe geradezu einen Hang zu solchen Fragen: Wer wäre ich als Mann, wer vor zweihundert Jahren, wer von einem Wissen her, das ich nicht habe, einem Wissen zum Beispiel um den Zeitpunkt meines Todes? Und diese Fragen umgeben mich in Ringen: Wer wären meine Kinder in einer anderen genetischen Kombination oder ohne die erzieherischen Eingriffe ihrer Eltern und nächst dieser Frage: Wie wäre mein Werk ohne seine praktischen Bedingungen? Und auch diese Frage wächst in Ringen um mich herum: Wie hätte Hölderlin geschrieben, hätte er einen Verlag und einen Literaturbetrieb wie ich gehabt? Hätte er jene sprachliche Radikalität von einer abgesicherteren Position aus erreicht? Oder welches Vokabular hätte Celan benutzt, wenn er nicht auf einem Außenposten der deutschen Sprache, in der Bukowina, das Sprechen erlernt hätte?
Wie ist es nun mit meinem Werk? Habe ich ein Werk, arbeite ich an einem Werk, werde ich ein Werk haben, es gehabt und erarbeitet haben? Ist ein Werk nur das Geschaffene oder auch das zu Schaffende? Wenn ich sage: mein Leben, dann meine ich das gegenwärtige und das zurückliegende, über das zukünftige weiß ich gnädigerweise nichts. Allerdings verlängere ich wie selbstverständlich die Linien des bisherigen in die Zukunft hinein, würde aber doch stocken, die berüchtigte Frage zu beantworten: Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? In Bezug auf mein Werk gibt es solche Linien in die Zukunft nicht. Es gibt so etwas wie Reisepläne: Themen, für die ich gerne Zeit hätte. Aber ansonsten liegt hinter mir klar und deutlich der gekommene Weg, vor mir keine Spur. Rückblickend sehe ich zwei Linien, die der Prosa und die der Lyrik. Was die Linie der längeren Prosawerke betrifft, so besteht sie nur aus der Verbindung zwischen zwei Punkten, Türmer (2006) und Lange Fluchten
(2016). Das ergibt zwar eine Linie, aber eine, über die sich noch nicht viel sagen lässt. Das lyrische Werk hingegen besteht aus vier thematischen Bänden, die sich mit Fragen nach der ostdeutschen Provinz (Serimunt, 2004) befassen, mit dem Zusammenhalt und den Grenzen Europas im Osten (Pontus, 2009), der Problematik von Nation und Nationalismus (V, 2014) und jetzt mit dem ambivalenten Begriff der Wildnis (Wildniß, 2020) und unserer neuerlichen Affinität dazu. Es geht immer um Gesellschaft, darum, was sie zusammenhält und wie sie sich verortet. Da die Linie vom ersten Band bis zu dem, der gerade erschienen ist, sehr geradlinig verläuft, ließe sich erwarten, dass sie weiterführt. Aber wohin und was ist ein Gedicht und wie soll ich es schreiben? Fragen und Zweifel grundsätzlichster Art stehen in der ungespurten Landschaft vor mir herum.
Zurückkehrend zur Frage nach dem Einfluss der äußeren Bedingungen auf mein Schreiben, lassen sich nun, da die Linien gezogen sind, verschiedene Hypothesen aufstellen. Zum einen denke ich, dass die Themen, über die ich schreibe, weniger damit zu tun haben, welche Resonanz sie erfahren, ihre sprachliche Umsetzung hingegen schon mehr. Ich kann mir vorstellen, dass ich anders schreiben würde, wenn mir oft genug gesagt werden würde, dass das keiner lesen möchte, wobei mir da auch Grenzen gesetzt sind und ich müsste doch mit Hölderlins Worten bald kapitulieren: »Sollten aber dennoch einige solche Sprache zu wenig konventionell finden, so muß ich ihnen gestehen: ich kann nicht anders.« Auf meine Themenwahl hätte das aber sicher eher den Einfluss, dass ich gar nicht mehr schreiben würde oder für die Schublade. Sie ist zu geschätzten 60 Prozent von der gesellschaftlichen Situation, zu 30 Prozent von der privaten Situation und nur zu 10 Prozent davon abhängig, welche Erwartungshaltungen es an sie gibt. Alles in allem würde ich daraus aber keine Schlüsse auf mich als Autorin, sondern Schlüsse auf meine beruflichen Rahmenbedingungen ziehen. Die sind sehr gut und in meinen Augen die eines Menschen, der eine glückliche Kindheit hatte, womit ich natürlich die literarische Kindheit meine.
In terms of theory of attachment würde man von einer sicheren Bindung sprechen (B-Typ), die es mir als Autorin bis jetzt immer ermöglicht hat, mich zuversichtlich nach meinen eigenen Gesetzen zu entfalten. Daran hat den größten Anteil die Gesellschaft, in die ich als Schreibende hineingewachsen bin – zum Beispiel in Kontrast zu der Gesellschaft, in die ich als Mensch hineingewachsen bin und von der ich mich, siehe oben, frage, auf welcher Seite der Schneide ich mit zunehmender Klarheit über die Widersprüche hinabgefallen wäre. Den zweitgrößten Anteil aber haben mein Verlag und mein Lektor als meine erste Bindungsperson. Bis heute erstaunt mich, mit welcher Unbeirrbarkeit sich beide schon gleich zu Beginn für mich entschieden hatten, als ich selbst mir über mein künftiges Werk, welchen Begriff ich gar nicht zu denken gewagt hätte, bewusst war. Und beide haben mir seither immer wieder Gelegenheit gegeben, mein Vertrauen darauf, dass ich dort eine Heimat habe, zu erneuern. Von hier aus also, again in terms of theory of attachment, erkunde ich als Autorin die Welt und schaffe mein Werk. Und, wie ein sicher gebundenes Kind, würde ich in Notsituationen als Autorin zuerst den Rat meines Lektors und meines Verlags suchen, eingedenk dessen, wie beide in den verschiedensten Lebenslagen für mich gesorgt haben. Mein Lektor hat mir darüber hinaus einmal das Schönste gesagt, was man einem Autor sagen kann. Die Sache war so, dass er einen persönlichen Widerstand gegen einen der Protagonisten meiner Bücher hatte und ich schließlich gefragt habe, warum der Verlag dann das Buch überhaupt veröffentlichen will, und er ganz schlicht geantwortet hat: »Weil es dein Buch ist.« Wenn mir so viel unbedingtes Vertrauen und Verlässlichkeit geschenkt wird, möchte ich meinerseits auch alles tun, damit es meinem Verlag mit meinen Büchern gut geht. Ich werde beim nächsten Thema und der nächsten Hauptfigur schon noch einmal überlegen, ob das etwas ist, das, wie auch immer, meinem Verlag guttut. Ich weiß aber auch, dass ich die Freiheit habe, wenn ich »nicht anders kann« als über dieses Thema oder jenen Charakter zu schreiben, ich das auch machen kann. Was für ein unglaubliches Glück, das mich inzwischen wirklich daran denken lässt, dass ich auf diese Weise ein Werk schaffen kann.