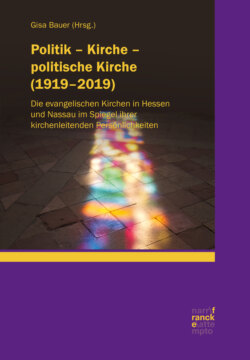Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 46
2.3 Die Hellhörigkeit psychischen Leidens
ОглавлениеIn einer noch anderen Form ist die Erschließung aus dem Negativen im psychischen Leiden gegeben. Hier geht es nicht wie bei der lokalen Hirnschädigung um eine generelle Beeinträchtigung der humanen Lebensform, deren unterdrückte Gerichtetheit wie in einer Negativfolie sichtbar wird, sondern um Formen des Leidens, die in bestimmten Ausprägungen zugleich in privilegierter Weise mit Erfahrungen kommunizieren, die in Grundbedingungen des Menschseins wurzeln. Die erlebte Verwirrung, der Schmerz, die Verzweiflung sind nicht nur allgemeine Indizien des Menschlichen, sondern können in pathologischen Verzerrungen des Erlebens auf Probleme verweisen, die der Existenz als solcher innewohnen. Die verstehende Psychopathologie ist dieser Spur gefolgt, so in der sogenannten Daseinsanalyse, die von Ludwig Binswanger und Medard Boss in Anknüpfung an Heidegger entwickelt worden ist und in deren Horizont Alice Holzhey-Kunz die These formuliert, dass der seelisch leidende Mensch sich durch eine besondere Hellhörigkeit für die Grundprobleme des Menschseins auszeichne1. So kann etwa depressives Leiden als „unverhülltes Vernehmen des existentialen Unzuhauseseins“2 erscheinen, können psychische Krankheiten generell als Manifestationen eines „Leidens am Dasein“ 3 erscheinen und ihnen sogar eine besondere Nähe zur Philosophie attestiert werden – wobei allerdings die Differenz entscheidend ist, dass die philosophische Reflexion das besondere Leiden von der umfassenden existenziellen Erschütterung trennt, während der psychisch Kranke durch eine partikulare Bedrohung der allgemeinen Haltlosigkeit der Existenz ausgesetzt sein kann. Dass er diese durchlebt, macht seine Erfahrung in privilegierten Fällen (wie Hölderlin) zum bevorzugten Medium einer existenziellen Hermeneutik, aber auch zum ausweglosen Ort des Leidens, welches verbietet, die Nähe zur Philosophie zu idealisieren oder die pathologische Qualität des Leidens zu verharmlosen4. Das Verhältnis zwischen dem ‚normalen’ und dem pathologischen Erleiden der menschlichen Hinfälligkeit ist Gegenstand kontroverser Beschreibung, zwischen prinzipieller Andersartigkeit und gradueller Differenz, worin die Krankheit als heuristischer Schlüssel und ‚Vergrößerungsglas‘ für die Erfassung der conditio humana fungiert. Mit dieser Metapher umschreibt Michael Theunissen den Zugang, den uns das klinische Seelenleiden, dem er in Phänomenen des pathologisch gestörten Zeiterlebens nachgeht, zur Leidenserfahrung hin öffnet, die das normale Seelenleben als solches grundiert und die nach ihm zuletzt in der Zeitlichkeit des Daseins, der entfremdenden Herrschaft der Zeit über das menschliche Leben wurzelt5.
In solchen Ansätzen verschiebt sich die Perspektive von einem rein methodischen zu einem gleichzeitig inhaltlichen Negativismus. Ging es der negativen Theologie darum, über den Weg des Negierens des Negativen – des Absprechens von Prädikaten, die dem Endlichen, Vielen, Defizienten zukommen – einem eminent Positiven – Unendlichen, Einen, Vollkommenen – sich anzunähern, so zielte die phänomenologische Beschreibung darauf, im Verfehlen und Versagen die Fluchtlinie des Wollens und Gelingens und darin die Umrisse einer sinnhaft ausgerichteten Lebensform erkennbar zu machen. Auch in diesem zweiten Fall gilt die Erkenntnis einem in sich Positiven, das aber über das Medium eines an ihm selbst – nicht nur logisch-epistemisch – Negativen erschlossen wird6. Im dritten Fall wiederum setzt die Erkenntnis ebenfalls im nicht-gelingenden Lebensvollzug an, doch nicht als Negativfolie eines Gelingens, sondern um durch ihn hindurch ein gleichsam tieferes Versagen, ein fundamentales Leiden am Dasein erkennbar zu machen. Gleichwohl haben wir, wenn wir dieser Linie in Richtung eines inhaltlichen Negativismus weiter folgen, zu prüfen, wieweit auch darin nicht nur eine Wahrheit über den Menschen und sein Leben zutage tritt, sondern in gewisser Weise eine Umkehr, eine Transzendierung des Negativen sich andeutet und gerade in der radikalisierten Negativität ein eigenes, affirmatives Wahrheitspotential entbunden wird.