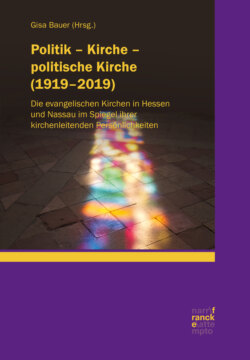Читать книгу Politik – Kirche – politische Kirche (1919–2019) - Группа авторов - Страница 49
3.2 Geschichtlich-gesellschaftliche Negativität
ОглавлениеAlternativ zu diesen Gestalten der Verfehlung ist von einer Negativität zu handeln, die ihrerseits in die menschliche Lebenswelt eingehen und sie durchdringen kann, die wir aber nicht in gleicher Weise als konstitutiv für das Menschsein, als teilhabend an der Natur des Menschen auffassen. Sie ist durch das Tun des Menschen bedingt, sie begegnet als kontingentes Ereignis, als Faktum der Geschichte, sie überwältigt das Individuum als äußeres Schicksal. Im Blick ist die Erfahrung von Unrecht, Gewalt und Zerstörung, die „reale Hölle“ des gesellschaftlich-geschichtlichen Bösen, im Vergleich mit welchem Adorno die Katastrophe der ersten Natur für „unbeträchtlich“ hält1. Hier stellt sich in zugespitzter Weise die Frage der Theodizee, hier sind wir mit der radikalen Irrationalität des Bösen, der Unerträglichkeit des Leidens, dem Abgrund des Nichtseins konfrontiert. Es ist der Bereich, wo der Sprachentzug und die Unmöglichkeit, mit dem Negativen zurechtzukommen, in härtester Weise erfahren werden, wo die Kraft des Denkens und die „Fähigkeit zur Metaphysik“ vollends unterlaufen, „gelähmt“ sind2. Auschwitz ist die Signatur jener Erfahrung, in welcher die „absolute Negativität“, die „vollkommene Nichtigkeit“ des Menschen gegenwärtig wird3. In vielfältigen Beschreibungen umkreist Adorno den Paroxysmus des Negativen, in welchem Leiden und Böses in letzter Steigerung real geworden sind. In gewisser Weise ist menschliches Leben hier in noch stringenterer Weise durch das Nichtseinsollende herausgefordert als in der Konfrontation mit Endlichkeit und Sterblichkeit, mit eigenem Verfehlen und Scheitern, ist das Leben noch konsequenter zum unversöhnlichen Widerstand, zur „unbeirrten Negation“4 aufgerufen.
Man kann darüber streiten, wieweit sich in solchen Konstellationen Graduierungen zwischen naturbedingten und menschheitlichen Negativitätserfahrungen aufrechterhalten, wieweit sich im Erleben konstitutive und kontingente Negativitäten auseinanderhalten lassen. In all dem finden offenkundige Überlagerungen, Übergänge, Verschränkungen statt. Der Schrei der Kreatur angesichts von Zerstörung und Tod, der Schmerz der Krankheit in letzter Verlassenheit kann absolut sein, nicht durch ein radikaleres Leiden relativierbar. Lebensweltlich, existentiell, sozial erfahrene Negativität kann sich mit einer nihilistischen Weltsicht und metaphysischer Verzweiflung verbünden. Das von Adorno beschworene Grauen, die ‚reale Hölle‘ inmitten der Welt ist nicht das schlicht Andere zum Reich des Teufels und der Verdammnis. Das malum morale und das malum physicum öffnen sich zum malum metaphysicum. Die unterschiedlichen Kristallisationspunkte negativer Erfahrung stehen nicht für isolierte Zonen der Erschütterung. Doch setzt die in der Sozialkritik virulente realhistorische Negativität darin einen ganz bestimmten Akzent. Sie begründet einen Negativismus, der auf der fundamentalen Nicht-Versöhntheit der Welt beharrt. Wenn Hegel die Arbeit des Negativen und das Hindurchgehen durch die Zerrissenheit als unabdingbaren Weg im Leben des Geistes beschreibt, so ist es ein Weg, der am Ende aus dem Negativen heraus, zu einer höheren Versöhnung führt. Negative Dialektik aber insistiert auf der Unabschließbarkeit des Umwegs, verschließt sich der spekulativen Überformung des Widerspruchs durch die vereinigende Ganzheit. Sie steht in diesem Sinne exemplarisch für ein nach-metaphysisches Denken, das sich von substantiellen Fundamenten und einem übergreifenden Vernunftoptimismus abgelöst hat und sich seiner Basis in der Abwehr, im Neinsagen zum Nichtseinsollenden versichert. In einer gewissen Weise stellt die realhistorische Negativität eine Radikalisierung der existentiellen Haltlosigkeit und Exponiertheit dar, ist das Leiden der Opfer von Gewalt und Entmenschlichung tiefer, heilloser als die Unentrinnbarkeit von Krankheit und Tod. Auch nach einer anderen Hinsicht kann man sagen, dass das Negative in seiner Radikalität erst in der historischen Perspektive zum Durchbruch kommt, sofern – nach einer Lesart von Paul Ricœur – die anthropologisch-existentielle Besinnung nur die Möglichkeit des Bösen – die Fehlbarkeit –, nicht seine Wirklichkeit freilegt, welche erst in den historisch-kulturellen Zeugnissen der Menschheit, den ‚Symbolen des Bösen‘ ihren Niederschlag findet5. Im Ganzen gewinnt die negativistische Denkform ihre Schärfe in einer zugleich anthropologischen und zeitdiagnostischen Wahrnehmung, welche Phänomene der Entfremdung und Unterdrückung, der Zerrüttung und Zerstörung, des sozialen Zwangs und psychischen Zerfalls, der Selbstverfehlung und des Selbstverlusts in vielfacher Gestalt und Interferenz umgreift.