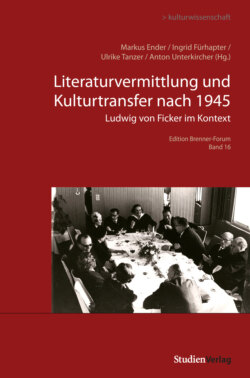Читать книгу Literaturvermittlung und Kulturtransfer nach 1945 - Группа авторов - Страница 13
Kulturvermittlung im Hochland der Nachkriegszeit (1946–1961) von Thomas Pittrof (Eichstätt)
ОглавлениеAnders als viele Kultur- und Literaturzeitschriften der Nachkriegszeit,1 seien es der kurzlebige Ruf2 (1946/47) von Alfred Andersch und Hans Werner Richter, die Frankfurter Hefte3 (1946–1985) von Walter Dirks und Eugen Kogon, die von dem Nürnberger Buchhändler und Verleger Karl Borromäus Glock herausgegebene Besinnung4 (1946–1985), Dolf Sternbergs Die Wandlung5 (1945–1949), Paeschke/Moras’ Merkur6 (seit 1947) oder auch Otto Mauers und Karl Strobls Wort und Wahrheit7 (1946–1973) – anders als diese also war das Hochland der Nachkriegszeit kein Neuanfang, sondern die erklärte Fortsetzung der 1903 von Carl Muth ins Leben gerufenen und 1941 durch die nationalsozialistischen Machthaber unterdrückten Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und der Kunst,8 als die sie ihr Untertitel auswies. „50 Jahre ungebrochene Überlieferung 1903–1953“ lautete denn auch die Devise der zur 50. Wiederkehr des ersten Hochland-Jahrgangs herausgegebenen Jubiläumsbroschüre (Abb. 1), und dieser Anspruch einer nur zeitlich unterbrochenen, im Geistigen aber gänzlich ungebrochenen Kontinuität spiegelte sich sowohl in der äußeren Gestaltung der unverändert im Kösel-Verlag erscheinenden Zeitschrift wie im Personellen und Programmatischen. Es war ein Jahr vor seinem Tod noch Carl Muth selbst gewesen, der 1943 testamentarisch den seit 1935 neben ihm in der Redaktion tätigen Franz Josef Schöningh9 zu seinem Nachfolger als Herausgeber und Hauptschriftleiter des Hochland bestimmt hatte, und in dieser Funktion prägte Schöningh, in Personalunion zugleich Herausgeber der neu gegründeten Süddeutschen Zeitung, 1946 jenen berühmten Satz im ersten Heft des Nachkriegs-Hochland, welcher lautete: „Fragt aber jemand: ‚Besitzt denn dieses ‚neue‘ Hochland ein Programm‘ – so antworten wir: Ja – seine Vergangenheit“.10 In dieser „Reflexion der Kontinuitäten“ standen ihm nebenbei nicht nur der nachmalige Schöpfer dieser Formel zur Seite, der 1956 als junger Mann von Schöningh zur Mitarbeit am Hochland eingeladene Philosoph Karlfried Gründer,11 sondern vor allem eine Reihe von Autorinnen und Autoren, die teilweise bereits vor 1933 im Hochland kontinuierlich publiziert hatten. Hochland hat sie in einer umfangreichen Porträtgalerie dem ersten Heft des Jubiläumsjahres 1953/54 (Bd. 46) vorangestellt (Abb. 2a/2b): Nach dem „Übervater“12 Carl Muth und den Herausgebern bzw. leitenden Redakteuren Friedrich Fuchs, Franz Josef Schöningh, Max Ettlinger, Konrad Weiß, Karl Schaezler13 und Heinz Flügel in der Folge des Alphabets Hans Asmussen, Clemens Bauer, Werner Bergengruen, Joseph Bernhart, Karl Buchheim, Hedwig Conrad-Martius, Alois Dempf, Friedrich und Philipp Dessauer, Peter Dörfler, Wolfgang Grözinger, Romano Guardini, Eugen Gürster, Karl Joseph Hahn, Wilhelm Hausenstein, Curt Hohoff, Elias Hurwicz, Theoderich Kampmann, Otto Karrer, Friedhelm Kemp, Alfred von Martin, Anton Mayer-Pfannholz (der Vater von Carl Amery), Clemens Münster, Josef Pieper, Otto B. Roegele, Maria Schlüter-Hermkes, Franz Schnabel, Reinhold Schneider, Richard Seewald, Franz Xaver Seppelt, Fedor Stepun und Karl Thieme. Das sind allzu viele, als dass sie hier im Einzelnen charakterisiert und gewürdigt werden könnten, manche Bekannte wie Bergengruen, Bernhart, Guardini, Franz Schnabel oder Reinhold Schneider bedürfen auch keiner näheren Vorstellung, aber den ein- oder anderen will ich doch in aller Kürze in Erinnerung rufen.
Abb. 1: Jubiläumsbroschüre
Abb. 2a: Porträtgalerie
Abb. 2b: Porträtgalerie
Zunächst Schaezler: Er war bereits 1925 zum Hochland gekommen, wo er besonders für die Musikbeiträge verantwortlich zeichnete, stand dann ab 1946 als Schriftleiter Schöningh zur Seite und übernahm nach dessen plötzlichem Tod 1960 die Herausgeberschaft des Hochland, die er bis 1966 innehatte. Heinz Flügel, Direktor der Evangelischen Akademie in Tutzing, war auf die neu geschaffene Position eines Beraters der Schriftleitung in Frage gekommen, die das Verhältnis der beiden großen christlichen Konfessionen berührten, und verkörperte wie der ebenfalls evangelische Hans Asmussen, der im ‚Dritten Reich‘ zur Bekennenden Kirche gehört hatte und nach dem Krieg innerhalb der EKD hervortrat, das auch im Hochland deutlich zunehmende Interesse des vorvatikanischen Nachkriegskatholizismus an Fragen der Ökumene und des Gesprächs mit den anderen Konfessionen.14 Zu den Autoren, die bereits vor 1933 im Hochland geschrieben hatten, gehörten neben Franz Schnabel der Breslauer Kirchenhistoriker und Verfasser einer mehrbändigen Papstgeschichte Franz Xaver Seppelt, der Wirtschaftshistoriker Clemens Bauer,15 der Verbindungen zum Freiburger Kreis unterhalten hatte, Karl Buchheim und Karl Thieme, beide Konvertiten von der evangelischen zur katholischen Konfession – Thieme 1934, Buchheim 1942; ferner der Priester Theoderich Kampmann, ein alter Freund Schöninghs, 1945 Gründer des christlichen Bildungswerks Die Hegge bei Paderborn und von 1956 bis zu seiner Emeritierung 1967 ordentlicher Professor für Religionspädagogik, Katechetik und Homiletik an der LMU München, sowie die Philosophen Alois Dempf, dieser hervorgetreten u.a. sowohl als Autor des Sacrum Imperium16 wie durch seine Schrift über Die Glaubensnot der deutschen Katholiken,17 und Josef Pieper, der bekanntlich in der Nachkriegszeit mit seinen bei Kösel verlegten Traktaten beträchtliche Auflagen erzielte.18 Ebenfalls vor 1941 waren schon Beiträger zum Hochland gewesen der Kultursoziologe Alfred von Martin,19 der Anglist Curt Hohoff,20 Friedrich und Philipp Dessauer21 aus dem Kreis um die Rhein-Main-Zeitung, Maria Schlüter-Hermkes,22 Fedor Stepun, Elias Hurwicz und Eugen Gürster. Erstmals im Nachkriegs-Hochland publizierten Wolfgang Grözinger, Karl Josef Hahn, Friedhelm Kemp, diese mit Hohoff speziell für die Schöne Literatur zuständig, und Otto B. Roegele, späterer Herausgeber des Rheinischen Merkur und eine sowohl für die katholische Publizistik wie Publizistikwissenschaft wichtige Figur der Nachkriegszeit bis in die 1980er Jahre hinein.23 Ich will diesen durchaus prominenten Namen und profilierten Namensträgern, zu denen auch der erwähnte Clemens Münster gehört,24 noch zwei weitere zur Seite stellen, die hier nicht im Bild vertreten sind, nämlich Hans Blumenberg und Theodor W. Adorno (ein dritter wäre Friedrich Heer). Adorno ist zwar niemals Mitarbeiter des Hochland gewesen – er schrieb bereits u.a. für die Frankfurter Hefte und später für den Merkur25 –, unterhielt aber brieflich freundschaftliche Beziehungen zum Kösel-Verlagsinhaber Heinrich Wild,26 bei dem Adorno zeitweise seine dann schließlich doch bei Suhrkamp erschienene Benjamin-Ausgabe unterzubringen versuchte,27 und seine Minima Moralia wurden im Hochland durch den katholischen Philosophen Hermann Krings rezensiert, von dem Adorno so viel hielt, dass er Krings dem bayerischen Kultusminister für ein philosophisches Ordinariat in München empfahl.28 Die Adorno-Forschung hat bisher dessen Affinitäten zum Katholischen und seinen Verbindungslinien in den Katholizismus hinein nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber sie sind in der Tat erstaunlich genug, um einen kleinen Exkurs – Marginalien zu „Adornos hochkomplexe[r] ‚Interkonfessionalität‘“29 – zu rechtfertigen: Nicht nur, dass seine Fakultät, wie er am 25.2.1957 an Wild schreibt, soeben einen „hervorragend begabten Jesuitenschüler“30 habilitiert habe, und zwar mit einem „große[n] Werk über ontologische Probleme des Neothomismus“;31 überhaupt, so Adorno an Wild, habe er sich „philosophisch […] mit Katholiken immer gut verständigen können“,32 „zumal solchen jesuitischer und dominikanischer Schulung“, und zwar „weit besser“ mit diesen „als mit all dem, was heutzutage den Jargon der Eigentlichkeit plappert“.33 Diese Formulierung könnte Adornos Sympathien für das Katholische eher als flüchtigen Widerschein einer aktuell aufflammenden Heidegger-Antipathie erscheinen lassen. Dass sie in Wahrheit lebensgeschichtlich tief verwurzelt und zugleich im Biographischen34 wie Intellektuellen begründet waren, beweist ein Brief Adornos vom 7. Oktober 1934 an den Komponisten Ernst Křenek, der zu den wichtigsten Gesprächspartnern Adornos gehörte; dort schreibt er:
Irre ich mich nicht, so haben Sie neuerlich stark katholische Gehalte aufgenommen. Sie sind mir sehr, sehr vertraut; ich selber habe einmal gemeint, durch den katholischen ordo sei es möglich, die aus den Fugen geratene Welt zu rekonstituieren, und damals, vor 10 Jahren,35 stand ich unmittelbar vor der Konversion, die mir als dem Sohn einer sehr katholischen Mutter nahe genug lag. Ich habe es nicht vermocht – die Integration der philosophia perennis scheint mir unrettbar romantisch und in Widerspruch zu jedem Zug unserer Existenz […].36
Negative Dialektik also als Gestalt jenes Philosophierens, dem es versagt ist, weiter in der Tradition der philosophia perennis zu denken, obgleich diese die ihm eigentlich gemäß wäre, da doch, wie Adorno 1954 ausdrücklich gegenüber Wild erklärt, er fest daran „glaube, daß, da es nur eine Wahrheit gibt, vor jeder vollzogenen wirklichen Einsicht die Standpunkte in nichts zergehen“?37 Dem wäre an anderer Stelle weiter nachzuforschen. Hermann Krings jedenfalls traf in seiner erwähnten Hochland-Besprechung der Minima Moralia mit der ihm zuweilen eigenen Intuition diesen versteckten Berührungspunkt ziemlich genau, als er unter dem Titel Grenzen der Dialektik nach dem Standort fragte, von dem aus Adorno „richtet“, und dazu feststellte:
Es sei ihm keineswegs verwehrt, zu richten, aber er weist sich nicht aus. Die Dialektik des Analytikers verdeckt den geistigen Impuls, der in fast jedem Aphorismus durchdringt und das Buch als Ganzes trägt. Das Wort Gesellschaft verdeckt das Wort Gott. Der soziologische Philosoph Adorno verdeckt den „ganz unmöglichen“ Theologen Adorno. Sein Buch erhebt indirekt den Anspruch, wie ihn ein von Gott inspiriertes, in Wahrheit theologisches und darum die Welt richtendes Werk erheben muß; doch es ist weder inspiriert, noch enthält es eine Theologie, sondern es schließt sich ein in den Zirkel seiner eigenen Dialektik. Ist es erlaubt, wie ein Gottesmann zu richten, aber an der intellektuellen Existenz des Dialektikers festzuhalten? – So paradox es gegenüber einem Buch so durchkonstruierter und genau funktionierender Sprache klingen mag, dieses Buch ist in gewissem Sinn romantisch; das heißt: es erhebt den absoluten Anspruch, aber es kommt aus der Dialektik nicht heraus; es richtet alles und „verweilt in der Negativität“.38
Man sieht, wo Krings Adorno stellt: Adorno verweigert sich der philosophia perennis mit der Begründung, das sei „unrettbar romantisch“ – Krings erwidert: Das, was du stattdessen machst, ist romantisch, romantisch jedenfalls „in gewissem Sinn“. – Was jedoch nun Hans Blumenberg betrifft,39 so haben wir es im Biographischen mit einer weiteren jüdisch-katholischen Konstellation zu tun, die freilich noch näher an das Hochland heranführt. Denn hier veröffentlichte Blumenberg, der wegen der jüdischen Herkunft seiner Mutter trotz seiner glänzenden Begabung im ‚Dritten Reich‘ von einem Studium an einer staatlichen Hochschule ausgeschlossen worden war und zunächst an der Erzbischöflichen Philosophisch-Theologischen Akademie in Paderborn, dann an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen studiert hatte, seit demselben Hochland-Jahrgang 1952/53 seine ersten, durchwegs exzeptionellen literarisch-philosophisch-theologischen Essays zu Kafka, Hemingway, Faulkner und Evelyn Waugh, den letzteren unter dem Titel Eschatalogische Ironie.40 Blumenberg litt nach 1945 trotz rascher Promotion in Kiel 1947 –, übrigens ebenfalls über ein Thema der (mittelalterlich-)scholastischen Ontologie, und nachfolgender Habilitation 195041 ebenda – unter dem Grundgefühl, von den Nazis um entscheidende Jahre seiner intellektuellen Existenz betrogen worden zu sein, und so hatte er noch vor seinen Veröffentlichungen im Hochland damit begonnen, sowohl im Philosophischen Jahrbuch wie im Studium Generale mit Aufsätzen hervorzutreten, die bereits Grundmotive des späteren Blumenberg anklingen lassen – so z.B. im Titel seines Beitrags für das Philosophische Jahrbuch von 1946 Über das Recht des Scheins in den menschlichen Ordnungen nach Pascal,42 der einem Satz aus der Lesbarkeit der Welt von 1981 präludiert: „Die Menschen ertragen den Realismus ihrer Gegenseitigkeit nicht.“43 Aber seine Entscheidung für das Hochland lag, wie Blumenberg einmal an Schöningh schreibt, in Bindungen begründet, die der Hochland-Leser Blumenberg in der Zeit des Dritten Reiches an diese Zeitschrift wegen ihres unvermindert hohen Niveaus eingegangen war, und diese Wertschätzung hat Schöningh umgekehrt auch seinem Hochland-Autor trotz mancher Auseinandersetzungen, die er mit dem ungeduldig auf rasche Veröffentlichung seiner Arbeiten drängenden Blumenberg zu bestehen hatte, entgegengebracht.
Ich habe mich mit diesem Exkurs zwei Fragen angenähert, die in der Vorbereitung dieses Kolloquiums uns mitzubedenken aufgegeben waren, nämlich einmal der Frage, „welchen Stellenwert […] insbesondere dem intellektuellen Austausch […] mit jüdischen […] Intellektuellen“ und Emigranten beigemessen wurde, sowie zweitens dem Wunsch nach „genauere[n] Einblicke[n] in die Auseinandersetzung zwischen den (zumeist jüngeren) avantgardistischen und den konservativen Vermittlern“. Den ersten Punkt behandle ich thesenförmig, den zweiten skizzenartig und beide sehr vorläufig. Was also den ersten Punkt betrifft, so habe ich den allerdings dann doch zu differenzierenden Eindruck gewonnen, dass das Gespräch mit jüdischen Emigranten und Intellektuellen für die Herausgeber im Hochland zunächst keine Rolle spielt. Woran das lag, kann ich nicht sagen, abgesehen davon, dass manche der im Exil Altgewordenen recht bald starben – so der zunächst jüdische, dann katholische Totalitarismusforscher Walter Gurian,44 der 1934 in die Schweiz, 1937 in die USA emigriert war und dort 1954 starb – oder sie aus anderen Gründen den Anschluss verloren (hatten).45 Aber ich kann diesen geringen Stellenwert des Gesprächs mit jüdischen Intellektuellen und anderen Emigranten wenigstens an drei (freilich sehr unterschiedlichen) Personen aus unserer Porträtgalerie illustrieren, nämlich an Eugen Gürster, Elias Hurwicz und Karl Thieme. Eugen Gürster, geb. 1895 in Fürth, zuletzt von 1931 bis 1933 Chefdramaturg am Hessischen Landestheater Darmstadt, hatte 1933 wegen seiner öffentlichen Kritik am nationalsozialistischen Regime und seinem politischem Engagement in der Zentrumspartei in die Schweiz emigrieren müssen, wo er teils unter Pseudonym oder anonym etwa 350 Essays und Artikel zu Themen wie Die Lage des Katholizismus im heutigen Deutschland (1934), Schicksalsstunde des Katholizismus (1934), Die aktuelle Situation des deutschen Katholizismus (1936) oder Kardinal Faulhabers Besuch auf dem Obersalzberg (1936) publizierte, vor allem aber 1939 seine Schrift Die Judenfrage – eine Christenfrage erscheinen ließ, in der er darstellt, „wie der Antisemitismus in Hitlerdeutschland aufgrund eines bereits verwässerten Christentums um sich greifen konnte, womit die sog. ‚Judenfrage‘ letztlich auch zur Identitätsfrage für das Christentum wird.“46
1941 unter Aberkennung seines Doktortitels aus Deutschland offiziell ausgebürgert, übersiedelte er im selben Jahr aus der Schweiz in die USA, wo er bis zu seiner Rückkehr in die Bundesrepublik im Jahr 1952 als Dozent für deutsche Literatur und Musikwissenschaft an den Universitäten von Maryland und Marygrove College, Detroit, arbeitete. Gürster lebte ab 1960 als freier Schriftsteller in München, wo er 1980 auch starb. Er publizierte neben Essays und Aufsätzen im Hochland47 bei Herder in Freiburg eine Reihe von Taschenbüchern, die ihn als „wortgewaltigen Kritiker der industriellen-technischen Welt und des banalen Zukunftsoptimismus einer ‚metaphysiklosen Gesellschaft‘“48 auswiesen; Peter de Mendelssohn nannte ihn gar einen „militanten Traditionalisten“.49 Nur: Weder in diesen Publikationen noch im brieflichen Verkehr mit Schöningh spielten Emigration und Exil irgendeine Rolle. Gürster schrieb im Hochland nicht, weil von ihm oder mit ihm das Gespräch mit einem Remigranten über seine Exilserfahrungen gesucht wurde, sondern weil er an die Traditionen und Positionen anknüpfte, die er im Hochland bereits vor 1933 vertreten hatte. Ähnliches gilt für den deutschen Soziologen russisch-jüdischer Herkunft Elias Hurwicz,50 der das Dritte Reich in Deutschland nur durch eine sog. „privilegierte Ehe“ mit einer deutschen Nichtjüdin überlebt hatte, obwohl er im Hochland im März 1933 eine scharfe kritische Stellungnahme Nationalsozialismus am Scheidewege veröffentlicht hatte, danach dort nur noch unter dem Schutz verschiedener Decknamen publizieren konnte51 und drei seiner Bücher – die Geschichte des russischen Bürgerkriegs, die Geschichte der jüngsten russischen Revolution und die Schrift Zur Reform des politischen Denkens – 1938 auf der „Liste des schädlichen oder unerwünschten Schrifttums“ gelandet waren. Hurwicz’ autobiographischer Beitrag Aus den Erinnerungen eines Abseitigen52 bezog sich jedoch ausschließlich auf die Zeit zwischen den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik, sparte also die Jahre nach 1933 gerade aus – ein Umstand, den Hurwicz wiederum in einer Hochland-Besprechung an Leo Baecks 1955 erschienenem Buch Dieses Volk. Jüdische Existenz vermerkte, und der ihn zu folgender Deutung veranlasste:
In Baecks Schrift wird die jüngste Katastrophe, die alle bisherigen Ausmaße der so leidensreichen jüdischen Geschichte übersteigt, nicht einmal erwähnt. […] Sein Buch ist eben, obwohl aus der Zeit geboren, irgendwie zeitlos. Daß ein Mann, der so Schweres in seiner Zeit erlebt hat, sich im Glauben so völlig von ihr ablösen kann, beweist eine Größe, vor der die Narben der Herzen nichts mehr bezeugen und auch die Einwände der kritischen Wissenschaft nichts mehr beweisen sollen. Denn bei dieser Gestalt ist entscheidend, daß sie, um ein Gleichnis aus dem alten jüdischen Schrifttum zu gebrauchen, wie ein Fels des Glaubens dasteht, den „keine Winde der Welt erschüttern können“.53
Schließlich Karl Thieme.54 Thieme war 1935, ein Jahr später als Walter Gurian, in die Schweiz geflohen und hatte dort zusammen mit ihm 1937 eine Denkschrift mit dem Titel Die Kirche Christi und die Judenfrage55 veröffentlicht, „die alle Christen, besonders aber den Papst und die römische Kurie dazu aufrief, gegen den zeitgenössischen Antisemitismus und die Judenverfolgung in Deutschland öffentlich Stellung zu beziehen.“ Ich zitiere das der Einfachheit halber aus dem wikipedia-Artikel über Thieme, wo es dann weiter heißt: „Seit 1947 war er Gast-, seit 1953 ordentlicher Professor für Geschichte, Philosophie und Deutschtumskunde am Auslands- und Dolmetscherinstitut der Johann-Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim. […] Mit Ernst-Ludwig Ehrlich prägte er die christlich-jüdische Verständigung dieser Jahre.“56 Also doch: ein Vertreter des christlich-jüdischen Gesprächs. Aber wo fand es statt? Im Freiburger Rundbrief, dessen Mitherausgeber Thieme seit 1948 war, und, soweit ich sehe, nicht im Hochland, das erstmals im Februarheft des Jahres 1959 (!) einen Hinweis auf den Freiburger Rundbrief brachte.57 Es scheint, als sei jene inhaltliche Bestimmung, wonach unter der „jüdische[n] Frage“ zu verstehen sei: „das Geheimnis der jüdischen Ausgesondertheit“,58 im Hochland auch als Diskursregel befolgt worden: Die „jüdische Frage“ wurde diskutiert,59 aber eben vorzugsweise nicht im Gespräch mit jüdischen Autoren.60 Das ist umso auffallender, als im Kösel-Verlag selbst, in dem Hochland erschien, das Erbe jüdischer Autoren und Autorinnen sehr wohl bewahrt wurde – man denke nur an die Werkausgaben von Martin Buber, Else Lasker-Schüler, Rahel Varnhagen von Ense, Karl Kraus, Ludwig Strauß und Werner Kraft –, ist aber vielleicht auch einfach damit zu erklären, dass Hochland nie als Gesprächs-Forum konzipiert worden war, sondern eben als ‚Revue‘. Abschließend zur Frage nach der „Auseinandersetzung zwischen den (zumeist jüngeren) avantgardistischen und den konservativen Vermittlern“. Mir scheint, dass man das Hochland damit gleich zweimal einem Raster unterwirft, das nicht zu ihm passt. Erstens nämlich ist es nie der Stil des Hochland gewesen, die große publizistische Kontroverse zu suchen. Eine solche, durch das Hochland ausgelöste öffentliche Kontroverse hat es nur einmal und ausnahmsweise gegeben, nämlich ein Jahr nach Schöninghs Tod die um Böckenfördes Aufsatz Der deutsche Katholizismus im Jahr 1933. Eine kritische Betrachtung aus dem Jahr 1961,61 und es ist vielleicht bezeichnend, dass die spätere Hochland-Mitarbeiterin Ida Friederike Görres ihren Brief über die Kirche 1946 im Novemberheft der Frankfurter Hefte und eben nicht im Hochland veröffentlichte (das in diesem November freilich gerade erst mit seinem Wiedererscheinen begonnen hatte, während die Frankfurter Hefte bereits im April an den Start gegangen waren und ihre Herausgeber überdies Görres um diesen Beitrag gebeten hatten62). Zweitens gab es aber auch im Hochland die hier unterstellte Frontbildung zwischen den „(zumeist jüngeren) avantgardistischen und den konservativen Vermittlern“ nicht, und zwar wiederum aus (zumindest) zwei Gründen: Zum einen war, anders als bspw. dem Ruf, der sich mit seinem Untertitel ausdrücklich als Forum der „jungen Generation“ verstand, dem Hochland nicht daran gelegen oder blieb es ihm auch verwehrt, „kulturelles Kapital aus der Zugehörigkeit zur jungen Generation zu beziehen“;63 sein kulturelles Kapital bezog es, wie gesehen, aus der Behauptung langjähriger Kontinuitäten, deren Fundamente in den frühen Mannesjahren der (Vor-)Vätergeneration gelegt worden waren (und denen ganz ungewöhnlich langlebige Leserbiographien korrespondierten64). Zweitens aber passte dieses Denken in modernehistorisch simplifizierenden Dichotomien auch nicht zum intellektuellen Habitus so weltläufiger Vermittlergestalten wie Wilhelm Hausenstein,65 Friedhelm Kemp oder (des im Hochland allerdings seltener publizierenden) Gustav René Hocke,66 die alle in weiträumig dimensionierten europäischen Kunst- und Literaturlandschaften bewandert waren und bereits in diesen Räumen des Vergangenen Phänomene von faszinierender Modernität entdeckt hatten – man denke nur an Hockes Manierismusstudien.
Dass solche Entdeckungen freilich nicht immer Sache des Hochland gewesen waren und sich auf diesem Gebiet der Literaturkritik gegenüber dem Vorkriegs-Hochland Carl Muths und seinen heimatkunstkonzeptgeprägten Ausgangslagen67 manches wesentlich geändert hatte, soll abschließend an zwei Beispielen illustriert werden. Ich beginne anekdotisch: Der Germanist Paul Stöcklein war von Schöningh gebeten worden (oder hatte sich schon dazu bereit erklärt), zu der 1953 herauszubringenden Neuauflage von Carl Muths Essayband Schöpfer und Magier aus dem Jahr 1935 ein Vorwort zu schreiben. Stöcklein nimmt also zu diesem Behuf das Buch erneut in die Hand – und schickt Schöningh am 22.4.1953 eine Absage: Diesen Band könne er keinesfalls verantworten. „Dilettantische Starrheit“ und „primitive, hitzige Schulmeisterei“ seien da am Werk gewesen, „der Stil verdorrt“; Muth gehöre „zu jenen hochverdienten Geistern, zu denen die Geschichte spricht: Du hast Deine Schuldigkeit getan, tritt ab!“68 Die Pointe daran ist nicht, dass Stöcklein als Ersatzkandidaten Wilhelm Grenzmann und Clemens Heselhaus empfahl (der dann auch das Nachwort schrieb69). Die Pointe ist der handschriftliche Kommentar des Verlegers Heinrich Wild zu diesen brieflichen Äußerungen Stöckleins: „Sehr interessant, und wie richtig!“70 Mit anderen Worten: Da hatte sich etwas verändert, und zwar über eine Generation hinweg in der gemeinsamen Wahrnehmung der nächsten – Stöcklein und Heinrich Wild waren beide 1909 geboren, Carl Muth 1867. Muths Sicht schien ihnen plötzlich veraltet, überholt, während andererseits im Hochland selbst sowohl in der Auswahl der Mitarbeiter als auch in der der besprochenen Werke eine deutliche Ausweitung der Horizonte, eine Öffnung auch zu den Neuentdeckungen der Nachkriegszeit und hin zu den Jüngeren stattfand. Exemplarisch sichtbar wird diese Leistung einer kulturellen Modernisierung im Feld der Hochland-Literaturkritik in den Buchbesprechungen Wolfgang Grözingers (1902–1965), der von 1952 bis zu seinem Tod zwei- bis dreimal jährlich große Sammelrezensionen zum internationalen Roman der Gegenwart publizierte; Erwin Rotermund und Heidrun Ehrke-Rotermund haben sie 2004 unter dem Titel Panorama des internationalen Gegenwartsromans neu herausgegeben und mit einer Einleitung versehen.71 Es ist in der Tat ein eindrucksvolles Panorama, das sich da auftut: Von den deutschsprachigen Autoren nicht nur Bergengruen, Le Fort oder Edzard Schaper, sondern auch Andersch, Böll, Döblin, Grass, Heimito von Doderer, Hildesheimer, Walser, Max Frisch, Arno Schmidt; dann die Internationalen: Graham Greene, Norman Mailer, Bruce Marshall,72 Samuel Beckett, Jean Genet, Louis Aragon, Alain Robbe-Grillet, Giorgio Bassani, Halldór Laxness, Bruno Schulz, Elie Wiesel und viele andere; jeweils unter gegenwarts- und gegenstandsnahen Kategorien der Auswahl und Analyse wie Am Strom des Bewusstseins (April 1962), Vorzeichen des Erzählens (August 1962), Das Gefängnis Gesellschaft (Dezember 1962), Alternativen der Gestaltung (August 1963), Die Freiheit des Lesers (Dezember 1964) oder auch Verfolgte und Verfolger (August 1965); und hier kommt es dann zu jenem Hinweis der Herausgeber in ihrer Einleitung, der dazu auffordert, den vorhin angesprochenen Eindruck eines Desinteresses des Hochland am Schicksal der Exilierten jedenfalls im Literarischen vielleicht etwas zu korrigieren: „Überraschend angesichts der Integrationsprobleme rückkehrbereiter Exilautoren“ sei nämlich, dass deren Werke bei Grözinger „eine mindestens so große Rolle“ spielten wie die der jungen deutschen Autoren „und die Probleme von Emigration und Entfremdung immer wieder zur Sprache kommen“; das sei der Fall etwa bei Felix Braun, Elias Canetti, Leonhard Frank, Hans Henny Jahnn, Hermann Kesten, Werner Kraft, Klaus und Thomas Mann, René Schickele und anderen.73 – Gleichwohl: Als eine Wendung, die zur Parteinahme gegen die Konservativen und für einen avantgardistischen Modernebegriff zwänge, hat Grözinger und hat das Hochland diese Öffnung hin zur Gegenwartsliteratur nicht verstanden wissen wollen. Vielmehr schrieb er:
Ob ein Schriftsteller heutige Literatur macht, ist […] nicht nach der Modernität seiner Mittel zu beurteilen, sondern allein danach, ob er weiß, was er tut, und sich entschieden hat. Jeder Fortschritt in der Kunst ist mit Verlusten verbunden, die zuweilen größer sind als das Gewonnene. Wer bedeutende Inhalte zu vermitteln hat, wird vielfach den Preis der Allgemeinverständlichkeit nicht zu zahlen bereit sein, den die auf die Enge der Existenz zugeschnittenen modernen Formen von ihm fordern, und sich lieber traditioneller Darstellungsmittel bedienen. Die Übertragung der Kategorie des Fortschritts vom Felde der Technik, wo sie legitim ist, auf das Gebiet von Kunst und Literatur ist fragwürdig. Wo aus Verantwortung Traditionen bejaht werden, kann der ‚Fortschritt‘ auch in einem Zurückgreifen liegen, in einer freien Anerkennung übergeschichtlicher Bindungen.74
Versuchen wir ein abschließendes Fazit – mit Fragezeichen: „Pastorale Mummelgreise“ oder „Führer in der Welt des Geistes“? Das erste, eine Versammlung „pastoraler Mummelgreise“, war Hochland sicher nicht. Aber „Führer in der Welt des Geistes“? Wenn dieses Ansinnen pluralismustheoretisch nicht ohnehin fragwürdig ist, so hat Hochland zur Übernahme einer führenden publizistischen Rolle in den Debatten der Nachkriegszeit in seinem Gegenwarts- und Geschichtsverhältnis vielleicht etwas gefehlt, was der eingangs genannte Karlfried Gründer so pointiert hat: dass nämlich „Reflexion der Kontinuitäten“ nie etwas anderes sein könne als „Reflexion einer gebrochenen Kontinuität“.75 Solche Reflexion eines grundsätzlich veränderten Geschichtsverhältnisses mag es vereinzelt auch im Hochland gegeben haben; man müsste die Zeitschrift daraufhin noch einmal durchgehen. Profilbildend auf sie im Ganzen hat sie aber sicher nicht gewirkt; „50 Jahre ungebrochene Überlieferung 1903–1953“ lautete ja, wie erinnerlich, die Devise. Mit anderen Worten:
Die Zeitschrift fuhr dort fort, wo sie 1933 bzw. 1941 aufgehört hatte. […] Sie gehörte zu jenen Zeitschriften, die wie die Stimmen der Zeit und die Deutsche Rundschau Rudolf Pechels die Nachkriegssituation zu bewältigen suchten, indem sie im Hinblick auf Autoren, Themen und Aufmachung an ihre durch die Nationalsozialisten unterbrochene oder unterdrückte Arbeit anknüpften. Das war für traditionsreiche Blätter naheliegend und zunächst eine ausreichende Legitimation für die Herausgabe einer Nachkriegszeitschrift: Dadurch konnten möglicherweise verschüttete Werte für einen Neuanfang nutzbar gemacht werden.76
Anders als Hochland aber „gelang es den Stimmen der Zeit gerade dank ihrer jesuitischen Tradition, sich den Zeitfragen flexibel – für manchen zu flexibel – zu öffnen“ und „auch nach 1945 den Anschluss an aktuelle Diskussionen zu finden.“77