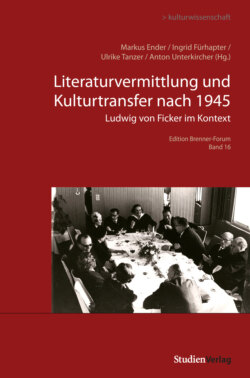Читать книгу Literaturvermittlung und Kulturtransfer nach 1945 - Группа авторов - Страница 14
Anmerkungen
Оглавление1 Dazu vgl. den Überblick bei Gerhard Hay, Hartmut Rambaldo u. Joachim W. Storck unter Mitarbeit von Ingrid Kußmaul und Harald Böck: „Als der Krieg zu Ende war“. Literarisch-politische Publizistik 1945–1950. Katalog zur Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller Nationalmuseum Marbach a.N. 1973.
2 Zum Ruf zuletzt Friedrich Kießling: Die undeutschen Deutschen. Eine ideengeschichtliche Archäologie der alten Bundesrepublik 1945–1972. Paderborn u.a. 2012, 48 u. 51f. (Gründungsgeschichte/Autorenkonstellationen), 78–80 u. 84 (intellektuelle Selbstbilder), 87f. (Sprache), 109f. u. 113f. (Literaturverständnis), 138–141 (Schulddebatte), 149, 152f., 159, 162f., 167f. (Staats-, Gesellschafts- und Demokratieverständnis), 179–181 (Modernedebatte), 192, 194–198, 213–217 (Vorstellungen von kulturellen und politischen Räumen), 226, 228–235 (Geschichte des Ruf in seiner Endphase), 285 (Skepsis gegenüber dem Grundgesetz).
3 Michel Grunewald: „Christliche Sozialisten“ in den ersten Nachkriegsjahren: Die Frankfurter Hefte. In: Ders. u. Uwe Puschner in Zusammenarbeit mit Hans Manfred Bock (Hg.): Le milieu intellectuel catholicque en Allemagne, sa presse es ses réseaux (1871–1963) / Das katholische Intellektuellenmilieu in Deutschland, seine Presse und seine Netzwerke (1871–1963). Bern u.a. 2006, 459–481; Kießling (Anm. 2), 21 u. 48f. (Gründungsgeschichte und Autorenkonstellationen), 72–76 u. 81f. (intellektuelle Selbstbilder), 157, 159f. u. 166 (gesellschaftspolitische Ordnungsvorstellungen), 177 u. 182 (Modernedebatte), 209–213 (politische Raumvorstellungen, Europakonzeption), 266–268 (Verhältnis zu den Entwicklungen in den 1960er Jahren), 270–276 (deren Einfluss auf die Sprache der FH), 284–292 (Skepsis gegenüber dem Grundgesetz und der Bundesrepublik bis in die 1970er Jahre hinein), 349–354 (Kontinuitäten der Modernekritik der Vorkriegs- und Nachkriegszeit bei Dirks und Kogon), 374f. u. 389–391 (Suche nach einem Dritten Weg zwischen Ost und West).
4 Dazu nach Doris von der Brelie-Lewien: Katholische Zeitschriften in den Westzonen 1945–1949. Ein Beitrag zur politischen Kultur der Nachkriegszeit. Göttingen, Zürich 1986, 68–74 u. 212f., ausführlicher erst wieder Volker Kapp: Ausbruch aus der Provinz Nürnberg und Öffnung für Europa. Das Bemühen der Zeitschrift Die Besinnung (1946–1985) um einen zeitnahen christlichen Humanismus. In: Walter Hömberg/Thomas Pittrof (Hg.): Katholische Publizistik im 20. Jahrhundert. Positionen, Probleme, Profile. Freiburg i. Br. u.a. 2014 (Rombach Catholica 3), 447–467.
5 Darüber Kießling (Anm. 2), 22, 44–47 (Autorenkonstellationen), 62–67 (intellektuelle Selbstbilder), 100f. (Sprache), 111 (Literaturverständnis), 120 (Traditionsbezüge) 126f., 132–138, 144–156 u. 160f., 164–167, 171, 174–177 u. 182–185, 189–194, 199, 201f., 207–209 u. 215 (Schlüsselthemen der Nachkriegsdebatten: Schuld, Staats- und Demokratieideen, Modernedebatte, politische Raumvorstellungen), 283 (Zurückhaltung gegenüber dem neuen Grundgesetz).
6 Kießling (Anm. 2), 22, 40–46, 53f. u. 246–257 (Gründungsgeschichte und Autorenkonstellationen), 67–71 u. 83f. (intellektuelle Selbstbilder), 88–90, 94–96, 101–103 u. 276–278 (Sprache), 112f. (Literaturverständnis), 119 u. 121–125 (Traditionsbezüge), 137f., 148 u. 162, 178 u. 181, 192f., 196, 197f. u. 205f. (Schlüsselthemen der Nachkriegsdebatten: Schuld, Verhältnis zu Weimar, Sozialismus u. Neoliberalismus, Kritik der Moderne, politische Raumvorstellungen), 284, 288 u. 290f. (Skepsis gegenüber Staat und politischem System der Bundesrepublik), 311f. (Demokratie und Dialog), 315–346 (Modernedebatte der 50er- und 60er-Jahre), 364–366, 371f., 378 (Verortung zwischen den Blöcken), 392–400 (Themen zu Beginn der 1970er-Jahre).
7 https://www.onb.ac.at/oe-literaturzeitschriften/Wort_und_Wahrheit (10.7.2018).
8 Zu ihr vgl. zuletzt Thomas Pittrof (Hg.): Carl Muth und das Hochland (1903–1941). Freiburg i. Br. u.a. 2018 (Rombach Catholica 4.1).
9 Zu ihm jetzt Knud von Harbou: Wege und Abwege. Franz Joseph Schöningh, Mitbegründer der Süddeutschen Zeitung. Eine Biographie. München 2013, bes. 74–92 („Das Hochland in den 1930er Jahren“) und 290–294 („Das neue Hochland“); Hans Günter Hockerts: Abstand oder Widerstand? Carl Muth und das Hochland im ‚Dritten Reich‘. In: Pittrof (Hg.) (Anm. 8), 427–443, bes. 432f. u. 442.
10 Franz Josef Schöningh: Carl Muth. Ein europäisches Vermächtnis. In: Hochland [im folgenden: HL] Bd. 39 (1946/47), 1–19, hier 19. Vgl. auch Schöningh brieflich am 27.5.1953 an Albert Béguin mit der Bitte um einen Beitrag („kollegialen Glückwunsch“) für das Jubiläumsheft der Zeitschrift im Oktober: „Die äußere Kontinuität der Zeitschrift ist zwar vom Nationalsozialismus unterbrochen worden, die geistige aber ungebrochen geblieben. Es dürfte nicht viele Zeitschriften in Europa geben, die das von sich sagen können.“ Gleichlautende Formulierungen in Briefen Schöninghs an Robert Graf d’Harcourt (27.5.1953) und Jean Ancelet-Mustache (27.5.1953), sämtlich überliefert im Verlagsarchiv des Kösel-Verlages an der UB der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Sigle: UBEI VA1), aus dessen umfangreichen Beständen der vorliegende Beitrag ebenso schöpft wie bereits ein früherer zum Nachkriegs-Hochland; vgl. Vf.: „Dieser Versuch ist leider insofern als gescheitert zu betrachten“: Das Ende von Hochland (1971) und neues hochland (1974) – Kennmarke(n) in der Geschichte des deutschen Nachkriegskatholizismus? In: Historisches Jahrbuch der Görres Gesellschaft Bd. 136 (2016), 7–36. Die Bestände sind erschlossen durch Christina Hofmann-Randall: Das Archiv des Verlages Kösel mit Schwerpunkt ab 1945. München 1993 (Kataloge der Universitätsbibliothek Eichstätt; IX. Verlagsarchive; Bd. 1). Einschlägig UBEI VA1 VII 3.1 Hochland-Korrespondenz 1937 bis 1966 (tatsächlich: 1937, 1953, 1956–58, 1966, mehr nicht überliefert), in UBEI VA1 VII 3.1(2) die zitierten Briefe wie ein weiterer Schöninghs an einen Professor Dr. Strothmann, Stanford University, vom 1.7.1953, mit gleicher Bitte, ähnlichen Formulierungen bezüglich des Hochland, dessen geistige Kontinuität: „die Pflege der abendländischen Kultur auf christlicher Grundlage [,] […] ungebrochen geblieben“ sei, und dem Zusatz: „So war das Hochland auch die erste Zeitschrift, die nach seinem Wiedererstehen im Jahr 1946 eine ausländische Parallelausgabe veranstalten konnte.“ Davon war bisher nichts bekannt.
11 Schöningh lud ihn brieflich am 9.1.1956 zur Mitarbeit ein (UBEI VA1 VII 3.1[3]), aufmerksam geworden durch einen „vorzüglich geschriebenen Beitrag“ Gründers (Schöningh ebenda) in der Zeitschrift Westfalen über Hamann in Münster. Karlfried Gründer (1928–2011) kam aus der einflussreichen Münsteraner Schule von Joachim Ritter, als dessen Assistent er bei ihm 1954 mit einer Arbeit über Johann Georg Hamann promoviert hatte; er wurde 1969 Mitherausgeber, 1976 Hauptherausgeber des von Ritter initiierten Historischen Wörterbuchs der Philosophie und Mitherausgeber des Archivs für Begriffsgeschichte. Sein Aufsatzband Reflexion der Kontinuitäten. Zum Geschichtsdenken der letzten Jahrzehnte (Göttingen 1982) sammelt Arbeiten aus den Jahren 1951/52 bis 1978.
12 So nennt ihn zu Recht Michael Habersack: Friedrich Dessauer (1881–1963). Eine politische Biographie des Frankfurter Biophysikers und Reichstagsabgeordneten. Paderborn u.a. 2011 (VKZG Reihe B; 119), 99.
13 Zu den Genannten Otto Weiß: Carl Muth und seine Redakteure. In: Pittrof (Hg.) (Anm. 8), S. 127–165.
14 Vgl. bspw. Hans Asmussen: Die Ökumene und die römisch-katholische Kirche (HL 42 [1949/50], 154-166); Heinz Flügel: Der Evangelische Bund (HL 43 [1950/51], 89–91); Heinrich Schlier: Die Einheit der Kirche (HL 44 [1951/52], 289–300); Heinrich Fries: Zur Theologie der Entmythologisierung (ebenda, 354–360); Franz Xaver Arnold: Rivalität oder Zusammenarbeit der Konfessionen? (HL 45 [1952/53], 1–14); Heinrich Fries: Karl Barth und die katholische Theologie (ebenda, 260–268, ein Referat des Buches von H.U. von Balthasar über Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie [Köln 1951]); Ders., Die Einheit der Theologie (ebenda, 474–476, über das Buch dieses Titels von Gottlieb Söhngen [München 1952]); Winfried Trusen: Die nichttheologischen Faktoren der Kirchenspaltung (ebenda, 185–188); Heinrich Fries: Probleme der evangelischen Theologie in der Gegenwart (HL 46 [1953/54], 468–497); Winfried Trusen: Protestantismus und Ostkirche (HL 46 [1953/54], 297–300); Hans Asmussen: Was uns Evangelischen an den Katholiken fremd ist (HL 47 [1954/55], 112–122, mit der Erwiderung von Franz Josef Schöningh: Müssen wir einander wirklich fremd sein? Brief an Hans Asmussen, ebenda, 235–243); Rudolf Ernst Skonietzki: Die Entstehung des Konfessionalismus. Zur Erinnerung an den Augsburger Religionsfrieden 1555 (HL 47 [1954/55], 513–531); Heinrich Fries: Die evangelische Michaelsbruderschaft (HL 48 [1955/56], 597–599); Werner Schöllgen: Der gute Wille und der rechte Weg. Gedanken zum „Evangelischen Soziallexikon“ (HL 48 [1955/56], 100–111); Joseph Lortz: Sind wir Christen tolerant? (HL 50 [1957/58], 430–445); Otto Karrer: Ökumenische Katholizität (HL 51 [1958/59], 297–314); dann im Konzilsjahr 1962 F.X. Arnold: Zeichen der Einheit. Die Eucharistie in ökumenischer Sicht (HL 55 [1962/63], 1–13) usw.
15 Clemens Bauer (1899–1984) und Schöningh kannten sich schon aus Schöninghs Münchener Studienzeit in den 1920er Jahren; daraus erwuchs eine lebenslange Freundschaft (Harbou [Anm. 9], 42f.). Bauer, ab 1962 erster Inhaber des neu geschaffenen Lehrstuhls für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. und deren Rektor in den Jahren 1962 und 1963, war seit 1924 Hochland-Beiträger (Karl Liebknecht. Ein Versuch. In: HL 21/2 [1924), 460–473) und schrieb dort auch den Nachruf auf Schöningh nach dessen Tod (Franz Josef Schöningh und das „Hochland“. In: HL 54 [1960/61], 198–208).
16 Zu dieser monumentalen Studie, einer schwer zu durchdringenden Summe, und ihrer Kontextualisierung vgl. Thomas Ruster: Christus Priester und König. Über das Gottesreich auf Erden nach Alois Dempf (1891–1982). In: Thomas Pittrof/Walter Schmitz (Hg.): „Freie Anerkennung übergeschichtlicher Bindungen“. Katholische Geschichtswahrnehmung im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts. Freiburg i. Br. u.a. 2010, 213–227.
17 Dempf empfahl auch einen seiner Schüler, den Philosophen Bernhard Lakebrink, für die Mitarbeit an der Abwehrschrift gegen Rosenbergs Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts. Vgl. dazu Wilhelm Neuß: Kampf gegen den Mythus des 20. Jahrhunderts. Köln 1947, 14, und danach Raimund Baumgärtner: Weltanschauungskampf im Dritten Reich. Die Auseinandersetzung der Kirchen mit Alfred Rosenberg. Mainz 1977 (VKfZG Reihe B 22), 154–165.
18 Vgl. dessen Würdigung durch Karl Thieme: Ein Anwalt der Wirklichkeit. Josef Pieper als Philosoph. In: HL 42 (1949/50), 284–295.
19 Zu dem bedeutenden Kultursoziologen und Renaissancehistoriker zuletzt Richard Faber/Perdita Ladwig (Hg.): Gesellschaft und Humanität. Der Kultursoziologe Alfred von Martin (1882–1979), Würzburg 2013; zuvor Volker Kruse: Historisch-soziologische Zeitdiagnosen in Westdeutschland nach 1945. Eduard Heimann, Alfred von Martin, Hans Freyer. Frankfurt/M. 1994, 100–140, u. Perdita Ladwig: Das Renaissancebild deutscher Historiker 1898–1933. Frankfurt/M. 2004, dort bes. 202–277. Alfred von Martin debütierte im Hochland 1923 (Evangelischer Objektivismus. In: HL 20/2 [1923], 63–73); es folgten eine Rezensionsnotiz über Kaisermystik – Kaisersymbolik – Kaiserromantik (HL 22/2 [1925], 246f.) sowie der wichtige Aufsatz Romantischer ‚Katholizismus‘ und katholische ‚Romantik‘ (HL 23/1 [1925/26], 315–337); ferner: Civitas Dei oder von der Leibwerdung des Geistes (HL 24/2 [1927], 87–92), eine Besprechung des Buches Civitas Dei (1926) von Edgar Salin, sowie die Rezension seiner eigenen Soziologie der Renaissance durch Heinrich Getzeny (HL 31/1 [1933/34], 182f; zu Getzeny das Biogramm von Otto Weiß in: Pittrof [Hg.] [Anm. 8], 542f., sowie ebenda, 269– 293, Marc Breuer: Soziologische Beobachtung der Religion? Der Soziologiediskurs im Weimarer Katholizismus am Beispiel der Zeitschrift Hochland, bes. 282–289); danach scheint v. Martin dort bis zur Einstellung der Zeitschrift 1941 nichts mehr veröffentlicht zu haben. Mit drei Beiträgen im ersten Hochland-Nachkriegsband 39 (1946/47) gehörte er dann jedoch wieder zu den Nachkriegs-Mitarbeitern der ersten Stunde: Abschied von der bisherigen Geschichte? (81–83), eine Reaktion auf das Buch dieses Titels von Alfred Weber; Geistige Wegbereiter des deutschen Zusammenbruchs, Studien zu Hegel (117–134), Nietzsche und Spengler (230–244), Teil seiner für die Hegner-Bücherei bei Kösel bestimmten Apostasie des Geistes, die aber dann 1948 bei Bitter in Recklinghausen unter dem Titel Geistige Wegbereiter des deutschen Zusammenbruchs erschien, und Zur Krisis des Menschentums (564–569), eine Kritik des Buches dieses Titels von Ludwig Paneth (Zürich 1946). Auch später blieb v. Martin präsent: Von der Menschlichkeit des Christenmenschen (HL 40 [1947/48], 434–454); Burckhardtiana (HL 42 [1949/50], 592–605; in diesem Band auch eine kurze Würdigung von v. Martins Buch Der heroische Nihilismus und seine Überwindung [381] in einem Aufsatz von Curt Hohoff über Ernst Jünger nach dem zweiten Weltkrieg [380–385]); Problematische Biographik (HL 44 ([1951/52], 280-282, zum zweiten Band der monumentalen Burckhardt-Biographie von Werner Kaegi); Thomas Mann und Nietzsche. Zur Problematik des deutschen Menschen (HL 46 [1953/54], 135–152); Zwischen Heilswissen und Herrschaftswissen (HL 47 [1954/55], 43–53); Jacob Burckhardt, groß gesehen (HL 49 [1956/57], 594–596, zu Kaegis drittem Burckhardt-Band); Eine ‚klassenlose‘ Gesellschaft (HL 52 [1959/60], 594); Über die geschichtliche Entwicklung der deutschen Soziologie (HL 53 [1960/61], 472–475), eine Besprechung von Schelskys Ortsbestimmung der deutschen Soziologie [Düsseldorf 1959], und zuletzt: Gesellschaft und Freiheit heute (HL 55 [1962/63], 489–504).
20 Zu ihm Harbou (Anm. 9), 81ff.
21 Zu ihm Habersack (Anm. 12).
22 Über sie das Biogramm von Otto Weiss in Pittrof (Hg.) (Anm. 8), 562–564.
23 Vgl. den Nachruf von Walter Hömberg auf ihn in: Publizistik Jg. 50 (2005) H. 4, 482–484, sowie ausführlicher Karl-Joseph Hummel: Otto B. Roegele (1920–2005). In: Jürgen Aretz/Rudolf Morsey (Hg.): Zeitgeschichte in Lebensbildern. Bd. 12. Münster 2007, 201–213.
24 Münster (1906–1998) ist ein interessanter Fall, nicht nur, weil er von 1945 bis 1949 gleichzeitig Mitherausgeber der Frankfurter Hefte war, sondern weil sich bereits in der Titelfolge seiner Bücher die veränderte Medialisierung des Katholischen in der Nachkriegszeit spiegelt: Er debütierte 1948 bei Piper in München mit einem Buch Dasein und Glauben, veröffentlichte 1949 bei Herder eine kunsthistorische Einführung Das Reich der Bilder, 1950 bei Kösel eine Untersuchung Mysterium und Apparat: Zur Fernsehübertragung des Meßopfers (!) und ebenfalls bei Kösel 1952 Mengen, Massen, Kollektive. Münster interessierte sich schon früh für das Fernsehen und wurde 1954 Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks, 1956 Vorsitzender der Fernsehprogrammkonferenz der Rundfunkanstalten (West-)Deutschlands. In beiden Funktionen wurde er eine prägende und einflussreiche Figur. Im Hochland lieferte er sich mit Guardini eine kleine Kontroverse über dessen Ende der Neuzeit (Bd. 44 [1951/52], 103–120). Vgl. den Artikel über C.M. im Munzinger-Archiv (online) sowie Knut Hickethier: Programmacher, Kulturtheoretiker, Organisator. Clemens Münster und seine Programmvorstellungen. In: Massenmedien und Kommunikation H. 73/74 (1991), 53–72.
25 Dazu Kießling (Anm. 2), 250–252.
26 Dokumentiert in UBEI VA1 I, Autorenkorrespondenz Theodor W. Adorno 1954–1961 (52 Schriftstücke). Für die Zitiererlaubnis aus diesen und den weiteren Beständen des Kösel-Verlagsarchivs danke ich der Universitätsbibliothek der KU Eichstätt-Ingolstadt.
27 Der Vorgang ist bekannt, allerdings bisher nur aus der Korrespondenz Adornos mit P. Suhrkamp (hg. von Wolfgang Schopf: „So müßte ich ein Engel und kein Autor sein“. Adorno und seine Frankfurter Verleger. Der Briefwechsel mit Peter Suhrkamp und Siegfried Unseld. Frankfurt/M. 2003, dort die Briefe Nr. 65, 78 u. 82), nicht aus der Autorenkorrespondenz Adornos mit dem Kösel-Verlag. Aus ihr geht hervor, dass die Initiative bei Kösel von Friedhelm Kemp kam. Ohne dass er etwas von den Verlagsplänen (und deren Verzögerungen) bei Suhrkamp wusste, regte er als „großer Bewunderer der essayistischen Arbeiten von Walter Benjamin“ am 23.3.1954 briefl. bei Adorno eine einbändige Benjamin-Ausgabe an (UBEI VA1 I, Autorenkorrespondenz Adorno). Eine (zu kurz greifende) Auseinandersetzung mit Benjamin anlässlich der zweibändigen Ausgabe seiner Schriften, die sich ausschließlich mit der Frage beschäftigt, warum Benjamin Kommunist geworden sei, erschien in HL 49 (1956/57), 268–273 (Friedrich A. Hansen-Löve: Zwischen Gestern und Heute. Zu den Schriften Walter Benjamins).
28 Adorno an den Bayerischen Staatsminister für Unterricht und Kultus Prof. Dr. Rucker, 19.4.1955 (UBEI VA1 I, Autorenkorrespondenz Adorno).
29 So Richard Faber: Das Frankfurter Feld. Versuch eines Überblicks. In: Ders./Eva-Maria Ziege (Hg.): Das Feld der Frankfurter Kultur- und Sozialwissenschaften vor 1945. Würzburg 2007, 15–46, hier 20 (Anm. 6).
30 Adorno an Heinrich Wild, 25.2.1957 (UBEI VA1 I, Autorenkorrespondenz Adorno).
31 So Adorno in einem weiteren Brief an Heinrich Wild, 21.3.1955 (UBEI VA1 I, Autorenkorrespondenz Adorno). Der „hervorragend begabte Jesuitenschüler“ war Karl Heinz Haag (1924–2001). Seine Habil.schrift Kritik der neueren Ontologie erschien 1960 bei Kohlhammer (Stuttgart).
32 Adorno an Wild, 25.2.1957, ebenda.
33 Adorno an Wild, 6.6.1957, ebenda.
34 Geb. am 11.9.1903 als Sohn einer katholischen Mutter, war Adorno am 4. Oktober im Frankfurter Dom katholisch getauft worden, wurde aber dann in der Frankfurter Katharinenkirche im Mai 1918 evangelisch konfirmiert. Vgl. Stefan Müller-Doohm: Adorno. Eine Biographie. Frankfurt/M. 2003, 926 (Taufe), und Lorenz Jäger: Adorno. Eine politische Biographie. München 2003, 23 (Konfirmation). „In dem Fragebogen, den Adorno vor seiner Übersiedlung nach Oxford 1934 ausgefüllt hat, antwortete er auf die Frage: ‚Willigen Sie ein, daß wir für Sie an religiöse Gemeinschaften herantreten?‘ ‚Please no. I am without any touch with ‚positiv‘ religions.‘“ Müller-Doohm, ebenda, 748.
35 Also um 1924; das sind die Jahre der Hochblüte des Weimarer Kulturkatholizismus mit der Wiederbegegnung von Kirche und Kultur in Deutschland, wie der Titel der Carl Muth zum 60. Geburtstag von den Hochland-Redakteuren Max Ettlinger, Philipp Funk und Friedrich Fuchs gewidmeten Festschrift (München 1927) lautet. Zu Begriff und Phänomenbestand vgl. Otto Weiß: Kulturkatholizismus. Katholiken auf dem Weg in die deutsche Kultur 1900–1933. Regensburg 2014, passim.
36 Theodor W. Adorno/Ernst Krenek: Briefwechsel. Hg. von Wolfgang Rogge. Frankfurt/M. 1974, 46. Ich verdanke den Hinweis auf diesen Brief Wolf Gerhard Schmidt (Bayreuth). Ebenfalls zitiert bei Müller-Doohm (Anm. 34), 748.
37 Adorno an Heinrich Wild, 15.11.1954 (siehe nachfolgende Anm. 38).
38 HL 45 (1952/53), 365; auch zitiert bei Alex Demirovič: Zwischen Nihilismus und Aufklärung. Publizistische Reaktionen auf die Minima Moralia. In: Kritische Theorie und Kultur. Hg. von R. Erd, D. Hoß, O. Jacobi u. P. Noller. Frankfurt/M. 1989, 153–170, hier 164f., und bei Müller-Doohm (Anm. 34), 519. Adorno erkundigte sich nach dieser Besprechung brieflich am 14. April 1953 bei Peter Suhrkamp („Im Hochland soll ein großer Aufsatz über die Minima Moralia erschienen sein – könnte ich den haben?“, in: Schopf [Hg.] [Anm. 27], 82), erhielt aber von dort keine Antwort, so dass auf eine weitere Nachfrage Adornos bei Heinrich Wild hin dieser ihm am 9.10.1954 ein Exemplar des Hochland-Hefts mit Krings’ Besprechung schickte mit der Bitte, „Ihre Meinung über diese Besprechung zu erfahren“. Adornos Reaktion: „Rundheraus gesagt, diese Besprechung scheint mir bei weitem das Verständnisvollste und Bedeutendste, was zu meinem Buch gesagt worden ist, und Sie haben mir damit eine ganz ungemeine Freude bereitet. Ich verkenne gewiß nicht die Divergenz der Ausgangs- oder sollte man sagen Endpositionen, aber ich bin zu hoffnungslos von Hegel verdorben, um aus dem Begriff des ‚Standpunkts‘ allzuviel zu machen. Ich glaube, daß, da es nur eine Wahrheit gibt, vor jeder vollzogenen Einsicht die Standpunkte in nichts zergehen. Und es wäre wahrscheinlich viel wichtiger, das zu entfalten, als bei der Auseinandersetzung bloßer Standpunkte zu beharren. Daß ich damit nicht einer synkretistischen Vermittlung das Wort rede, versteht sich von selbst.“ (Adorno an Heinrich Wild, 15.11.1954. UBEI VA1 I, Autorenkorrespondenz Adorno.) Von dieser Zustimmung wusste aber Wild inzwischen schon durch einen Brief von Karl Thieme, der ihm am 29.10.1954 mitgeteilt hatte, „daß Herr Adorno mir neulich seine hohe Wertschätzung der im Hochland erschienenen Kringsschen Besprechung seiner Minima Moralia aussprach, einer der seriösesten, die ihm überhaupt vor Augen gekommen seien, – übrigens erst durch Ihre persönliche Vermittlung, d.h. merkwürdigerweise nicht schon längst durch seinen Verlag. Ich erlaubte mir, ihm zu sagen, daß ich dabei die Hand im Spiele hatte, was er längst vermutet zu haben erklärte. Daß eine erste Fassung von Krings wesentlich weniger zugänglich gewesen war, habe ich natürlich nicht erwähnt […]“ (UB EI VA1 I, Autorenkorrespondenz Thieme). Thieme selbst wiederum – „der bekannte katholische Theologe Karl Thieme“ (Adorno an Peter Suhrkamp in: Schopf [Hg.] [Anm. 27], 165) – besprach die Minima Moralia in den Frankfurter Heften (Jg. 6, H. 12 [1951], 944–946: „Apokalypse unserer Zeit“), interessierte sich auch für Adornos Wagner-Buch und schrieb eine Rezension seiner Kierkegaard-Arbeit. Im übrigen hatte Thieme bereits 1932 im Hochland eine Auseinandersetzung mit dem Werke Bertold Brechts (Des Teufels Gebetbuch? In: HL Bd. 29/1 [1931/32], 397–413) veröffentlicht, von der Brecht in einem Brief Ende Juni 1940 schrieb: „Es gibt nichts Anständiges über meine neueren Arbeiten, über die alten“, womit er vor allem die Hauspostille meinte, „nichts außer dem Essay eines Jesuitenpaters in der Zeitschrift ‚Hochland‘“ (zit. nach Michael Morley: Bertold Brechts Hauspostille. In: Brecht-Handbuch in fünf Bänden. Hg. von Jan Knopf. Bd. 2: Gedichte. Stuttgart, Weimar 2001, 147-161, hier 159). „Warum er diesem Essay so positiv geneigt ist, lässt sich unschwer aus der Argumentation Thiemes folgern; denn dieser Jesuitenpater [der Thieme nicht war, TP] nimmt sich auch nicht so ernst, wie er die Dinge – hier das Etikettieren des Bandes als ‚des Teufels Gebetbuch‘ – und das Glaubenssystem des Autors nimmt.“ (Morley, ebenda) So ganz stimmt das freilich nicht, wenn man sich nur die letzten Sätze aus der Besprechung Thiemes vor Augen führt: „Ein Werk, das uns zur fruchtbarsten Selbstbesinnung bringt, können wir nicht als satanisch bezeichnen, mag es auch noch so antichristlich sein: der Teufel läßt uns nie zu uns kommen! Freilich ist es auch keineswegs so, daß wir uns vor Herrn Brecht an die Brust zu klopfen hätten, wie es uns früher soziale Elendsdichter zumuteten; vielmehr haben wir in ihm – und auf dem Feld der Dichtung in ihm zuerst – den konkreten Gegner gefunden, mit dem man wieder reden, dem gegenüber man wirklich argumentieren, ja von dem man lernen kann, der mit der christlichen Kirche wieder in ihrer eigenen Sprache zu streiten begonnen hat; und ganz abgesehen von der Einschätzung seiner privaten Person, wird er dadurch geschichtlich bedeutsam. An die Stelle unendlicher Ausflüchte setzt er den konkreten Widerspruch; die Fragen von öffentlicher Bedeutung, die er aufwirft, sind wieder Fragen, die den Christen wirklich angehen; die unendliche Diskussion nimmt schließlich doch ein Ende, und das ernsthafte Gespräch kann beginnen.“ (HL 29/1, 413, Hervorhebungen durch Sperrung im Original.) Das ist eine merkwürdige Gestalt dezisionistischer Dialogik.
39 Die aufgrund eher stichprobenartiger Befunderhebungen letztlich nicht entschieden beantwortete Frage dieses Beitrags lautet, ob, und wenn ja, welchen Beitrag das Hochland der Nachkriegszeit zu den Gründungsdebatten der Bundesrepublik, den „Ideen von 1945“ (Kießling [Anm. 2], passim), und damit zur Intellektuellengeschichte der Nachkriegsmoderne geleistet hat. Zwar hat schon 1953 der passionierte, damals erst 22-jährige Hochland-Leser Hans Maier, „wenn von geistiger Wegweisung und Orientierung die Rede sein soll“ bezüglich des Hochland „aus der Fülle des Wertvollen und nicht selten Hervorragenden besonders hervorgehoben die Reden Romano Guardinis über den Frieden [HL 41 (1948/49), 105–122] und über die jüdische Frage [HL 44 (1951/52), 481–493], Josef Piepers glänzende[n] Essay Der Funktionär und der Sophist [HL 43 (1950/51), 421–443] und das Zwiegespräch über den Don Quichote von Wilhelm Hausenstein [HL 39 (1946/47), 193–215].“ (Hans Maier: 50 Jahre Hochland. Bildnis einer Zeitschrift [1953]. Wiederabgedruckt in: Pittrof [Hg.] [Anm. 8], 577-591, hier: 589.) Gleichwohl verschickte bereits in diesem Jubiläumsjahr 1953 Schöningh an einen ausgewählten Adressatenkreis Briefe mit der Einladung zu einem „kritischen Symposion über die weitere Entwicklung des Hochland“, das vom 27. bis 29.11. auf der Hegge bei Paderborn, der von Theodor Kampmann gegründeten Bildungsstätte, stattfinden und „der künftigen Gestaltung des Hochland dienen“ sollte (Schöningh an Josef Höfer, 18.11.53, UBEI VA1 VII 3.1[2]). Zeichnete sich da schon die Notwendigkeit einer Kurskorrektur ab, trotz so prominenter katholischer Autoren wie Guardini und Pieper? Wenn diese Frage hier im Ganzen unbeantwortet bleibt, so soll gegenüber dieser Prominenz des Katholischen am Beispiel Adornos und Blumenbergs aufmerksam gemacht werden auf die Latenz des Katholischen in der Intellektuellengeschichte der Bundesrepublik.
40 Neuerdings wieder abgedruckt in Hans Blumenberg: Schriften zur Literatur 1948–1958. Hg. von Alexander Schmitz und Bernd Stiegler. Berlin 2017, darin: Der absolute Vater (zuerst HL 45 [1952/53], 109–114); Eschatologische Ironie. Über die Romane Evelyn Waughs (HL 46 [1953/54], 132–146); Die Peripetie des Mannes. Über das Werk Ernst Hemingways (HL 48 [1955/56], 219–238); Rose und Feuer. Lyrik, Kritik und Drama T.S. Eliots (HL 49 [1956/57], 239–263); Mythos und Ethos Amerikas im Werk William Faulkners (HL 50 [1957/58], 265–286). Zu diesen Texten jetzt Joe Paul Kroll: Wilde Palmen. Hans Blumenbergs frühe Feuilletons in der Zeitschrift Hochland. In: Zeitschrift für Ideengeschichte 3 (2016), 107–111, sowie vor allem Kurt Flasch: Hans Blumenberg: Philosoph in Deutschland. Die Jahre 1945 bis 1966. Frankfurt 2017.
41 Zur Dissertation (Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit der mittelalterlich-scholastischen Ontologie [Typoskript, 92 S., bish. ungedr., Publ. angekündigt bei Suhrkamp für Juni 2020] und zur Habilitationsschrift (Die ontologische Distanz. Eine Untersuchung zur Krisis der philosophischen Grundlagen der Neuzeit, gleichfalls noch ungedruckt) umfassend-konzis Flasch (Anm. 40), 57–159 u. 161–204.
42 Bd. 56, 413–430.
43 Frankfurt/M., 114, hier mit Bezug auf Gracian. (Meint Blumenberg wirklich „Realismus“ oder doch nur ‚Wirklichkeit‘?)
44 Zu ihm Heinz Hürten: Waldemar Gurian. Ein Zeuge der Krise unserer Welt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mainz 1972 (VKZG Reihe B 11). Ein Nachruf auf ihn von Georg Smolka erschien in HL 48 (1955/56), 183–185. Gurian schrieb im Hochland eine Besprechung von Hanna Arendts The Origins of Totalitarianism (New York 1951) (Bd. 44 [1951/52], 568–569), aus dessen englischer Fassung im gleichen Band ein Ausschnitt in deutscher Übersetzung abgedruckt wurde (Das zeitweilige Bündnis zwischen Mob und Elite. Ebenda, 511–524).
45 Exemplarisch in dieser Hinsicht Vita und Schicksal Franz B. Steiners, dargestellt in dem kurzen Nachruf auf ihn von H. G. Adler (HL 46 [1953/54], 112): „Franz B. Steiner, als Sohn jüdischer Eltern 1909 in Prag geboren, wurde schon zu Beginn seiner Laufbahn durch den Nationalsozialismus seines natürlichen Wirkungsfeldes beraubt. Nach seiner Promotion setzte er seine Studien, die sich immer mehr auf Soziologie konzentrierten, in London fort. Die Tragödie der Tschechoslowakei zwang ihn, als Flüchtling in England zu bleiben und untätig zuzusehen, wie sein leidender alter Vater und seine Mutter in der Heimat 1942 Opfer ihrer Volkszugehörigkeit wurden. Der Dichter, zart von Konstitution, arbeitete während des Krieges wissenschaftlich und künstlerisch weit über seine geringen Kräfte. Es gelang ihm infolge seiner Kränklichkeit nicht, an die führenden Kreise der literarischen Emigration heranzukommen und nach dem Krieg in Deutschland Anschluß zu gewinnen. Als endlich 1948 ein Gedichtband in einem deutschen Verlag erscheinen sollte, versagten diesem im letzten Augenblick die Mittel, so daß der fertiggestellte Satz eingeschmolzen werden mußte. Mittlerweile war Steiners Krankheit so fortgeschritten, daß er den Kampf um die Durchsetzung seines Werkes nicht mehr weiterführen konnte. Am 27. November 1952 ist er seinem Leiden erlegen. Neben der reichen wissenschaftlichen Ausbeute (meist in englischer Sprache) hat er rund dreihundert Gedichte, den tiefsinnigen Zyklus ‚Eroberungen‘ und mehrere Bände Aufzeichnungen hinterlassen.“
46 Ulrich Lehner: [Art.] Gürster, Eugen. Erscheint in Thomas Pittrof (Hg.): Handbuch des literarischpublizistischen Katholizismus im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts, Bd. I (projektiert für 2021).
47 Das Schöne und das Nichts. Die Welt Gottfried Benns (HL 47 [1954/55], 310–321); „La condition humaine“ – in Port-Royal und in China (ebenda, 478–480); Dichter der kategorischen Leidenschaft. Henri de Montherland (HL 48 [1955/56], 528–540).
48 Lehner (Anm. 46), ebenda.
49 Peter de Mendelssohn: Ein militanter Traditionalist. Gedenkwort für Eugen Gürster (1895–1980). In: Jahrbuch der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 1980, 111f.
50 Vgl. sein Biogramm von Otto Weiß in: Pittrof (Hg.) (Anm. 8), 548f.
51 Vgl. Karl Schaezler: Das „Hochland“ und der Nationalsozialismus. In: HL 57 (1964/65), 221–231, hier: 225 Anm. 12.
52 HL 45 (1952/53), 446–454; später, anlässlich seines 80. Geburtstags, ergänzt um den Abdruck seiner Kinderjahre in Rußland (HL 56 [1963/64], 438–448).
53 HL Bd. 47 (1954/55), 597.
54 Zu Thieme, der nicht nur zu Adorno, sondern schon in den 1930er Jahren auch zu dem gleichfalls exilierten Walter Benjamin Beziehungen unterhielt und wiederholt auf dessen Arbeiten, so 1934 in seinem Buch Das alte Wahre. Eine Bildungsgeschichte des Abendlandes, auf Benjamins Trauerspiel-Buch, aufmerksam gemacht hatte (Das alte Wahre. Leipzig 1934, 180; vgl. auch Benjamin-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Hg. von Burkhardt Lindner unter Mitarbeit von Thomas Küpper und Timo Skrandies. Stuttgart, Weimar 2006, 443–445, 499, 563 u. 680; Walter Benjamin: Gesammelte Briefe. Hg. vom Theodor W. Adorno Archiv. Bd. 4–6. Hg. von Christoph Gödde und Henri Lonitz Frankfurt a.M. 1998/1999/2000; dort in Bd. 6, 623 s.v. Thieme, Karl), bereits Anm. 38. Eine Darstellung Thiemes, die auch seinen Nachlass im Münchener Institut für Zeitgeschichte auszuwerten hätte, ist angesichts der Vielbezüglichkeit dieser Figur ein dringendes Desiderat. Vgl. den Artikel über ihn von F.W. Graf in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon Bd. 11 (1996), Sp.1113–1131; Wolf-Friedrich Schäufele: „Deutscher unter Deutschen“? Karl Thieme (1902–1963) zwischen Luthertum, Katholizismus und Judentum. In: Tobias Sarx/Rajah Scheepers/Jochen-Christoph Kaiser (Hg.): Protestantismus und Gesellschaft. Beiträge zur Geschichte von Kirche und Diakonie im 19. und 20. Jahrhundert. Stuttgart 2013, 239–250.
55 Referiert von Elias H. Füllenbach: Die Kirche Christi und die Judenfrage (1937). In: Wolfgang Benz (Hg.): Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Bd. 6: Publikationen. Berlin u.a. 2013, 400–403.
56 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Thieme_(Historiker)&oldid=170030186, abgerufen am 8.1.2018. Zu Ehrlich jetzt Hans Maier: Ernst Ludwig Ehrlich und die deutschen Katholiken. In: Herder Korrespondenz Bd. 71 (2017), H.10, 34–38.
57 Walter Lipgens: Christen und Juden heute. In: HL 51 (1959), 285–289.
58 Vgl. Heinz Flügel: Boten Gottes. In: HL 40 (1947/48), 76–80, hier 76. – Die Formel ist ersichtlich problematisch. Was – signifikant? – unterschiedliche Stile der Thematisierung betrifft, so riskiere ich die – inhaltlich zweifellos kurzschlüssige – Konfrontation Flügels mit den beiden ersten Sätzen im Aufsatz des langjährigen Hochland-Autors Eugen Rosenstock-Huessy über Die jüdischen Antisemiten oder Die akademische Form der Judenfrage (Frankfurter Hefte Jg. 6, H. 1 [Januar 1951], 8–17), der das „Geheimnis der Ausgesondertheit“ (Flügel) (Anm. 58) dorthin zurückverlegt, wo er es als offene Tatsache auffindbar findet: „Antisemitismus ist ein akademischer Ausdruck. Er stammt aus der Sprache des Humanismus“ (ebenda, 8). Zum theologie- und zeitgeschichtlichen Hintergrund vgl. die Arbeiten von Elias H. Füllenbach O.P.: Shock, Renewal, Crisis. Catholic Reflections on the Shoa. In: Kevin P. Spicker (Hg.): Antisemitism, Christian Ambivalence, and the Holocaust. Bloomington/Indiana 2007, 201–234; Ders.: Das katholisch-jüdische Verhältnis im 20. Jahrhundert. Katholische Initiativen gegen den Antisemitismus und die Anfänge des jüdisch-christlichen Dialogs in Deutschland. In: Reinhold Boschki/Albert Gerhards (Hg.): Erinnerungskultur in der pluralen Gesellschaft? Neue Perspektiven für den christlich-jüdischen Dialog. Paderborn u.a. 2010, 143–163; Ders.: „Freunde des alten und des neuen Gottesvolkes“. Theologische Annäherungen an das Judentum nach 1945. In: Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte Bd. 32 (2013), 235–251.
59 Beispiele (neben dem in Anm. 39 genannten Beitrag von Guardini) E. G. (Eugen Gürster): Friedenskämpfer im heutigen Israel (HL 48 [1955/56], 488–491); Heinz Flügel: Das Beispiel Theresienstadt (HL 49 [1956/57], 90–92), eine Besprechung der Monographie Theresienstadt 1941–1945 von H. G. Adler [Tübingen 1955]); Gerty Spies: Wie ich es überlebte. Ein Bericht (HL 50 [1957/58], 350–360); Friedrich Abendroth: Reichs- und Bundesvolk. Das zweifache Zeugnis des Joseph Roth (HL 50 [1957/58], 422–429); Karl Thieme: Franz Rosenzweig. Zum Gespräch zwischen Judentum und Christentum (HL 50 [1957/58], 142–152); Hermann Graml: Die Wurzeln des Antisemitismus (HL 50 [1957/58], 371–375); Walter Lipgens: Zur Geschichte des christlich-jüdischen Gegenübers (HL 54 [1961/62], 381–385); Karl Josef Dieckmann: Antisemitismus im Evangelium? (HL 57 [1964/65], 383–86); Heinrich Spaemann: Die Christen und das Volk der Juden (ebenda, 409–427); Wolfgang Seiferth: Synagoge und Ecclesia (HL 56 [1963/64], 470–472).
60 Ausnahmen etwa: Elias Hurwicz über „Die ‚Verweltlichung‘ des Judentums“ (HL 43 [1950/51], 263– 273; in demselben Band die Erinnerungen von Werner Kraft an Else Lasker-Schüler [588-592]); Elias Hurwicz: Die Theomachie im Judentum (HL 44 [1951/52], 416–431); Ders.: Leo Baecks posthumes Werk (HL 51 [1958/59], 391–394).
61 Nachgedruckt mit weiteren Aufsätzen zum Thema und einem „historiographischen Rückblick“ von Karl-Egon Lönne in Ernst-Wolfgang Böckenförde: Schriften zu Staat – Gesellschaft – Kirche Bd. 1: Der deutsche Katholizismus im Jahr 1933. Freiburg i. Br. u.a. 1988, 39–69. Böckenförde widmete übrigens diesen Band dem Gedächtnis Schöninghs (dessen Neffe er war) als „Erinnerung an einen Mann, dem nicht nur der Verfasser, sondern auch der deutsche Katholizismus viel verdankt. Franz-Joseph [sic] Schöningh war von 1946 bis zu seinem Tode 1960 Herausgeber und Hauptschriftleiter der Zeitschrift Hochland. Als solcher wirkte er als Sachwalter eines im Grundsatz festen und gerade deshalb der Welt gegenüber offenen Katholizismus, der die Zeichen der Zeit aufnahm und darauf zu antworten suchte. Hochland war Organ und Kristallisationspunkt eines solchen Katholizismus im deutschen Sprachraum, und es praktizierte das freie Wort in der Kirche – um der Kirche willen. Jeder Band der Zeitschrift, die Themen, die sie behandelte, und die Autoren, die in ihr schrieben, legen davon Zeugnis ab. Der Katholizismus in Deutschland ist ärmer geworden, seit es Hochland nicht mehr gibt. Muß es eigentlich dabei bleiben?“ (Einleitung, ebenda, 19.) Zu Böckenfördes Aufsatz, seiner Vorgeschichte und seinen Folgen vgl. jetzt auch die gründliche, u.a. auf die Eichstätter Archivbestände zurückgreifende Studie von Mark Edward Ruff: Ernst-Wolfgang Böckenförde und die Auseinandersetzung um den deutschen Katholizismus, 1957–1962. In: Hermann-Josef Große Kracht/Klaus Große Kracht (Hg.): Religion – Recht – Republik. Studien zu Ernst-Wolfgang Böckenförde. Paderborn u.a. 2014, 41–75.
62 So die „Vorbemerkung der Schriftleitung“ zum Brief über die Kirche in: Frankfurter Hefte, 1. Jg., H. 8, 715. – Eine (positive) Besprechung von Görres’ Buch Die leibhaftige Kirche (Frankfurt/M. 1950, 3. Aufl. bereits ein Jahr später) erschien in HL 43 (1950/51), 303f.
63 Kießling (Anm. 2), 220.
64 Das ist dokumentiert im Anhang zu Pittrof (Anm. 10), 21ff.
65 Zu ihm Johannes Werner: W. H. Ein Lebenslauf. München 2005.
66 Das „Verzeichnis der Werke von Gustav René Hocke“ im Anhang zu seinen Lebenserinnerungen (Im Schatten des Leviathan. Lebenserinnerungen 1908–1984. Hg. u. kommentiert von Detlef Haberland. Berlin 2004), 673–697, nennt folgende Beiträge: Das langobardische Cividale (HL 45 [1952/53], 290f.); Manzùs Bronzepforte für Sankt Peter (HL 48 [1955/56], 91–93); Das neue Bronzeportal am Campo Santo Teutonico (HL 52 [1959/60], 92–95).
67 Dazu die gründlichen Arbeiten von Maria Cristina Giacomin seit ihrer Diss. Zwischen katholischem Milieu und Nation. Literatur und Literaturkritik im Hochland (1903–1918), Paderborn u.a. 2009, zuletzt: Ein „goldener Mittelweg“ zwischen Kirche und moderner Welt? Carl Muth und das Hochland 1903–1914. Mit einem Exkurs zur Gründungsgeschichte des Hochland. In: Pittrof (Hg.) (Anm. 8), 35–69.
68 Paul Stöcklein an Franz Josef Schöningh, 22.4.1953. UBEI VA1 VII 3.1(2).
69 Carl Muth: Schöpfer und Magier. Drei Essays. Zweite, um ein Nachwort vermehrte Auflage. München 1953.
70 Wie Anm. 68 (mit Rotstift).
71 Paderborn u.a. 2004.
72 Diese Öffnung hin zur modernen angloamerikanischen Literatur hatte Schöningh noch zu Lebzeiten Carl Muths durch Curt Hohoff betrieben. „Hohoff war Anglist und konnte ihm so junge Autoren vorschlagen, unter anderem Gerard Manley Hopkins, T. S. Eliot, den damals noch unbekannten Joseph Conrad und Eugene O’Neill. Die Reaktion blieb verhalten: ‚Das Kopfschütteln der Leser begann bei Karl Muth.‘“ Harbou (Anm. 9), 82, unter Zitat von Curt Hohoff: Unter den Fischen. Erinnerungen an Männer, Mädchen und Bücher 1934–1939. München 1962, 228–239, hier 233.
73 Erwin Rotermund und Heidrun Ehrke-Rotermund: Vorstellung eines vergessenen Dichters. In: Dies. (Hg.) (Anm. 71), 15–50, hier 15f.
74 Zit. ebenda, 19.
75 Perspektiven für eine Theorie der Geschichtswissenschaft. In: Gründer (Anm. 11), 88–103 u. 158–162, hier: 99.
76 Brelie-Lewien (Anm. 4), 61.
77 Ebenda, 63.