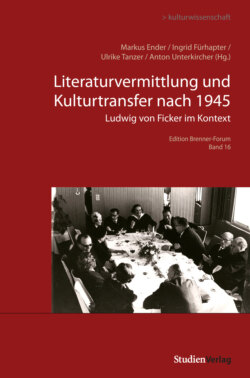Читать книгу Literaturvermittlung und Kulturtransfer nach 1945 - Группа авторов - Страница 7
Ludwig von Ficker im Kontext
ОглавлениеAm 20. März 2017 jährte sich der Todestag Ludwig von Fickers, des Herausgebers der Innsbrucker Kunst- und Kulturzeitschrift Der Brenner (1910–1954), zum fünfzigsten Mal. Dieser Jahrestag erfuhr allerdings – im Gegensatz zu so manch anderem Todestag verdienter Persönlichkeiten des kulturellen Lebens1 – nur sehr geringe mediale Aufmerksamkeit. Tatsächlich legte das mäßige Interesse den Schluss nahe, dass die Öffentlichkeit in den vergangenen fünf Jahrzehnten die vielfältigen Tätigkeiten des Innsbrucker Schriftstellers, Verlegers, Mäzens und Publizisten, der bis in die späten 1960er Jahre das kulturelle Leben Tirols und Österreichs beeinflusste, immer stärker aus den Augen verloren hatte. Der Versuch einer Rückführung des weitgehend Vergessenen in das kollektive Bewusstsein der Gegenwart erschien deshalb – zumindest auf wissenschaftlicher Ebene – als Gebot der Stunde. Am 20. März feierte auch Walter Methlagl, der langjährige Leiter des Brenner-Archivs, seinen 80. Geburtstag. Mit dem Beitrag von Gerald Stieg wurde der Festvortrag zu diesem Anlass aufgenommen.
Die vom 20. – 22. März 2017 am Forschungsinstitut Brenner-Archiv durchgeführte internationale Tagung versuchte in ihrer Grundkonzeption, dem Geist Fickers als Genius Loci zu entsprechen und aus diesem Grund zwei zentrale Wirkungsprinzipien, die der Brenner-Herausgeber zeitlebens stets gepflogen hatte, zu berücksichtigen: Zum einen hatte Ficker, seiner persönlichen Neigung entsprechend, die teils aus seinem Naturell, teils aus Überlegung begründet war, seine Arbeit stets weitgehend in den Hintergrund gestellt und anderen Protagonist*innen die kulturelle Bühne überlassen. So sollte er auch anlässlich der Tagung nicht ausschließlich im Vordergrund stehen und mit hagiographischen Würdigungen bedacht werden. Die Intention der Veranstaltung bestand vielmehr darin, die Vermittlerpersönlichkeit Ficker und seine Arbeit in ein dichtes Geflecht von ähnlich gelagerten kulturellen Vermittlungsprozessen eingebunden wahrzunehmen und abzubilden. Zum anderen schätzte und praktizierte Ficker zeitlebens den Wert der Kommunikation, des Miteinander-ins-Gespräch-Tretens, sei es nun brieflich oder von Angesicht zu Angesicht. Diese Praxis wurde von ihm – eine entsprechende Gesprächsbasis vorausgesetzt – in bester sokratischer Tradition gepflegt. Auch diesem Prinzip wurde bei der Gestaltung des Tagungsprogramms Rechnung getragen: Die Vielzahl von Stimmen und Diskursen, die im Rahmen der Fachvorträge, der künstlerischen Darbietungen, auf der Fahrt zu Fickers ehemaliger Wohnstätte in Mühlau und zu seinem Grab auf dem Mühlauer Friedhof, auf dem er Seite an Seite mit Georg Trakl begraben liegt, aber auch abseits in den Rand- und Pausengesprächen zu hören waren, trugen zu einer positiv-produktiven Polyphonie bei.
Nach der Überwindung der nationalsozialistischen Diktatur nahm Ludwig von Ficker seine Vermittlertätigkeit, die er zwölf Jahre nach außen hin unterbrochen hatte, außenwirksam mit der Veröffentlichung der XVI. Brenner-Nummer im August 1946 wieder auf. Er stellt ein paradigmatisches Beispiel für jene Generation von Kulturvermittlern bzw. im Kulturbetrieb Tätigen dar, deren Aktivitäten und Bestrebungen, deren beständige Arbeit an (brieflichen) Netzwerken und transnationalen bzw. transkulturellen Verbindungen in der Nachkriegszeit von deutlicher Wirkkraft waren. In diesem Sinne erschien es für eine Tagung, deren Ziel darin bestand, die Verdienste des Brenner-Herausgebers im größeren Kontext der kulturellen, politischen und sozialen Entwicklungen der Nachkriegszeit abzubilden, nur recht und billig, die Vielfalt der Aktivitäten weiterer kultureller Persönlichkeiten, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die kulturelle Bühne (wieder) betraten, genauer unter die Lupe zu nehmen und Netzwerke aufzuspüren, die erst in einer verdichteten Synopse sichtbar werden.
Die Tagung firmierte unter einem – durchaus provokant formulierten – Haupttitel, der die Absicht hegte, anhand der Frage „Pastorale Mummelgreise oder Führer in der Welt des Geistes?“ jene zentrale Dialektik aufzugreifen und auszudifferenzieren, die sich in der Eigen- und Fremdwahrnehmung der Kulturvermittlerpersönlichkeiten spiegelte. Auch an dieser Stelle wirkte der Brenner-Herausgeber indirekt und aus dem Verborgenen heraus auf die Organisator*innen der Tagung ein: Der erste Begriff stammt aus der Feder Ludwig von Fickers selbst, der sich gegenüber dem Nürnberger Verleger Joseph E. Drexel 1955 eingedenk seines fortschreitenden Alters nicht ohne Selbstironie eingestehen musste: „Der Schwerenöter steht wohl Ihnen noch vortrefflich zu Gesicht, aber kaum mehr mir; ich erschrak geradezu, wie ich schon einem verlegen lächelnden pastoralen Mummelgreis ähnlich zu sehen beginne.“2 Das Jubiläum zum Anlass nehmend, eine mehr als sechs Dezennien währende Würdigung (wenn nicht gar in eine Art Hagiographie ausufernde Huldigung) in neuem, kritischem Licht besehen zu wollen, war auch die zweite Wendung dem Briefwechsel entnommen. Der Terminus „Führer in der Welt des Geistes“ geht auf Alfred Eichholz zurück, der Ficker in einem Weihnachtsgruß vom 21.12.1958 auf solch lobende Weise titulierte.3
Der Fokus der Tagung bestand darin, zum einen die häufig nur undeutlich zutage tretende Bandbreite verschiedener durch Vermittlerpersönlichkeiten angestoßener Transferprozesse, die Vielfalt ihrer Aktivitäten sowie die Komplexität ihrer kommunikativen Netzwerke abzubilden. Dabei wurde versucht, Abstand von rein biographischen Deutungsmustern zu nehmen und die Vermittlerfiguren und -persönlichkeiten weniger als autonome Subjekte wahrzunehmen, als vielmehr ihre Tätigkeiten als Manifestationen von im Verborgenen wirkenden gesellschaftlichen Machteffekten im Sinne der diskursanalytischen Positionen Michel Foucaults zu verstehen.
Literarische Vermittlungen und damit verbundene kulturelle Transferprozesse geschahen und geschehen entlang sozialer, politischer und auch wirtschaftlicher Bruchlinien und Verwerfungen; dies gilt in besonderem Maße für die Phase der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die Menschheitsverbrechen des Holocaust und des Vernichtungskrieges waren zwar spätestens im Herbst 1945 mit dem Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher gesellschaftlich präsent, sie wurden jedoch in der Literatur kaum thematisiert. Dennoch bildeten sie, je nach politischem Gepräge in mehr oder minder großer Intensität, ein aufgeladenes diskursives Substrat, das in Österreich andere Folgen nach sich zog als in der Bundesrepublik Deutschland. Dort erreichte die Debatte über die künstlerische Darstellbarkeit des Undarstellbaren eine andere Qualität, als sie in Verbindung mit der kapitalistischen Vereinnahmung jeglicher Kunst im berühmt gewordenen Diktum Theodor W. Adornos gipfelte.
Der kulturelle Austausch zwischen Vermittlerpersönlichkeiten (der in der Regel bi-direktional und trotz der alliierten Besatzung in den meisten Fällen auch transnational funktionierte) und die daraus resultierenden Wirklichkeitskonstruktionen konnten dabei vielfältige Züge annehmen. Zum einen fanden in den meisten Fällen nationale Transfers statt, die im Nachkriegsdeutschland wie auch in Österreich innerhalb der besetzten Gebiete abliefen. Dabei ist zu beobachten, dass die Grenzen der Besatzungszonen physisch wie ideologisch nicht immer leicht zu überwinden waren. Zu den Schwierigkeiten trugen unter anderem ein sich erst langsam wieder konsolidierendes Postwesen, eine mit unterschiedlicher Intensität durchgeführte Postzensur, sowie Papier- und Rohstoffmangel bei. Vielfach waren Weggefährten der Vermittler*innen verstorben, ins Exil vertrieben oder in den Konzentrationslagern ermordet worden. Auf der anderen Seite finden sich aber auch sehr früh schon Bemühungen der kulturvermittelnden Akteur*innen, Austauschprozesse zu initiieren, zu fördern und auszubauen, die auch vor Nationengrenzen nicht Halt machten.
Am 13. April 1965 konnte man anlässlich des 85. Geburtstags Ludwig von Fickers in einer im Forum veröffentlichten Würdigung Friedrich Hansen-Löves unter dem bedeutungsschweren Titel Auctor Austriae folgende Zeilen abgedruckt finden:
Ludwig von Ficker hat mit [dem Brenner] und anderen von ihm verlegten Schriften europäische Geistesgeschichte gemacht. Denn das fast gleichzeitige Auftreten der protestantisch-dialektischen Theologie (am besten vertreten durch Karl Barth) und der existentiellen Seinsphilosophie eines Jaspers oder Heidegger wäre das Wirken Theodor Haeckers, wären ohne die vorsorgliche Herausgebertätigkeit Ludwig von Fickers nicht möglich gewesen. [...] Das alles und noch mehr verdankt die geistige Welt Europas der stets aus dem Hintergrunde sanft leitenden Hand des Herausgebers Ludwig von Ficker. Wenn demnächst, wahrscheinlich angeregt von dem eminenten Dichter und Essayisten W. H. Auden, die angelsächsische Welt Ferdinand Ebner als Zeitgenossen Wittgensteins kennenlernen wird, dann gebührt der eigentliche Dank da[fü]r dem Patriarchen von Mühlau bei Innsbruck.4
Wenn die Rede auf den Herausgeber des Brenner als Lenker, als Fädenzieher im geistesgeschichtlichen Geschehen, als zugleich geschichtsmächtige wie auch Geschichte machende Figur fällt, hat dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumeist Irritationen zur Folge. In Kenntnis der Lebensgeschichte Fickers – wobei diese fünf Jahrzehnte nach seinem Tod nicht mehr als bekannt vorausgesetzt werden darf – und in einen größeren zeitlichen Zusammenhang gestellt, offenbart sich angesichts dieses Gedankens eine Paradoxie: Ficker hatte als ‚Auctor Austriae‘ zwar im expressionistischen Jahrzehnt mit der „einzigen ehrlichen Revue Österreichs“, wie der Fackel-Herausgeber Karl Kraus 1913 den Brenner bezeichnet hatte, auf dem kulturellen Feld reüssiert. Nach dem Ersten Weltkrieg, als er mit der Zeitschrift einen inhaltlichthematischen Neubeginn unter nun explizit christlich-philosophischen Vorzeichen wagte, war er aber nur mehr einem eingeschränkten Kreis von Rezipient*innen bekannt, vor allem deshalb, weil er sich bewusst mit dem stärker auf Ferdinand Ebners Individualphilosophie ausgerichteten Konzept des Brenner bis zu einem gewissen Grad mit voller Absicht aus dem literarischen Geschehen der Zwischenkriegszeit ausklammerte.
Zudem konterkariert der Blick in gängige Literaturgeschichten die Annahme, dass Fickers kulturpolitisches Wirken von epochemachender Bedeutung gewesen wäre. Ficker wurde und wird darin bis heute – sofern er überhaupt namentlich Erwähnung findet – als institutionelle Persönlichkeit zumeist im Zusammenhang mit der Person Georg Trakls und dessen künstlerischem Schaffen genannt. Die Verdienste, die sich Ficker als Mäzen und väterlicher Freund Trakls erworben hat, sind zwar unbestritten, und auch sein Bestreben, die Lyrik Trakls nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in den Kanon einzuführen, hat Wirkung gezeitigt. Eine rein auf diesen Aspekt verengte Rezeption wird aber der Vielfalt seiner Tätigkeiten und der Wirkmächtigkeit seiner Vermittlungsleistungen bei weitem nicht gerecht.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine Diskrepanz zwischen einer – zum Teil schon an Hagiographie grenzenden – ehrfurchtsvollen Huldigung in den Nachkriegsjahren bis nach seinem Tod und der weitgehenden Marginalisierung in der öffentlichen Wahrnehmung vor dem Zweiten Weltkrieg festzustellen ist, die heute erneut in die Verengung zu einem wissenschaftlichen Spezialforschungsbereich mündet. Die Gründe für solche Fluktuationen in der Rezeption sind vielfältig und sowohl aufseiten der Vermittlertätigkeit Fickers als auch in der spezifischen historischen Situation nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auszumachen.
Während der Weltkrieg auf den asiatischen Schauplätzen noch einige Monate weiter tobte, begann sich nach der militärischen Kapitulation des Dritten Reiches am 8. Mai 1945 allmählich das gewaltige Ausmaß der Zerstörungen abzuzeichnen, die der Weltkrieg verursacht hatte. Weite Teile Europas lagen in Trümmern, und die Deutschen, die den Krieg in die Welt getragen hatten, mussten in den Ruinen der Städte hausen, die seit 1940 mit stetig steigender Intensität im Zuge des alliierten Bombenkrieges angegriffen und zerstört worden waren.
Der Weltkrieg hatte mehr als 60 Millionen Menschen das Leben gekostet; mehr als 6 Millionen Juden, Kommunisten, Homosexuelle, Sinti und Roma und andere in den Augen des NS-Regimes unerwünschte Personengruppen waren im Zuge des Holocaust systematisch ermordet worden. Die wirtschaftlichen, politischen, vor allem aber die sozialen Folgen von Diktatur und Krieg und die damit verbundenen Fragen nach Schuld und Verantwortung lasteten entsprechend schwer auf den Nachkriegsgesellschaften. Während das besetzte Deutschland bzw. die Bundesrepublik Deutschland aber spätestens ab 1946 gezwungen war, sich aufgrund der Nürnberger Prozesse mit der unrühmlichen Vergangenheit unmittelbar auseinanderzusetzen, konnte man in der Zweiten Republik, schon allein unter Berufung auf die in der Moskauer Deklaration von 1943 festgeschriebenen Rolle als „erstes Opfer der Hitlerschen Aggression“, einen völlig anderen Umgang mit der jüngsten Vergangenheit pflegen. Dies führte zu einem österreichischen „Sonderweg“, zu kollektiven Denkschemata, die die Vorstellung von einer „Stunde Null“ beförderten, im Grunde aber „eine geschickt lancierte Fiktion [darstellten], mit deren Hilfe sich viele aus der Verantwortung, und noch mehr um das schlechte Gewissen geschlichen haben.“5 Vielmehr noch: Kunst und Kultur (und hier in besonderem Maße die Literatur) stellten sowohl in der Bundesrepublik als auch im Nachkriegsösterreich hinsichtlich einer positiven Identitäts(neu)bildung starkes identifikatorisches Potenzial bereit; nicht selten handelte es sich in Österreich dabei um Kunstformen, deren Proponenten noch in der Zeit des Ständestaates bzw. sogar in der Monarchie verhaftet waren.
Nach der Befreiung im Mai 1945 stand die nicht mehr länger zu leugnende Tatsache im Raum, dass auch – oder gerade! – die Vereinnahmung der Kultur maßgeblich zum Aufstieg des Nationalsozialismus beigetragen hatte. In den Jahren nach dem Ende des Weltkrieges musste deshalb auch die Kulturvermittlung zwangsläufig im langen Schatten, den der Nationalsozialismus geworfen hatte, ihren Raum finden. In diesem Schatten fanden verschiedenste Funktionalisierungen statt, bei denen kulturelle Inhalte und Praktiken, je nach ihrer Anschlussfähigkeit, mit unterschiedlichen Bedeutungen neu besetzt oder re-interpretiert wurden. Die inhaltliche Bandbreite reichte dabei in ihrer extremen Polarität von restaurativen Bewegungen, die den Nationalsozialismus gewissermaßen als historischen „Unfall“ auszublenden und an die Zeit vor 1933 bzw. 1938 anzuknüpfen versuchten, bis hin zu avantgardistisch motivierten Kunstprogrammatiken, die diese Restaurationsbewegungen bewusst kritisierten und verurteilten (ein Verweis auf die Sprachkritik, die Ernst Jandl in seinem Werk pflegte, mag hier als repräsentatives Beispiel genügen).
Dieses Spannungsfeld, das sich zwischen konservativen und progressiven Kräften, zwischen avantgardistischer Zukunftsschau und reaktionärem Anknüpfen an Vergangenheitskonstruktionen manifestierte, macht eine Beurteilung der kulturpolitischen Situation nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland so komplex – vor allem, wenn man bedenkt, dass der „geistige Wiederaufbau“ in Österreich, in ähnlicher Form wie der real stattfindende, um den Preis des systematischen Verdrängens der jüngsten Vergangenheit6 passiert war. Dass dabei keineswegs von zwei streng dichotomisch getrennten ideologischen Lagern ausgegangen werden konnte, ist nicht auf den ersten Blick evident; zu eindeutig erschien die Trennung zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten, sichtbar gemacht durch die manifeste Metapher des Eisernen Vorhangs, der als Barriere durch Europa gezogen worden war.
Die einzelnen Beiträge dieses Bandes skizzieren, dass Tätigkeiten, die von Kulturvermittlerpersönlichkeiten in einem bestimmten historischen Rahmen durchgeführt werden, in permanenten Selektions-, Produktions- und Rezeptionsprozessen ihren Niederschlag finden. Ein Fokus, der diese Aktivitäten näher beleuchtet, lässt die Vielfalt, die Dynamik und die Komplexität, aber auch die Kontingenz diskursiver Praktiken dieses Zeithorizonts sichtbar werden. Letztlich gilt es herauszufiltern, „aus welchen Motiven heraus Wissen erworben, nach welchen Kriterien das Wissenswerte selektiert und zu welchen Zwecken die erworbene Information benutzt wurde.“7 Als Ergebnis wird deutlich, dass die Grenzen des Diskurses, d.h. die Grenzen dessen, was gesagt, geschrieben (und damit auch getan) werden kann, variabel sind, sowohl was auf synchroner Ebene die Anbindung an die Ausgangskultur und die von dort ausgehende intra-, inter- und transterritoriale Vermittlung betrifft, als auch in einem diachronen Schnitt. In letzter Konsequenz werden durch den Blick auf die Literaturvermittler*innen insbesondere jene Machtverhältnisse und ideologischen Grabenkämpfe deutlich gemacht, die im Kulturbetrieb der Nachkriegszeit – auch – über Kulturvermittlung und Kulturtransfer verhandelt werden und, wie im eingangs zitierten Beispiel, im Ausdruck des Auctors einen Kulminationspunkt finden können.
Kulturvermittlerfiguren müssen somit grundsätzlich – abseits von hinreichend ausgetretenen biographischen Deutungsmustern oder Subjektkonstruktionen – auf einer abstrakten Ebene als den gesellschaftlichen Machtfaktoren unterworfene wie auch Macht erzeugende Autor-Funktionen innerhalb des Kulturbetriebs einer Gesellschaft aufgefasst werden. Diese diskursiven Funktionsbündel erscheinen in einen sozialen Raum eingebettet, in dem das kulturelle Wirken weniger als intentionaler Akt eines autonomen Subjekts wahrgenommen und interpretiert werden muss, sondern vielmehr als Resultat verschiedenläufiger Prozesse verstanden wird, die durch die Regeln des Diskurses präformiert, kontrolliert und permutiert werden. Friedrich Hansen-Löves normativer Ansatz vom Kulturvermittler, der „Geistesgeschichte macht“, muss gewissermaßen auf die Füße gestellt werden und erfährt dadurch eine Erweiterung: Nicht der Auctor ist es, der als Aktant neue kulturelle Inhalte generiert, er nimmt vielmehr eine bestimmte Position innerhalb jenes Machtgefüges ein, das die Diskurse wie auch die involvierten Körper (d.h. Subjekte) durchdringt.
Dass mit den Beiträgen dieses Bandes die Breite der Literatur- und Kulturvermittler*innen nach 1945 nicht einmal annähernd angerissen, sondern nur eine schlaglichtartige Auswahl getroffen werden kann, versteht sich von selbst. Wichtige Figuren wie z.B. Rudolf Henz, Rudolf Felmayer, Viktor Matejka, Ernst Schönwiese u.a. werden zwar nicht explizit behandelt, das umfangreiche Namensregister illustriert aber, wie weit das Feld der Kulturvermittlung reicht. Dass Hans Weigel am häufigsten auftauchen würde, war absehbar. Dass aber Ernst Schönwiese ebenso präsent war, ist schon eher überraschend, wie auch, dass die Namen von Karl Kraus und Georg Trakl so oft genannt werden.
Literaturvermittlung und Kulturtransfer hängt vielfach auch an Institutionen wie Kirchen- und Religionsgemeinschaften, Schulen, Kulturvereinigungen, Verlagen oder Zeitschriften, bei denen nicht unbedingt Einzelpersönlichkeiten im Vordergrund stehen. Solch breite Kontexte zu berücksichtigen, hätte den Rahmen der Tagung bei weitem gesprengt.
Die Herausgeber*innen, Innsbruck, Februar 2020