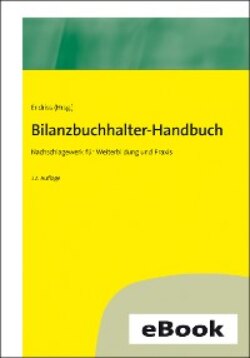Читать книгу Bilanzbuchhalter-Handbuch - Группа авторов - Страница 9
§ 275 Abs. 2 HGB
Оглавление1426Hinweis: Ab 2016 ist die bisherige Darstellung außerordentlicher Posten (Nr. 15 bis 17 des § 275 Abs. 2 HGB a. F.) nicht mehr zulässig.
Posten 6a. Löhne und Gehälter
| für die Mitarbeiter übernommene Lohnsteuer |
Posten 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
| Abgaben, Gebühren, Bußgelder |
| Steuerstrafen |
| Steuerberatungskosten |
Posten 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
| Säumnis- und Verspätungszuschläge |
Posten 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
| Körperschaftsteuer (= Steuer vom Einkommen) |
| Gewerbeertragsteuer (= Steuer vom Ertrag) |
| ausländische Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
| latente Steuern |
| Zuführung zu den Rückstellungen für vorstehend genannte Steuern |
| Steuererstattungen (Der Abschluss der Kapitalgesellschaften und der IKR sehen den gesonderten Ausweis periodenfremder Aufwendungen und Erträge nicht vor.) |
| Steuernachzahlungen zu Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Steuern |
Posten 16. Sonstige Steuern
Alle Steuern, die Aufwand sind, aber nicht Steuern vom Einkommen und Ertrag, wie
| Erbschaftsteuer |
| Kraftfahrzeugsteuer |
| Grundsteuer |
| sämtliche Verbrauchsteuern |
| Steuererstattungen zu sonstigen Steuern |
| Steuernachzahlungen zu sonstigen Steuern |
| vom Arbeitgeber zu zahlende pauschalierte Lohnsteuer, soweit nicht Personalaufwand |
Soweit einzelne der zu Posten 16 angeführten Steuern unter dem GuV-Posten 8 ausgewiesen werden, ist dies im Anhang zu vermerken.
a) Steuerstrafen und Geldbußen
1427Kapitalgesellschaften belasten ein Konto nicht abzugsfähige Aufwendungen innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen oder der sonstigen Steuern.
Einzelunternehmen und Personengesellschaften buchen Steuerstrafen (R 12.3 EStR) und Geldbußen (§ 4 Abs. 5 Nr. 8 EStG, § 12 Nr. 4 EStG, R 4.13 EStR) auf dem Privatkonto.
b) Säumniszuschläge
1428Kapitalgesellschaften buchen Säumniszuschläge auf einem Konto innerhalb der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen.
Einzelunternehmen und Personengesellschaften buchen Säumniszuschläge zu Privat- oder Personensteuern auf dem Privatkonto, zu Betriebssteuern auf einem Aufwandskonto.
c) Steuernachzahlungen
1429Kapitalgesellschaften belasten Steuernachzahlungen grundsätzlich den Konten, denen auch die periodengerechten Zahlungen belastet werden.
Einzelunternehmen und Personengesellschaften buchen Steuernachzahlungen zu Privatsteuern auf dem Privatkonto, zu Betriebssteuern i. d. R. auf einem Konto periodenfremde Aufwendungen.
d) Steuererstattungen
1430Kapitalgesellschaften schreiben Steuererstattungen zu Steuern vom Einkommen und Ertrag und zu den sonstigen Steuern den Konten gut, denen ursprünglich der Steueraufwand belastet wurde. Diese Vorgehensweise wird verständlich, wenn man die GuV-Rechnung nach § 275 HGB betrachtet. Da das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bei der Steuerzahlung nicht durch Aufwand gemindert worden ist, darf die Erstattung das Ergebnis auch nicht erhöhen. Hier handelt es sich nicht um einen Ertrag, sondern um eine Korrektur des Aufwands. Deshalb liegt kein Verstoß gegen das Verrechnungsverbot des § 246 Abs. 2 HGB vor.
Sollte die ursprüngliche Belastung sonstiger Steuern ausnahmsweise in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Posten 8 der GuV) eingegangen sein, muss die Gutschrift bei einer Erstattung auf einem Konto zu den sonstigen betrieblichen Erträgen (Posten 4 der GuV) erfolgen.
Einzelunternehmen und Personengesellschaften buchen Steuererstattungen aus Privatsteuern auf dem Privatkonto, solche aus Aufwandssteuern i. d. R. auf dem Konto periodenfremde Erträge oder als außerordentliche Erträge.
e) Freigewordene Steuerrückstellungen
1431Freigewordene Steuerrückstellungen werden bei Kapitalgesellschaften und bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften entsprechend den Steuererstattungen behandelt.
f) Steuerberatungskosten
1432Steuerberatungskosten zu betrieblichen Steuern sind Rechts- und Beratungskosten. Die Steuerberatungskosten zu Privatsteuern bei Einzelunternehmern werden dem Privatkonto belastet.
1500Forderungen sind mit ihren Anschaffungskosten zu bewerten (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB). Die Anschaffungskosten entsprechen grundsätzlich dem Nominalwert. Für Forderungen im Anlagevermögen gilt das gemilderte Niederstwertprinzip. Sie müssen nur dann auf den niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert abgeschrieben werden, wenn die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist (§ 253 Abs. 3 Satz 5 HGB). Für Forderungen im Umlaufvermögen gilt das strenge Niederstwertprinzip. Sie müssen auf den niedrigeren Wert am Bilanzstichtag abgeschrieben werden (§ 253 Abs. 4 HGB). Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenkassakurs umgerechnet. Rdn. 1525 gilt entsprechend.
1501Nach der Bewertung lassen sich die Forderungen im Umlaufvermögen in drei Gruppen einteilen:
| Einwandfreie Forderungen werden zum Nominalwert bilanziert (§ 253 Abs. 1 HGB). Forderungen in fremder Währung werden zum Devisenkassakurs umgerechnet (vgl. § 256a HGB). Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger sind Kurswertschwankungen dabei stets zu erfassen, und zwar auch dann, wenn sich ein Ertrag aus Währungsdifferenzen ergibt. Das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) sowie die „Deckelung” auf die AK (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) gelten dann nicht mehr. Wegen des allgemeinen Kreditrisikos wird auf den Forderungsbestand am Jahresende eine Abwertung entsprechend den Erfahrungssätzen in den Vorjahren und dem erwarteten Ausfall entsprechend der erwarteten Entwicklung im Folgejahr vorgenommen. Die Abwertung erfolgt indirekt in Form einer Pauschalwertberichtigung (PWB). Wertberichtigungen von 1 % (Nichtaufgriffsgrenze) werden von der Finanzverwaltung ohne weiteres anerkannt. Höhere Sätze sollten begründet werden. |
| Wegen des Grundsatzes der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 u. 2 HGB) sollte der Wertberichtigungssatz nur angepasst werden, wenn sich die Verhältnisse wesentlich geändert haben. |
| Pauschalwertberichtigungen sind nicht auf Forderungsbestände zu berechnen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht, wie Forderungen an öffentlich-rechtliche Körperschaften, Steuererstattungsansprüche, Forderungen, für die Bürgschaften bestehen, Forderungen, zu denen aufrechenbare Gegenansprüche bestehen, Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen, durch eine Delkredere- oder Warenkreditversicherung gesicherte Forderungen. |
| Zweifelhafte Forderungen (Dubiosen) werden mit ihrem wahrscheinlichen Wert bilanziert, wenn teilweiser Ausfall mit hoher Wahrscheinlichkeit droht. Die Abschreibung erfolgt indirekt durch Einzelwertberichtigung (EWB). Beispiele: (1) Ein Kunde zahlt nicht trotz wiederholter Mahnungen. (2) Der Kurswert einer Forderung in fremder Währung ist zum Bilanzstichtag unter den Kurs am Tag der Anschaffung gesunken. |
| Uneinbringliche Forderungen werden durch direkte Abschreibungen voll abgeschrieben. Die Beibehaltung eines Erinnerungswerts von 1 € ist möglich, belastet aber die Buchhaltung. Beispiele: Zahlungsunfähigkeit des Schuldners (Abschn. 17.1 Abs. 5 UStAE), fruchtlose Pfändung, der Schuldner hat eine eidesstattliche Erklärung abgegeben oder macht von der Einrede der Verjährung Gebrauch. Oder die gerichtliche Erzwingung lohnt nicht wegen Geringfügigkeit des Betrags. |
a) Buchungen im Jahresabschluss
1502Am Jahresende wird eine Pauschalwertberichtigung wegen des allgemeinen Kreditrisikos gebucht. Diese wird vom Nettobetrag des Forderungsbestands einschließlich der Besitzwechsel und der sonstigen Forderungen berechnet. Differenzierte Abschläge, z. B. nach Inland und Ausland, Branchen, sind möglich.
1503 1503 Der Forderungsbestand am Ende des Geschäftsjahres beträgt 987 700 €. In diesem Betrag sind insgesamt 157 700 € USt enthalten. Erfahrungsgemäß fallen im Folgejahr 3 % dieser Forderungen aus.
3 % von 830 000 € = 24 900 €
| Die PWB aus dem Vorjahr sind aufgebraucht. Das Konto PWB auf Forderungen weist keinen Saldo aus. |
| Buchung: |
| Abschreibungen auf |
| Das Konto PWB auf Forderungen weist noch einen nicht in Anspruch genommenen Restsaldo von 10 000 € aus dem Vorjahr aus. |
| Buchung der Anpassung: |
| Abschreibungen auf |
b) Buchungen im Folgejahr
1504Im Zeitpunkt des Ausfalls einer am Ende des Vorjahres noch einwandfreien Forderung wird die PWB entsprechend aufgelöst.
1505 1505 Die Forderung in Höhe von 119 € einschließlich USt ist ausgefallen.
| a) | Die PWB ist noch nicht verbraucht: |
| b) | Die PWB ist bereits für Ausbuchungen von Forderungen aus dem Vorjahr aufgebraucht: |
Einzelunternehmen und Personengesellschaften buchen in diesem Fall meist
| Periodenfremde (oder a.o.) |
1506Das allgemeine Kreditrisiko umfasst das allgemeine Ausfallrisiko, die Kosten der Eintreibung, Skontoberichtigungen und den innerbetrieblichen Zinsverlust. Entsprechend differenziert kann die PWB berechnet werden.
1507 1507 Der Forderungsbestand am Bilanzstichtag beträgt einschl. 19 % USt 119 000 €. Bei einem durchschnittlichen Ausfall von 4 % in den Vorjahren ergibt sich ein allgemeines Ausfallrisiko von 4 000 €.
Die mit dem Einzug der Forderungen zusammenhängenden Kosten für Mahnverfahren, Zwangsmaßnahmen und gerichtliche Klagen können als Beitreibungskosten abgesetzt werden (BFH v. 19. 1. 1967, BStBl 1967 III S. 336). Diese Kosten haben in den Vorjahren 1,5 % des Forderungsbestands am Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres ausgemacht. Das bilanzierende Unternehmen geht von 1 785 € aus; die Beitreibungskosten werden vom Bruttoforderungsbestand berechnet.
Erfahrungsgemäß werden 20 % der Forderungen unter Abzug von 3 % Skonto beglichen. 3 % von 20 000 € ergibt einen Ausfall für Skontoberichtigung von 600 €.
Das Unternehmen hat eine Umschlagsdauer der Forderungen von 42 Tagen. Bei einem durchschnittlich vereinbarten Zahlungsziel von 30 Tagen ergibt sich ein Schuldnerverzug von 12 Tagen. Bei einem marktüblichen Zinssatz von 7 % wird der innerbetriebliche Zinsverlust bei Soll-Versteuerung wie folgt berechnet:
Errechnung des Prozentsatzes für die Pauschalwertberichtigung:
| Abschreibungen auf |
a) Buchungen während des lfd. Geschäftsjahres
1508Im Zeitpunkt der Kenntnisnahme der Gefährdung der Forderung wird diese zum (Brutto-)Nennbetrag umgebucht auf das Konto Zweifelhafte Forderungen.
1509 1509
Ein Kunde hat die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Die Forderung beträgt 11 900 €.
Buchung:
Stellt sich noch vor dem Bilanzstichtag heraus, dass die Forderung uneinbringlich ist, wird sie direkt abgeschrieben.
b) Buchungen im Jahresabschluss
1510Ist die zweifelhafte Forderung zum Bilanzstichtag noch offen, erfolgt die indirekte Abschreibung auf den wahrscheinlichen Wert am Bilanzstichtag. Die Abschreibung wird vom Nettobetrag der Forderung berechnet. Eine Berichtigung der Umsatzsteuer erfolgt nicht, da die Forderung noch nicht endgültig ausgefallen ist. Bei der Feststellung des Werts ist die Wertaufhellung, d. h. die besseren Erkenntnisse innerhalb der Zeit zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Bilanzerstellung, zu berücksichtigen (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).
1511 1511
Am Bilanzstichtag ist bei der Forderung von 11 900 € (Beispiel 1) mit einem Ausfall von 50 % zu rechnen.
Buchung:
c) Buchungen im Folgejahr
1512Ist der Zahlungseingang im Folgejahr höher als erwartet, fallen Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von EWB auf Forderungen an. Im umgekehrten Fall werden die im Vorjahr versäumten Abschreibungen nachgeholt.
1513 1513
(1) Im Folgejahr gehen 7 140 € der Forderung im vorstehenden Beispiel auf dem Bankkonto ein.
| Umsatzsteuer-Korrektur: 1 900 € - 1 140 € = 760 € |
Buchung:
(2) Im Folgejahr gehen nur 3 570 € auf dem Bankkonto ein.
Einzelunternehmen und Personengesellschaften belasten mitunter an Stelle von Abschreibungen auf Forderungen das Konto „periodenfremde Aufwendungen”.
a) Buchungen im Jahresabschluss
1514Uneinbringliche Forderungen werden im Zeitpunkt des Ausfalls direkt abgeschrieben. Die Umsatzsteuer wird berichtigt.
1515 1515 Ein Kunde hat die eidesstattliche Erklärung abgegeben. Die Forderung beträgt 1 190 €.
Buchung:
Gehen in Folgejahren unerwartet in Vorjahren abgeschriebene Forderungen ein, lebt die Umsatzsteuerschuld wieder auf. Einzelunternehmen, Personengesellschaften und auch Kapitalgesellschaften buchen an „periodenfremde Erträge”.
Auf dem Bankkonto sind 1 190 € aus einer im Vorjahr abgeschriebenen Forderung eingegangen. Die Forderung enthielt 19 % USt. Buchung:
1516Soweit bereits Einzelwertberichtigungen vorgenommen worden sind, muss zusätzlich das Kreditrisiko aus den nicht einzelwertberichtigten Forderungen abgedeckt werden.
1517 1517
Buchung:
1518In den offenlegungspflichtigen Bilanzen der Kapitalgesellschaften werden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen nicht gesondert ausgewiesen, sondern auf der Aktivseite abgesetzt.
1519 1519
1520Im Falle einer Forderungszession sowie bei unechtem Factoring, bei dem das Factoringunternehmen das Delkredererisiko nicht übernimmt, ist die Forderung weiterhin bei dem begebenden Unternehmen zu bilanzieren. Nur beim echten Factoring erwirbt der Factor die Forderung, so dass sie aus dem Vermögen des begebenden Unternehmens ausscheidet.
1521Die wichtigsten handelsrechtlichen Vorschriften zur Bewertung und Bilanzierung der Verbindlichkeiten enthalten:
| § 238 Abs. 1 HGB: Ausweis der Schulden in den Büchern. |
| § 240 Abs. 1 u. 2 HGB: Ausweis der Schulden im Inventar. |
| § 242 Abs. 1 HGB: Ausweis der Schulden in den Bilanzen. |
| § 244 HGB: Währungsverbindlichkeiten sind in € umzurechnen. |
| § 246 Abs. 1 HGB: Der Jahresabschluss hat sämtliche Schulden zu enthalten. |
| § 246 Abs. 2 HGB: Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht miteinander saldiert werden. |
| § 247 Abs. 1 HGB: Die Schulden sind gesondert auszuweisen und hinreichend aufzugliedern. |
| § 250 Abs. 3 HGB: Eine Differenz zwischen dem Ausgabebetrag und dem höheren Rückzahlungsbetrag einer Verbindlichkeit darf in den Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite aufgenommen werden. |
| § 251 HGB: Nicht auf der Passivseite auszuweisende Verbindlichkeiten (Haftungsverhältnisse) sind unter der Bilanz zu vermerken. |
| § 252 HGB: Allgemeine Bewertungsgrundsätze einschließlich des Grundsatzes der Einzelbewertung und des Vorsichtsprinzips. |
| § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB: Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag zu bewerten. |
| § 254 HGB: Bildung von Bewertungseinheiten. |
| § 256a HGB: Währungsdifferenzen. |
| § 265 Abs. 1 HGB: Beibehaltung der Bilanzgliederung. |
| § 265 Abs. 2 HGB: Angabe der Vorjahresbeträge. |
| § 265 Abs. 3 HGB: Mitzugehörigkeit zu einem anderen Posten. |
| § 266 Abs. 1 HGB: Größenabhängige Erleichterungen. |
| § 266 Abs. 3 HGB: Gliederungsschema in der Bilanz. |
| § 268 Abs. 5 Satz 1 HGB: Vermerk des Betrags der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. |
| § 268 Abs. 5 Satz 2 HGB: Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen. |
| § 268 Abs. 7 HGB: Angabe der gewährten Pfandrechte und sonstigen Sicherheiten zu den in § 251 HGB bezeichneten Haftungsverhältnissen. |
| § 285 Nr. 1 und 2 HGB: Angabe des Gesamtbetrags der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren und Angabe von Art und Form der Sicherheiten. |
| § 285 Nr. 3 HGB: Angabe des Gesamtbetrags der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die weder in der Bilanz noch unter der Bilanz erscheinen. |
| § 288 HGB: Größenabhängige Erleichterungen. |
| § 42 Abs. 3 GmbHG: Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, die in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen oder mit einem Mitzugehörigkeitsvermerk gekennzeichnet wurden. |
1522Steuerrechtliche Vorschriften zur Buchung, Bilanzierung und Bewertung der Verbindlichkeiten enthalten:
| § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG: Die Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG anzusetzen. |
| § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG: Behandlung des Damnums, Disagios oder Agios. |
1523Verbindlichkeiten liegen vor, wenn ein Unternehmen daraus nach Grund, Fälligkeit und Höhe eindeutig rechtlich verpflichtet ist. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag (Rückzahlungsbetrag), Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, sind zum Barwert der zukünftigen Auszahlungen anzusetzen (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Der Rückzahlungsbetrag ist der Betrag, den das Unternehmen zur Begleichung der Verbindlichkeiten ausgeben muss. Verbindlichkeiten, deren Restlaufzeit am Bilanzstichtag 12 Monate und mehr beträgt, sind mit einem Zinssatz von 5,5 % abzuzinsen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG).
1524Bewertungsuntergrenze sind die Anschaffungskosten. Der niedrigere Teilwert darf nicht angesetzt werden. Der höhere Teilwert muss angesetzt werden. Der spätere Ansatz eines niedrigeren Teilwerts ist möglich.
1525Fremdwährungsverbindlichkeiten werden im Zeitpunkt des Zugangs zum aktuellen Kurs eingebucht. I. d. R. würde man den Geldkurs nehmen (= Kurs, zu dem die Bank die fremde Währung an uns verkaufen würde, damit wir unsere Schulden bezahlen können), bei Fremdwährungsforderungen würde man demzufolge den Briefkurs nehmen (Kurs, der beim Ankauf der Fremdwährung von der Bank aufgerufen wird). Gesetzlich ist das aber nicht geregelt; § 256a HGB enthält nur die Festlegung auf den Devisenkassamittelkurs bei Bewertung zum Jahresabschluss. Unterjährig ist der heranzuziehende Kurs also frei wählbar (Börsenplatz, Geld- oder Briefkurs, ggf. Mittelkurs des BMF).
Fremdwährungsverbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden zum Abschlussstichtag stets zum Devisenkassakurs ausgewiesen (§ 256a HGB).
1526 1526 Am 15. 12. 01 wurden Handelswaren für 10 000 Dollar importiert. Die Eingangsrechnung wurde am 16. 12. 01 bei einem Dollarkurs von 0,95 € gebucht:
Fall 1: Unveränderter Kurswert
Am 31. 12. 01 (Bilanzstichtag) beträgt der Kurs beim Kauf (Briefkurs) für einen Dollar unverändert 0,95 €. In diesem Falle ist keine zusätzliche Buchung erforderlich.
Fall 2: Gefallener Kurswert
Am 31. 12. 01 ist der Kurs (Briefkurs) auf 0,90 € gefallen. Die Verbindlichkeit ist weiter mit 0,95 € je Dollar zu passivieren, da der Ansatz eines niedrigeren Kurses zur Bilanzierung eines am 31. 12. 01 noch nicht realisierten Gewinns von 500 € führen würde. Der Ausweis dieses Gewinns würde gegen das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 letzter Teilsatz HGB) verstoßen. Sofern aber die Restlaufzeit der Verbindlichkeit nicht mehr als 1 Jahr beträgt, ist handelsrechtlich ein Ertrag als Kursdifferenzen darzustellen (§ 256a HGB). Die Buchung lautet dann:
Fall 3: Gestiegener Kurswert
Am 31. 12. 01 ist der Kurs (Briefkurs) auf 0,98 € gestiegen. Aus Gründen der Vorsicht (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) ist die Verbindlichkeit mit dem höheren Rückzahlungsbetrag (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB) zu bilanzieren. Der zum 31. 12. 01 noch nicht realisierte Verlust ist auszuweisen (Imparitätsprinzip, § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB). Erforderliche Buchung:
Etwas anderes gilt, wenn die Verbindlichkeit „gehedgt” ist. Gemäß § 254 HGB muss ein gegenläufiges Wertsicherungsgeschäft in der Weise berücksichtigt werden, dass gleichermaßen die Gewinne aus dem einen Finanzierungsinstrument (z. B. Put-Optionsschein, mit dem auf einen sinkenden Dollarkurs gewettet wird) und die Verluste aus dem anderen (gegenläufigen) Finanzinstrument (z. B. Forderung auf Dollarbasis) gebucht werden.
1527Nach dem Wortlaut des § 268 Abs. 5 HGB ist der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bei jedem gesondert ausgewiesenen Posten als „Davon-Vermerk” in der Bilanz auszuweisen. § 285 Nr. 1 HGB schreibt für alle Kapitalgesellschaften vor, dass im Anhang
| a) | der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren, |
| b) | der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, unter Angabe von Art und Form der Sicherheiten anzugeben sind. |
1528Große und mittelgroße Kapitalgesellschaften müssen im Anhang die Aufgliederung dieser Angaben für jeden Posten der Verbindlichkeiten entsprechend dem Gliederungsschema der Bilanz (§ 266 Abs. 3 C. HGB) vornehmen, sofern sich die Angaben nicht aus der Bilanz ergeben (§ 285 Nr. 2 HGB i. V. mit § 288 HGB).
Kleine Kapitalgesellschaften brauchen die Verbindlichkeiten nicht zu untergliedern. Sie können sämtliche Verbindlichkeiten unter „C. Verbindlichkeiten” zusammenfassen.
Für mittelgroße Kapitalgesellschaften sieht § 327 HGB Erleichterungen bei der Offenlegung vor.
1529An Stelle verbaler Erläuterungen kann ein übersichtlicherer Verbindlichkeitenspiegel in den Anhang aufgenommen werden:
ABB. 20: Verbindlichkeitenspiegel
1530Weitere Angaben im Anhang:
| Beträge für Verbindlichkeiten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen (antizipative Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten), müssen, soweit sie einen größeren Umfang haben, im Anhang erläutert werden (§ 268 Abs. 5 Satz 3 HGB). Wesentlich ist immer ein Betrag in Höhe von 10 % des Jahresergebnisses oder ein Betrag, der im Verhältnis zum Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten ins Gewicht fällt. |
| Die in § 251 HGB aufgeführten Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln (Wechselobligo), aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sind jeweils gesondert im Anhang (§ 268 Abs. 7 HGB) unter Angabe der gewährten Pfandrechte und sonstigen Sicherheiten anzugeben. Im Anhang sind auch die nicht nach § 251 HGB anzugebenden finanziellen Verpflichtungen aufzuführen, sofern die Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist. |
1531Das Kontokorrent ist das wichtigste der Nebenbücher. Der gesamte Geschäftsverkehr mit den Kunden und mit den Lieferanten wird über die Sachkonten Forderungen (Debitoren) und Verbindlichkeiten (Kreditoren) gebucht. Die Salden dieser Konten zeigen den Gesamtbetrag an Forderungen und den Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten. Welche Beträge einzelne Kunden zu zahlen haben und welche Beträge einzelnen Lieferanten geschuldet werden, ist aus den Konten im Hauptbuch nicht ersichtlich. Deshalb wird im Kontokorrent (conto corrente = lfd. Rechnung) auf den Namen jedes einzelnen Kunden und Lieferanten ein Personenkonto geführt.
1532Jede Buchung auf den Konten Forderungen aus L. u. L. und Verbindlichkeiten aus L. u. L. wird gleichzeitig auf einem Personenkonto im Kontokorrent vorgenommen. Die Übertragung erfolgt aus dem Hauptbuch oder unmittelbar aus dem Grundbuch. Bei Anwendung der Durchschreibebuchführung oder der EDV-Buchführung entfällt die Übertragung.
1533Beim Kontenabschluss werden die Salden der Personenkonten in der Debitoren-Liste und in der Kreditoren-Liste zusammengestellt. Die Summen der Saldenlisten müssen mit den Salden der Konten Forderungen und Verbindlichkeiten im Hauptbuch übereinstimmen. Die Saldenlisten sind Anlagen zum Inventar.
1534Neben Vermögen, Schulden und Reinvermögen müssen auch die Eventualverbindlichkeiten im Jahresabschluss berücksichtigt werden. Banken messen bei der Kreditgewährung gerade diesem Posten besondere Bedeutung zu.
1535Das Handelsrecht unterscheidet zwischen der Angabe solcher Haftungsverhältnisse in der Bilanz, innerhalb der Erläuterungen im Anhang und der Angabe unter der Bilanz.
1536Die Vermerkpflicht für Eventualverbindlichkeiten (§ 251 HGB) gilt für alle Kaufleute und für Konzerne (§ 298 Abs. 1 HGB). Kapitalgesellschaften und Konzerne müssen die einzelnen Haftungsverhältnisse gesondert ausweisen unter Angabe der gewährten Sicherheiten (§ 268 Abs. 7 HGB). Haftungsverhältnisse gegenüber verbundenen Unternehmen sind als „Davon-Posten” anzugeben.
1537Kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften (§ 264d HGB) müssen im Anhang die Gründe und Risiken der Inanspruchnahme der nach § 251 HGB ausgewiesenen Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse angeben (§ 285 Nr. 27 HGB).