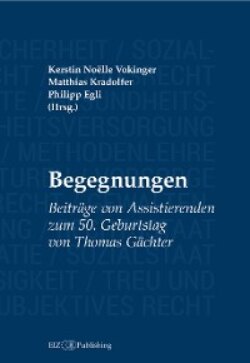Читать книгу Begegnungen - Группа авторов - Страница 8
Schreckgespenster
ОглавлениеWer wie Thomas Gächter die Ruhe der Nacht zum Arbeiten schätzt, wird sich von einer Geisterstunde nicht schrecken lassen. Einen klaren und kühlen Kopf zu bewahren, empfiehlt sich dabei nicht nur zur mitternächtlichen Stunde, sondern auch beim Blick in die Sozialgesetzgebung. Sie kennt ihre eigenen Schreckgespenster, wie sich beispielhaft an jener Zeit vor gut 70 Jahren zeigt, als die Stunde des Polizeigeistes schlug: Mit seinen Vorentwürfen zu einem Spezialgesetz über die betriebliche Personalvorsorge schuf der Bund in den Augen manch kritischer Beobachter ein bürokratisches Schreckgespenst. Was äusserlich als «kleines Spezialgesetz»[1] daherkam – 22 Paragraphen auf 7 Druckseiten –, erregte damals die Gemüter derjenigen Kreise, die vor dem Polizeigeist und damit vor der Gesinnung einer staatlichen Einmischung und Kontrolle erschauderten.[2]
Konkret richtete sich der Widerstand von Arbeitgebervertretern, Verbänden der Personalfürsorge und Teilen der Rechtslehre gegen den Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über die Personalfürsorge privater Unternehmen vom 20. Juli 1951.[3] Der aus heutiger Sicht schlanke Vorentwurf sah eine einheitliche Regelung für alle Personalkassen privater Unternehmen vor.[4] Er zielte namentlich auf eine Stärkung der Rechtsstellung des Personals, indem den Arbeitnehmenden ein Recht auf Mitwirkung in der Verwaltung der Personalkassen sowie ein Anspruch auf die satzungsgemässen Leistungen eingeräumt worden wäre.[5] Vorgesehen war weiter eine Rückzahlung der eigenen Beiträge (zzgl. Zins) bei Auflösung des Dienstverhältnisses sowie eine Regelung des Rechtsmittelweges.[6] Stiftungsurkunde und Statuten wären vor der Eintragung auf ihre Gesetzeskonformität zu prüfen gewesen und das Vermögen der Personalkasse wäre vom Geschäftsvermögen des Unternehmens zu trennen gewesen.[7] Personalkassen wie auch Zuwendungen an Personalkassen blieben nach dem Vorentwurf von den direkten Steuern des Bundes befreit.[8]
Die Gegner der Vorlage sahen im Vorentwurf eine unnötige Reglementierung und drohenden Staatszwang in Gestalt von zahlreichen Zwangsvorschriften, die der bisherigen, auf Freiheit und Freiwilligkeit beruhenden privatrechtlichen Ordnung widersprachen:[9]
«Die Privatwirtschaft wird bevormundet (…) Wir haben hier ein Beispiel des Staatsinterventionismus vor uns, einen weiteren Schritt zur Bürokratisierung.»
Das war starker Tobak. Der Zürcher Zivilrechtsprofessor August Egger, der selbst an den Vorentwürfen mitgewirkt hatte, verwies nicht nur auf den «gereizten Ton» der Debatte, sondern vor allem auch auf die Defizite des damals geltenden (Stiftungs-)Rechts.[10] Bei einer gewöhnlichen Stiftung – so Egger – komme die Leistung der Stiftung über die Destinatäre wie eine Schenkung. Ganz anders sei dies bei Wohlfahrtseinrichtungen, bei denen die Destinatäre auf die Leistungen zählen, da sie Teil ihres Lebensstandards bilden. Was bei gewöhnlichen Stiftungen etwas Unerhörtes wäre – die Heranziehung der Destinatäre zu eigenen Beitragsleistungen –, bedeute hier eine höher entwickelte Form der Wohlfahrtsinstitution. Leistungen von Wohlfahrtseinrichtungen seien keine reine Liberalität, sondern ein besonders gestaltetes zusätzliches Entgelt für geleistete Arbeit.[11]
Nachvollziehbar war daher für Egger das starke Interesse des Personals an den Wohlfahrtseinrichtungen, an der Verwendung der Mittel, an der eigenen Rechtsposition. Das Personal empfinde das Bedürfnis nach Rechtssicherheit, wie es unser ganzes rechtsstaatliches Denken erzeuge: «Warum dann nicht dem offenkundigen Bedürfnis des Personals Rechnung tragen?»[12] Der autoritäre Charakter der Stiftung – die dauernde Beherrschung durch den Stifterwillen – bedürfe bei Wohlfahrtseinrichtungen der Milderung durch die Ausrichtung auf die Interessen der Betriebsgemeinschaft von Unternehmen und Personal, auf die «human relations». Egger ermahnte, man dürfe sich durch Doktrinarismus weder leiten noch schrecken lassen.[13]
Das primäre Anliegen von Egger war also eine Stärkung der Rechtsstellung des Personals und weniger eine Stärkung staatlicher Bevormundung. Egger war durchaus skeptisch gegenüber der «Tendenz, den Schwierigkeiten des Wirtschafts- und Soziallebens in raschem Zugriff mittelst der Gesetzgebungsmaschine zu begegnen».[14] Doch sein differenziertes Votum blieb ungehört: Die Vorarbeiten versandeten und es sollten noch Jahrzehnte verstreichen, bis eine Spezialgesetzgebung zur beruflichen Vorsorge mehrheitsfähig wurde.[15] Zu stark dachten die Gegner der Vorlage in der allzu einfachen «doktrinären» Gegenüberstellung von staatlichem Zwang und freiheitlicher Wirtschaft. Daraus ergab sich beinahe zwangsläufig ein grundlegendes Spannungsverhältnis zwischen den privaten Interessen an einer freiheitlichen Ordnung und den öffentlich-rechtlichen Interessen an der sozialen Sicherstellung des Arbeitnehmers.[16]
Und so sahen die Gegner Geister: Das Spezialgesetz erschien ihnen als Bevormundung durch den Staat und als Zersetzung der Zivilrechtsordnung[17] – oder eben: als Schreckgespenst und Polizeigeist. Zweifelhaft erscheint mir, ob diese Kritik berechtigt war. Allenfalls jagten die Gegner der Vorlage Geister, für die sie selbst die Mitverantwortung trugen: Waren die Jäger des Polizeigeistes womöglich auch seine Paten? Bevor auf diese Frage zurückzukommen sein wird (IV.), lohnt es sich, einige Streiflichter auf die frühe Regelung der betrieblichen Personalvorsorge im Steuerrecht (II.) und im Aktienrecht (III.) zu werfen.