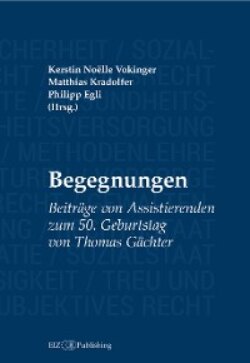Читать книгу Begegnungen - Группа авторов - Страница 9
Verborgener Sozialstaat
ОглавлениеAls sich die eben erwähnten Geisterjäger vor gut 70 Jahren berufen fühlten, gegen das Schreckgespenst einer Spezialgesetzgebung anzukämpfen, förderte der Staat bereits seit über 30 Jahren mit Hunderten von Millionen Franken die privaten Wohlfahrtseinrichtungen. Dies geschah allerdings nicht über ein Spezialgesetz oder direkte Geldzahlungen, sondern über die Befreiung von den kriegs- und krisenbedingten Steuern der ersten Jahrhunderthälfte.[18] Diese später auch in das ordentliche Steuerrecht von Bund und Kantonen überführten Regelungen trugen massgeblich zum Aufblühen der privaten Wohlfahrtseinrichtungen bei.
Ab dem Jahr 1916 liess der Bund Wohlfahrtszuwendungen der Unternehmen als Steuerabzüge bei der Kriegsgewinnsteuer zu. Im Ergebnis leistete der Bund nach eigener Einschätzung «gewaltige Beiträge» durch die Steuerbefreiung der Wohlfahrtszuwendungen.[19] Mitunter wurden die Steuerprivilegien gar als einer der «allerwichtigsten» Beschlüsse bezeichnet, die der Bundesrat im Rahmen der Vollmachten (pleins pouvoirs) des Ersten Weltkrieges getroffen hatte.[20] In der Tat: Bis ins Jahr 1921 belief sich das Total der (definitiv oder provisorisch) steuerbefreiten Zuwendungen bereits auf CHF 200 Millionen, bei Gesamteinnahmen durch die Kriegsgewinnsteuer von rund CHF 790 Millionen.[21] Im Laufe der folgenden Jahrzehnte sollten es die einleitend erwähnten «Hunderten von Millionen Franken» werden.[22]
Selbstredend war der Fiskus darum bemüht sicherzustellen, dass diese «gewaltigen Beiträge» zweckentsprechend verwendet wurden. Deshalb verlangte die eidgenössische Steuerverwaltung bereits früh, «dass die Zuwendung mit selbständiger juristischer Persönlichkeit ausgestattet werden müsse».[23] Im Alltag fiel die Durchsetzung und Kontrolle der Zweckbindung allerdings schwer – «ein etwas heikles Thema», wie der Bundesrat bald einmal in aller Zurückhaltung einräumen musste.[24]
Allzu verlockend war für die Unternehmen die Steuerfreiheit: Möglicherweise ging es ihnen bisweilen «weniger um das Wohl ihrer Angestellten und Arbeiter, als vielmehr um die Reduktion ihrer Kriegsgewinnsteuerpflicht».[25] Eigennutz hinderte die Errichtung der Stiftung indes nicht.[26] Allerdings fehlte es den Unternehmen nicht selten am Willen oder an den Mitteln (oder an beidem), um die geforderte Sicherheit in Form einer tatsächlichen Ausscheidung und Überführung der Mittel in verselbständigte Stiftungen zu leisten. Selbst der Fiskus musste sich in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg damit begnügen, dass sich die Aktiven einer verselbständigten Wohlfahrtseinrichtung in einer ungesicherten Forderung gegenüber dem Unternehmen erschöpften.[27] Die Stiftungen dienten damit auch der steuerbegünstigten Selbstfinanzierung der Unternehmen.[28]
In der Neuen Zürcher Zeitung war später zugespitzt von «Potemkinschen Stiftungen» die Rede,[29] das heisst von Stiftungen, deren Aktiven nur auf dem Papier Geldwert hatten. Heute würde man sie vielleicht als Zombie-Stiftungen bezeichnen – also Stiftungen, «die nicht leben, aber auch nicht sterben können».[30] Solche Stiftungen konnten nur beschränkt zur sozialen Fürsorge beitragen.
Kontrolle tat also Not. Stiftungsrechtlich war eine behördliche Aufsicht zur Sicherung des Stiftungszwecks schon damals gesetzlich vorgeschrieben;[31] die staatliche Aufsicht ist bei Stiftungen «von alters her» bewährt.[32] Weiter gingen die Steuerbehörden von Bund und Kantonen im Laufe der Jahrzehnte dazu über, detaillierte Regelungen zu den Voraussetzungen der Steuerbefreiung aufzustellen. Die beinahe 800-seitige (!) Dissertation von Hans Wirz aus dem Jahr 1955 zur Stellung der Wohlfahrtseinrichtungen im Steuer- und Aufsichtsrecht mit einer umfassenden Darstellung der damaligen Steuerpraxis von Bund und Kantonen lässt Detailliertheit und Dichte der steuerlich motivierten Regeln erahnen.[33] Die Themen der steuerlichen Regeln waren vielfältig und nahmen diejenigen des geplanten Spezialgesetzes vorweg.
Angesichts dieser zunehmenden Regulierung der Wohlfahrtseinrichtungen durch das Steuerrecht sprach Wirz kritisch von einer kalten Revision der zivilrechtlichen Strukturen:[34] Das öffentlich-rechtliche Steuerrecht überformte zunehmend das privatrechtliche Stiftungsrecht. Diese «expansive Kraft» des Steuerrechts geriet dort an rechtliche Grenzen, wo die Kantone mit ihrem Steuerrecht allzu stark in zivilrechtliche Strukturen eingriffen.[35] Die damit einhergehenden Spannungen zwischen Stiftungsrecht und Steuerrecht zeigten sich etwa dann, wenn Steuerbehörden eine Ausscheidung oder Sicherstellung des Stiftungsvermögens einforderten[36] oder die Steuerbefreiung von Anpassungen in den Stiftungsurkunden abhängig machten, die Stiftungsaufsicht aber vom Grundsatz der Unabänderlichkeit der Stiftungssatzungen ausging[37].
Lehre und Praxis fanden zwar Wege, um die beiden Rechtsordnungen aufeinander abzustimmen.[38] Auch drängte der Bundesrat die kantonale Stiftungsaufsicht geradezu zur Kontrolle: «Die steueramtliche Kontrolle allein führt … nicht zum Ziel, wenn sie nicht durch eine ernsthafte, zeitlich unbegrenzte Kontrolle der Aufsichtsbehörde ergänzt wird.»[39] Doch die Gesetzgebung der Kantone blieb unterschiedlich, die kantonale Rechtspraxis uneinheitlich und die Rechtslage entsprechend unübersichtlich.
Auffallend ist, dass durch die «Hintertür» des Steuerrechts schon früh eine staatliche Regulierung der betrieblichen Personalvorsorge einsetzte.[40] In den Sozialwissenschaften wurde eine solche staatliche Sozialpolitik über das Steuerrecht auch schon als unsichtbarer oder verborgener Sozialstaat (hidden welfare state) bezeichnet.[41] Möglicherweise war es diese «Unsichtbarkeit», die es Max Huber in seinem Geleitwort zur immerhin 800-seitigen Dissertation von Hans Wirz erlaubte, mit Blick auf die Wohlfahrtseinrichtungen ein Hohelied auf die private Initiative, die freie Wirtschaft und die betriebliche Sozialpolitik anzustimmen.[42]
Eine spezialgesetzliche Regelung im Sinne von August Egger wäre allenfalls die Möglichkeit gewesen, dieses zunehmend unübersichtliche Dickicht von mehr oder weniger verborgenen steuerlichen (und stiftungsrechtlichen) Regeln durch klare und transparente (zivil-)rechtliche Grundsätze obsolet zu machen.[43] In dieser Lesart wäre die Spezialgesetzgebung sogar ein Beitrag gegen den staatlichen Bürokratismus und für eine Stärkung der zivilrechtlichen Rechtsstellung des Personals gewesen – aber um dies so zu sehen, hätte man Privatrecht nicht einfach mit der Freiheit und Freiwilligkeit der (Aktien-)Gesellschaft gleichsetzen dürfen.