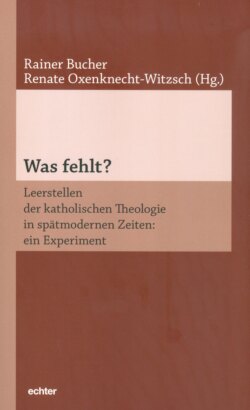Читать книгу Was fehlt? - Группа авторов - Страница 19
2.Studienzeit und Universität: Zu Beginn Übermaß – Am Ende Mangel
ОглавлениеDenke ich aber an den Beginn meiner Studienzeit, dann war nirgendwo ein Fehlen festzustellen. Aus der Perspektive eines Studierenden war von allem reichlich und manchmal viel zu viel vorhanden. Viele Fächer, viele Daten, viele Ansätze – und das alles unter dem Dach einer Theologischen Fakultät.
Vor einiger Zeit fand sich in der Zeitschrift der Katholischen Akademie in Bayern (zur debatte) der Abdruck eines interdisziplinären Gesprächs, das dem Thema „Glaube und Bildung“ verpflichtet war. Einstiegszitat war ein Satz des 2013 verstorbenen Innsbrucker Bischofs Reinhold Stecher. Was schuldet das Christentum einer Gesellschaft? Stechers Antwort: Bildung und Dialog. Und Bildung, so Kardinal Marx in diesem Gespräch, ist „mehr als ein Anpassungsprozess an die Wirtschaft“2. Lehrer der Religion, und damit waren für Marx nicht nur Religionslehrer gemeint, haben „Universalgenies“3 zu sein. Mit Bezug auf Johannes Röser wurde gefragt: „Wo sind die naturwissenschaftlich und technisch gebildeten Priester?“4, „Wo die Bildungspfarrer?“5.
Den Geist, der hinter diesen Sätzen steht – Welt in vielfältigster Weise verstehen zu wollen, damit ihr freundlich begegnet werden kann, um sie dann, und dann auch erst möglich, gern haben zu können –, meine ich in seinen Ausläufern in meiner Studienzeit in Eichstätt noch verspürt zu haben. In der Theologie gab es noch den Behringer-Lehrstuhl, also Naturwissenschaft und Technik explizit für Theologen. Verpflichtend waren auch die Vorlesungen bei Prof. Norbert Knopp (nicht Guido) – einem Kunstgeschichtler von Rang. „Die Architektur der Gotik“, so lautete der Titel einer seiner Vorlesungen. Wer sie besuchte, der wusste danach, dass man für die Frage, was Menschen von ihrem Gott gehalten haben, nicht auf Traktate angewiesen ist, sondern dass auch Steine vom Lobe Gottes künden können. Wenn man bereit ist, Sehen zu lernen.
Und die Philosophie kam ja noch hinzu. Auch sie war Teil des Theologiestudiums – für mich begeisternd, für nicht so wenige Priesteramtskandidaten eher eine unnötige, beschwerliche und wenig sinnvolle, wenngleich qualifizierte Behinderung auf ihrem „fokussierten“ und sehr geraden Weg zum Geistlichen.
Nein, nichts hat zu Beginn gefehlt – am Ende schon. Das Ende meiner Bekanntschaft mit der universitären Theologie war identisch mit der Streichung des Lehrstuhls für „Praktische Philosophie und Geschichte der Philosophie“, der innerhalb der Theologischen Fakultät verortet war.
Genauer und womöglich erhellender: der Lehrstuhl wurde nicht gestrichen, er wurde innerhalb der Universität umgewidmet – zugunsten eines Lehrstuhls für Informatik.
Da meinte ich zu spüren, über alle privat-berufliche Betroffenheit hinaus, dass mit der Aufgabe dieses Lehrstuhls nicht nur ein großer Teil der Philosophie aus dem theologischen Haus zieht, sondern dass sich mit diesem Auszug auch die Architektur des theologischen Hauses verändert. An seiner Fassade war das kaum zu sehen.
Anders formuliert: gerade durch den philosophischen Teilauszug zeigte sich für mich überdeutlich, dass der Geist der Philosophie zur Identität der Theologie gehört. Und nicht nur im Sinne einer Leitplanke, die es zum Beispiel verhindert, dass die Theologie eine von Spezialfragen geleitete, historische Wissenschaft wird.
Nun aber, seit über einem Jahrzehnt im Beratungsgewerbe, in Gesprächen mit Leitenden in Profit- und Non-Profit-Organisationen, mit Mittelständlern, Autobauern, Leitern von kommunalen Einrichtungen, Heimverantwortlichen, ist weder die Theologie noch die Theologische Fakultät ein Thema. Die Universität Eichstätt wird immer dann zum Thema, wenn Artikel, Pressemeldungen oder eine E-Mail aus der Verwaltung der Katholischen Universität Eichstätt an mich mir signalisieren, dass ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte der Präsidentensaga aufgeschlagen worden ist.
Zusammengefasst: Ich weiß nicht, was und ob überhaupt der Eichstätter Theologie heute etwas fehlt. Noch viel weniger aber weiß ich, was einer süddeutschen, einer deutschen, einer europäischen oder südamerikanischen oder Eine-Welt-Theologie fehlt.
Wenn ich zudem Theologie grundsätzlich fasse, als wissenschaftliche und, nicht notwendig, aber durchaus wünschenswert, universitäre Unternehmung, die die Reflexion einer gewesenen, aktuellen oder einer möglichen zukünftigen Glaubenspraxis betreibt, und ich damit Theologie von der Glaubenspraxis trenne, die ich in meinem Umfeld wahrnehme und deren Teil ich bin, dann fehlt der Theologie nichts, weil sie selbst fehlt, das heißt in meinem gesellschaftlichen Umfeld nicht vorfindbar ist.
An dieser Stelle kann ich Johanna Rahner nicht widersprechen, die in ihrer Einführung in die katholische Dogmatik schreibt: „So gehört es wohl zu den Grundbedingungen der christlichen Gottesrede, dass ihr niemand zuhört. Man steht mit einem Angebot da, für das keine Nachfrage besteht“6.