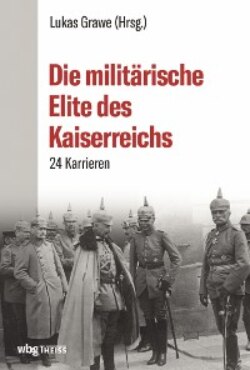Читать книгу Die militärische Elite des Kaiserreichs - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Generalfeldmarschall Kronprinz Rupprecht von Bayern
Оглавлениеvon Dieter J. Weiß
Als Prinz Rupprecht Maria Luitpold Ferdinand von Bayern am 18. Mai 1869 in München als Sohn des nachmaligen Königs Ludwigs III. und der Erzherzogin Marie Therese von Österreich-Este geboren wurde, war Bayern noch ein souveränes Königreich. Das eigenständige Heer unter dem König als Oberbefehlshaber in Friedenszeiten gehörte dann im Kaiserreich zu den Reservatrechten Bayerns. König Ludwig II. ernannte gemäß der Haustradition Prinz Rupprecht zu seinem 17. Geburtstag am 18. Mai 1886 zum Secondeleutnant, der freilich zunächst die Matura ablegen musste. Am 8. August 1886 begann er seinen aktiven militärischen Dienst im Infanterie-Leib-Regiment in München. Hier durchlief er die militärische Grundausbildung, neben Reiten, Schießen, Turnen, Bajonett-, Säbel- und Florettfechten erteilten ihm Lehrer der Kriegsschule ersten Unterricht in theoretischen Fächern.
Schon bis 1914 war das Leben Prinz Rupprechts wesentlich durch den Militärdienst geprägt gewesen.1 Bei der Wahl des Offiziersberufs hatte man ihn nicht gefragt, es war dies einer der wenigen für einen Prinzen seiner Zeit möglichen Aufgabenbereiche. Ob er nun eine innere Neigung zum Militärdienst spürte oder nicht, er hat sich dieser Aufgabe jedenfalls mit allem Pflichtgefühl und mit Erfolg unterzogen. Nach Ablauf von zwei Jahren wurde er von der Infanterie im Juni 1888 in das 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter versetzt. Seit dem Sommersemester 1891 hörte er an der 1867 gegründeten bayerischen Kriegsakademie Vorlesungen. Der aus ihren Absolventen rekrutierte bayerische Generalstab sollte neben dem preußischen „Großen Generalstab“ zumindest gleichrangig bestehen können. Im Rahmen des 23. Lehrgangs besuchte Rupprecht die Taktikvorlesungen, im zweiten Halbjahr hörte er dazu Kriegsgeschichte.
Der Militärdienst wurde durch ein breit angelegtes Studium an den Universitäten München und Berlin in Staats-, Geistes- und Naturwissenschaften durchbrochen. Im August 1891 nahm Prinz Rupprecht seinen aktiven Dienst wieder auf, im Herbst wurde er zum 1. Schweren Reiter-Regiment versetzt und zum Premier-Leutnant befördert. Beim 24. Lehrgang 1893/94 nahm Rupprecht am zweiten und dritten Kursus des Generalstabslehrgangs teil. Das Ziel der Ausbildung war dabei, ihn die Schule des Generalstabes durchlaufen zu lassen, um später dessen Aufgaben aus eigener Anschauung beurteilen zu können.2 Auch hier galten wie für seine ganze Ausbildung die Prinzipien Auswahl und Beschränkung.
Zu seinem 24. Geburtstag 1893 wurde Prinz Rupprecht zum Rittmeister befördert und ihm wurde die Führung der 2. Eskadron beim 1. Schweren Reiter-Regiment anvertraut. Für den begeisterten Reiter bedeutete der Dienst bei der Kavallerie ein Stück Lebensfreude. Im Oktober 1895 wurde er Hauptmann und Kompaniechef im Infanterie-Leib-Regiment, im Juni 1896 wurde er zum Major und Kommandeur des 1. Bataillons befördert. Drei Jahre wirkte er in dieser Stellung. In dieser Zeit studierte er das Werk Taktische und strategische Grundsätze der Gegenwart. Der Autor, General Sigismund W. von Schlichting, bezog gegen die Betonung des Drills in der militärischen Ausbildung Stellung und plädierte für ein stärkeres Gewicht der Gefechtsübung. Rupprecht schloss sich seinen Forderungen an und setzte sie nach seinen Möglichkeiten in die Praxis um.
Prinz Rupprecht durchlief rasch die militärische Laufbahn. Die Karrieren der Prinzen führten grundsätzlich schneller und direkter zu kommandierenden Posten als bei den übrigen Offizieren. Am 7. Oktober 1900 wurde der erst 31-jährige Prinz zum Generalmajor ernannt und nach Bamberg versetzt, wo er als Kommandeur der 7. Infanteriebrigade wirkte. Im Anschluss übernahm er als Generalleutnant das Kommando über die erste Division in München. Nach dem Abschied seines Onkels, des Prinzen Arnulf von Bayern, aus dem aktiven Dienst erhielt er die Stelle eines Kommandierenden Generals des I. Bayerischen Armeekorps. Am 19. April 1906 wurde Rupprecht zum General der Infanterie befördert.
In seiner neuen Funktion als Korpskommandant wurde er mit allen Angelegenheiten der Bayerischen Armee vertraut. In dem knappen Jahrzehnt bis zum Kriegsausbruch erhielt er in verantwortlicher Stellung eine gründliche Vorbildung für seine späteren Aufgaben als Feldherr. Einen erheblichen Teil seiner Dienstzeit beanspruchten Truppenbesichtigungen und Manöver. In dieser Zeit fanden eine fortschreitende Modernisierung der Armee, besonders bei der Artillerie, und der Aufbau einer Luftwaffe statt. Rupprecht pflegte einen offenen Führungsstil und wollte stets die Meinung seiner Stabsoffiziere hören.
Im Februar 1913 ernannte Prinzregent Ludwig seinen Sohn zum Generalobersten. Einen Monat später wurde Prinz Rupprecht zum Generalinspekteur der IV. Armeeinspektion des Deutschen Heeres berufen. Diese bildete keine direkte Kommandostelle, doch war der Generalinspekteur der designierte Befehlshaber für den Fall einer Mobilmachung. Ihm unterstanden nun drei bayerische und das III. preußische Armeekorps. So bestimmten die Notwendigkeiten der Heeresführung und große Manöver seinen Aufgabenbereich. Außerdem verlieh ihm der Prinzregent die Eigenschaft als direkter Vorgesetzter aller bayerischen Truppen. Mit der Thronbesteigung seines Vaters als König Ludwig III. im November 1913 wurde Rupprecht zum Kronprinzen von Bayern, wodurch sich seine Repräsentationsaufgaben noch vermehrten.
Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Sommer 1914 avancierte Generaloberst Kronprinz Rupprecht zum Oberbefehlshaber des 6. Armeekommandos, in dem die bayerischen Truppen zusammengefasst waren.3 Hier stellt sich die Frage, ob er als eigenständiger Feldherr wirkte oder nur, ähnlich dem Deutschen Kaiser, als Staffage für seinen militärischen Stab diente? Er war sich selbst der Problematik fürstlicher Oberbefehlshaber durchaus bewusst, doch hielt er ihre größere Entscheidungsfreudigkeit aufgrund ihres jüngeren Alters und der geringeren Notwendigkeit, persönliche Rücksichten nehmen zu müssen, für vorteilhaft.4
Kronprinz Rupprecht von Bayern auf einer Porträtaufnahme von 1914
Der Kronprinz wollte sich nicht auf eine repräsentative Rolle beschränken, sondern war stets über die aktuelle Entwicklung informiert und traf selbst die erforderlichen Entscheidungen. Er hielt sich nicht nur in seinem jeweiligen Hauptquartier hinter der Front auf, sondern besuchte immer wieder unter Lebensgefahr seine Soldaten in der Feuerlinie. Sein Arbeitstag war durch das Studium der eingehenden Meldungen seiner Truppen und der Anordnungen der OHL sowie durch Besprechungen mit seinem Stab geprägt. Persönlich besichtigte er die Schlachtfelder, um sich ein umfassendes Bild zu verschaffen. Während des gesamten Krieges führte er ein handschriftliches Tagebuch, das er nach dem Krieg in Auszügen veröffentlichen ließ.
Kronprinz Rupprecht erfuhr erst zu Kriegsbeginn den genauen Aufmarschplan der 6. Armee, der im Rahmen des Schlieffen-Plans die Aufgabe zugedacht war, die Reichslande Elsass-Lothringen zwischen Metz und Saarburg zu verteidigen und hier einen großen Teil des französischen Heeres zu binden. Da sich die Lage in den ersten Wochen nicht plangemäß entwickelt hatte, entschloss er sich zu einem Angriff, um die deutsche Strategie zu retten und die Hauptarmee auf dem rechten Flügel in Belgien und Nordfrankreich zu entlasten.5 Er befürchtete den Abzug französischer Truppen von seiner Front, die dem deutschen Hauptangriff in Nordfrankreich entgegengestellt würden. Rupprecht hatte dazu zwar keinen Befehl von der OHL, doch deckte diese sein Vorgehen. Der Angriffsbefehl vom 20. August 1914 war seine persönliche Entscheidung. Die Schlacht in Lothringen wurde ein Sieg der bayerischen Truppen, der bayerische Kronprinz wurde zunächst einheitlich als bedeutender Feldherr gefeiert. Bereits am 22. August sandte ihm Kaiser Wilhelm II. mit den Worten „Ich danke Gott mit Dir für den herrlichen Sieg“ das Eiserne Kreuz Erster und Zweiter Klasse. König Ludwig III. zeichnete seinen Sohn mit der höchsten bayerischen Kriegsdekoration aus, dem Militär-Max-Joseph-Orden. Erst später setzte bei Militärschriftstellern Kritik an diesem Angriff ein, die ein weiteres Zurückgehen der 6. Armee gewünscht hätten, um die gegnerischen Truppen in einer Umfassungsschlacht vernichtend zu schlagen.6
Die deutsche Strategie aber und damit die Voraussetzung für einen siegreichen Friedensschluss waren mit dem Scheitern des Schlieffen-Plans an der Marne bereits im September 1914 zusammengebrochen. Die 6. Armee wurde im Herbst zur Verstärkung des rechten Armeeflügels nach Flandern verlegt, wo sie sich weitgehend im Stellungskrieg festrannte.7 Diese Phase wurde durch Munitionsmangel und den Abtransport von Truppen an die Ostfront eingeleitet. Kronprinz Rupprecht entwickelte verschiedene strategische Konzepte, um den Stellungskrieg aufzubrechen.8
Das gespannte Verhältnis des bayerischen Kronprinzen zur OHL veränderte sich auch nach dem Wechsel an ihrer Spitze mit der Ernennung des Generalleutnants Erich von Falkenhayn kaum. Bereits im Oktober 1914 notierte Rupprecht, dass verschiedene gute Gelegenheiten für ein Vorantreiben einer Offensive verpasst worden seien. Scharf kritisierte er die ihm zaudernd und planlos erscheinende militärische Führung Falkenhayns, den er ohnehin für eine Fehlbesetzung hielt.9
Die Bedenken über die Strategie der OHL verließen Kronprinz Rupprecht während des weiteren Kriegsverlaufs nicht mehr. Dabei entwickelte er Alternativen für das militärische Vorgehen wie auch eigenständige Angriffspläne.10 Die Missachtung seiner Befehlsgewalt durch Falkenhayn sowie andere Ungeschicklichkeiten der OHL führten zu einer Beschwerdeschrift an den Kaiser.11 Nach dem Scheitern des Angriffs auf Verdun unternahm der Kronprinz im Juli des Jahres 1916 über den bayerischen Gesandten in Berlin einen Vorstoß beim Reichskanzler, Falkenhayn als Chef des Generalstabes absetzen zu lassen.12 Nach dem im Sommer 1916 von ihm mitausgelösten Sturz Falkenhayns wurde der kurz zuvor zum bayerischen wie zum preußischen Generalfeldmarschall ernannte Kronprinz Rupprecht im August 1916 als Oberbefehlshaber einer nach ihm benannten Heeresgruppe aus drei Armeen eingesetzt. Die Berufung Hindenburgs und Ludendorffs an die Spitze der OHL begrüßte er zunächst.
Ab dem Spätherbst 1916 plädierte Rupprecht für die Verkürzung der deutschen Westfront unter Aufgabe von Terrain. Schließlich stimmte die OHL dem Plan eines teilweisen Rückzuges in die sogenannte Siegfried-Stellung entlang der Linie Arras-St. Quentin-Soissons zu, die hinter der Kampffront als Auffangstellung aufgebaut werden konnte. Freilich wollte der Kronprinz die deutsche Armee nicht auf die Defensive beschränken, sondern erstrebte durch Konzentration aller Kräfte Rückhalt für neue Offensiven. Der Rückzug in die Siegfried-Stellung wurde am 4. Februar 1917 befohlen und bis in den März ausgeführt.13 Im Räumungsgebiet mussten auf Anordnung der OHL alle Einrichtungen zerstört werden, die für gegnerische Zwecke militärisch hätten nutzbar sein können. 140.000 Einwohner wurden ins Hinterland deportiert. Rupprecht drohte wegen dieser Gewaltmaßnahmen sogar mit seinem Rücktritt.14
Der Kronprinz bemühte sich, sinnloses Blutvergießen zu vermeiden und die Zivilbevölkerung nicht unter den Folgen des Krieges leiden zu lassen. So kritisierte er das Niederbrennen von Dörfern und Plünderungsaktionen und versuchte, derartige Vorkommnisse durch Befehle zu verhindern, weil sie nachrückende deutsche Truppen behinderten, aber auch aus humanitären Gründen.15 Bevor seine aus dem Elsass abgezogenen Truppen im September 1914 erneut französischen Boden betreten sollten, erließ er einen Tagesbefehl über das Verhalten gegenüber der feindlichen Zivilbevölkerung.16 Dabei mahnte er zur Vorsicht vor Überfällen hinter der Frontlinie, gebot rücksichtsvollen Umgang mit den Einwohnern und untersagte Plünderungen streng.
Als Hauptgegner betrachtete Kronprinz Rupprecht stets die Briten.17 Als Ende Oktober 1914 erstmals britische Truppen der 6. Armee gegenüberstanden, ließ er sich in einem Tagesbefehl zu seinem härtesten Ausspruch hinreißen: „Darum, wenn es jetzt gegen diesen Feind geht, übt Vergeltung wider feindliche Hinterlist für so viele schwere Opfer! Zeigt ihnen, daß die Deutschen nicht so leicht aus der Weltgeschichte zu streichen sind, zeigt ihnen das durch deutsche Hiebe von ganz besonderer Art!“18 Die alliierte Propaganda nutzte diese markige Äußerung weidlich als Beleg für die brutale deutsche Kriegführung aus. Dabei bemühte sich Rupprecht um einen menschlichen Umgang mit den Kriegsgefangenen.
Kronprinz Rupprecht beschäftigte sich mit dem in der deutschen Öffentlichkeit viel diskutierten Problem des U-Boot-Krieges, durch den die britischen Nachschublinien unterbunden werden sollten. Lange blieb er aus Rücksicht auf die Haltung der neutralen Staaten Gegner eines uneingeschränkten U-Boot-Krieges, obwohl er darauf keinen direkten Einfluss nehmen konnte. Im Februar 1915 eröffnete die deutsche Marine den U-Boot-Handelskrieg.19 Als Rupprecht erfuhr, dass die britische Admiralität ihre Handelsflotte angewiesen habe, unter neutraler Flagge zu fahren, plädierte er für den Kampfeinsatz von U-Booten.20
Im Januar und Februar 1916 wurden im Deutschen Reich Forderungen nach der uneingeschränkten Führung des U-Boot-Krieges erhoben, um Großbritannien in sechs Monaten zum Frieden zwingen zu können.21 Kronprinz Rupprecht informierte den bayerischen Außenminister über die von ihm geteilte Anschauung Admiral Ludwig von Schröders, dass dies aus militärischen Gründen nicht realistisch sei.22 Die OHL versuchte nun, Großbritannien durch den Angriff auf Verdun und durch den unbeschränkten U-Boot-Krieg niederzuringen. Die Kämpfe vor Verdun wurden unter Einsatz der modernen Massenvernichtungswaffen wie Giftgas geführt. Rupprecht verurteilte dieses Vorgehen, ohne es freilich verhindern zu können. Ethische und taktische Motive flossen dabei zusammen: „Als Dr. Haber mit General von Falkenhayn vor der ersten Anwendung bei mir weilte, verhehlte ich nicht, daß mir das neue Kampfmittel des Gases nicht nur unsympathisch erschiene, sondern auch verfehlt, denn es sei sicher anzunehmen, daß, wenn es sich als wirksam erwiese, der Feind zum gleichen Mittel greifen würde und bei der vorherrschenden westöstlichen Windrichtung zehnmal öfter gegen uns Gas abblasen könnte, als wir gegen ihn.“23
Als die Kriegslage für das Deutsche Reich immer verzweifelter wurde, kam Kronprinz Rupprecht im Herbst 1916 zu der Überzeugung, dass jetzt keine Rücksicht mehr auf die neutralen Staaten zu nehmen sei, weil die Nachschubzufuhr zu ihnen durch die alliierte Blockade ohnehin abgeschnitten wäre.24 Die Hungerblockade der deutschen Küsten durch britische Schiffe führte ihn zur Forderung, mit gleichen Mitteln zu antworten. Dabei war er sich bewusst, dass der uneingeschränkte U-Boot-Krieg den Kriegseintritt der USA bedeuten würde, deren militärische Schlagkraft er nicht so eklatant unterschätzte wie die OHL.25 Allerdings schwankte er in seinem Urteil über den U-Boot-Krieg, wirklichen Einfluss auf die Entwicklung konnte er ohnehin nicht nehmen.
Immer stärker wurde im Verlauf des Weltkrieges die Zivilbevölkerung nicht nur Opfer von Kämpfen, sondern ganz gezielt in die militärischen Auseinandersetzungen einbezogen. Die Ausweitung des Krieges durch Bombardements aus der Luft verurteilte Kronprinz Rupprecht scharf und intervenierte gegen die deutschen Luftangriffe auf britische Städte. Der Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Kaiser, Karl Georg von Treutler, konnte ihm im Januar 1915 mitteilen, dass wegen seiner Bedenken weitere Luftangriffe auf London verboten würden.26 Trotzdem wurden die Bombenabwürfe später fortgesetzt. Im folgenden Jahr sprach Rupprecht sich erneut gegen das Bombardement feindlicher Städte aus, weil es keinen Nutzen brächte und den Gegner nur zu Repressalien herausforderte.27 Die Bombenabwürfe aus Zeppelinen über London verurteilte er außerdem als militärisch unnütz. Deshalb protestierte er auch im Juli 1918 beim Reichskanzler gegen den Abwurf von Brandbomben über Paris.28
Zu Beginn des Krieges war Kronprinz Rupprecht von einem Erfolg der deutschen Waffen überzeugt und teilte zunächst die Kriegsziele seines Vaters König Ludwigs III. Zur Stärkung des Föderalismus hielt er eine Erweiterung Bayerns im Elsass für geboten, für das Reich erhob er Annexionsansprüche gegenüber Belgien, obwohl ihn mit seinem Schwager, dem belgischen König Albert, bis zum Kriegsausbruch eine herzliche Freundschaft verbunden hatte. Noch im Frühjahr 1915 hing Rupprecht der Vorstellung eines Siegfriedens mit Annexionen an.29 Die Westgrenze des Deutschen Reiches sollte so weit vorgeschoben werden, dass ihm Luxemburg, Nordfrankreich, Belgien und die Niederlande einverleibt werden würden.30 Der geplante Trialismus Preußen – Bayern – Niederlande in einem Staatenbund in Anlehnung an das 1806 untergegangene Alte Reich hätte eine völlig neue Konstellation für die Reichs- wie die Europapolitik bedeutet.31 Dieses Projekt war weniger Ausfluss nationalistischen Größenwahns als ein Versuch, die Hegemonie Preußens in der Nachkriegsordnung zu begrenzen.
Die Schwere der eigenen Verluste und die Einsicht, dass es unmöglich sei, einen positiven Kriegsausgang mit Waffen zu erzwingen, wandelten Kronprinz Rupprecht aber vom Anhänger eines Sieg- zum Verfechter eines Verständigungsfriedens.32 Er erkannte ab dem Herbst 1915, dass der Krieg nicht fortgesetzt werden dürfte. Erste Überlegungen zur Friedensproblematik hatte bei ihm im Januar 1915 eine angebliche Wiener Äußerung ausgelöst, Österreich-Ungarn könne den Krieg nur bis in den März durchhalten.33 Im Oktober 1915 wies der Kronprinz General von Falkenhayn auf die Notwendigkeit eines baldigen Friedensschlusses hin, weil es unmöglich sei, aus dem Stellungskrieg herauszukommen.34 Dies erfordere die Herausgabe der besetzten Gebiete in Frankreich und Belgien, ohne eine ins Gewicht fallende Kriegsentschädigung zu erhalten. Auch in einem Gespräch mit Reichskanzler Bethmann Hollweg äußerte er diese Auffassung.35
Militärische, föderalistische und innenpolitische Argumente ließen bei Kronprinz Rupprecht seit dem Frühjahr 1916 immer stärker die Überzeugung wachsen, dass ein Friedensschluss dringend geboten sei. Um dieses Ziel zu erreichen, konnte er aber nur versuchen, auf König Ludwig III. einzuwirken, bei dem er allerdings wenig Gehör fand. Bayern besaß ohnehin nicht die Möglichkeit, Kaiser und Reich zu einem Friedensschluss zu veranlassen. Im Juni 1916 teilte er dem bayerischen Außenministerium mit, dass er die Hoffnung auf durchschlagende Erfolge und einen Durchbruch an der Westfront aufgegeben habe.36 Die Anerkennung der völligen Unabhängigkeit Belgiens hielt er nunmehr für eine notwendige Friedensbedingung.
Gefährliche Ansätze zu einer völligen Verkehrung der Autoritätsverhältnisse im Reich beeinträchtigten diese Bemühungen. Die OHL unter Hindenburg und Ludendorff erstrebte zunehmend stärkeren Einfluss auf die Politik, wodurch die Friedensbemühungen unterlaufen wurden. Der bayerische Kronprinz stimmte den Überlegungen des Zentrumsabgeordneten Matthias Erzberger zur Friedensfrage zu, doch wollte er eine öffentliche Diskussion vermeiden, um die Siegeszuversicht der Gegner nicht anzustacheln.37 Wenige Tage nach dem Sturz Bethmann Hollwegs erließ die Reichstagsmehrheit aus Zentrum, Fortschrittlicher Volkspartei und Sozialdemokraten am 19. Juli 1917 eine Friedensresolution, in der ein Verständigungsfriede unter Verzicht auf Eroberungen gefordert wurde. Rupprecht war mit ihrem Inhalt einverstanden, hielt aber den Zeitpunkt für verfehlt.38
Immer stärker schaltete Kronprinz Rupprecht sich in die politischen Abläufe ein. Seine politischen Vorstellungen zur aktuellen Kriegslage, zur Notwendigkeit eines raschen Friedensschlusses und zur Wahrung der Souveränität Bayerns fasste er in einem umfangreichen Memorandum vom 19. Juli 1917 für den Vorsitzenden im bayerischen Ministerrat, Außenminister Graf Georg Hertling, zusammen. Dringend forderte er einen raschen Friedensschluss mit Russland unter Verzicht auf Annexionen. In der bevorstehenden Kampfpause nach der feindlichen Sommeroffensive sollten über die Könige von Spanien oder Schweden den Gegnern auf dem westlichen Kriegsschauplatz die deutschen Kriegsziele mitgeteilt werden, „die sich auf die Erreichung des status quo ante bellum unter Verzicht auf doch nicht einzutreibende Entschädigung beschränken müssen. An der Forderung der Rückgabe der Kolonien darf die Erreichung des Friedens nicht scheitern.“39 Graf Hertling aber verstand die Dringlichkeit der Darlegungen nicht.
Bei der Feier der Goldenen Hochzeit seiner Eltern im Februar 1918 offenbarte Kronprinz Rupprecht dem Deutschen Kaiser unverblümt seine Ansicht über die Kriegslage, was zu einer Verstimmung führte.40 Der Friede von Brest-Litowsk mit Sowjetrussland vom 10. März 1918 und zeitweilige militärische Erfolge der Frühjahrsoffensive in der Picardie lösten wieder Annexionsforderungen bei Wilhelm II. und der OHL aus. Rupprecht musste dagegen zunehmende Missstimmung unter den deutschen Truppen konstatieren, die ein Ende des Krieges unter allen Umständen herbeisehnten.41 Angesichts der sich rapid verschlechternden militärischen Lage und der Ergebnislosigkeit seiner bisherigen Mahnungen richtete Kronprinz Rupprecht am 1. Juni 1918 erneut einen dringenden Friedensappell an den zum Reichskanzler avancierten Graf Hertling.42
Zwei Monate später nutzte Kronprinz Rupprecht einen kurzen Heimaturlaub zu politischen Gesprächen, um auf die Notwendigkeit eines raschen Friedensschlusses hinzuweisen.43 Am 15. August beschloss nun auch der bayerische Ministerrat, die Reichsregierung zum raschen Abschluss eines Verständigungsfriedens aufzurufen; nicht nur, weil sich die militärische Situation weiter verschlechtere, sondern auch, weil sonst eine Initiative durch den Reichstag und damit eine fortschreitende Parlamentarisierung des Reiches drohe.44
Kronprinz Rupprecht verfügte nur über geringe Möglichkeiten, seine Einsichten umzusetzen. Zum einen war er in vorgegebene Befehlsstrukturen eingebunden, zum anderen war er der Erbe und nicht der Träger der Krone. Er konnte keine politischen Entscheidungen durchsetzen, sondern nur Vorschläge unterbreiten. Als Offizier musste er sich von der Politik fernhalten, als Thronfolger war er verfassungsmäßig auf die Mitarbeit im Staatsrat und im Reichsrat beschränkt, an deren Sitzungen er während des Krieges nicht teilnehmen konnte. Um einen Friedensschluss zu erreichen, konnte er nur versuchen, auf König Ludwig und die bayerische Regierung einzuwirken.
Im Herbst 1918 war Kronprinz Rupprecht fern von den Entscheidungszentren in seinem Hauptquartier in Brüssel festgehalten.45 Schließlich war er von der Notwendigkeit des Rücktritts des Kaisers und dem Abschluss eines Friedens auch unter harten Bedingungen überzeugt. Am 1. November versuchte er Ludwig III. vorsichtig dazu zu bringen, die Initiative zu ergreifen und den Kaiser zur Abdankung zu bewegen.46 Einen Tag später wurde nach langwierigen Verhandlungen die bayerische Regierung auf parlamentarischer Basis umgebildet. Doch dies war zu spät, um die Münchner Revolution vom 7. November verhindern zu können. Kronprinz Rupprecht protestierte am 10. November 1918 gegen die ohne Legitimation erfolgte „politische Umwälzung, die ohne Mitwirkung der gesetzgebenden Gewalten und der Gesamtheit der bayerischen Staatsbürger in Heer und Heimat von einer Minderheit ins Werk gesetzt wurde“,47 und wollte die Entscheidung über die Staatsform einer aus freien Wahlen bestimmten Nationalversammlung anvertrauen.48 Er konnte sich nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands nicht länger in Brüssel, nach der Niederlegung des Oberkommandos wollte er sich nicht weiter beim Heer aufhalten. Da ihm der direkte Weg in die Heimat durch die revolutionären Unruhen verschlossen war, wählte er die Reiseroute über die neutralen Niederlande.
Kronprinz Rupprecht musste sich nach seiner Heimkehr in gänzlich veränderte Umstände fügen. Zunächst besaß er keinen Wohnsitz mehr, er verfügte weder über Besitz noch über Einkommen. Er war überzeugt, dass an eine Wiedererrichtung der Monarchie zu Lebzeiten seines Vaters nicht zu denken sei. Zu der Sorge um Bayern in den revolutionären Wirren und seine eigene ungesicherte persönliche Existenz war die Gefahr einer Auslieferung an die Siegermächte dazugekommen. Im Vertrag von Versailles vom 28. Juni 1919 musste Deutschland sich zur Anerkennung der Kriegsschuld sowie zur Auslieferung des Kaisers und aller „Kriegsverbrecher“ verpflichten. Sein Name stand auf der Auslieferungsliste der Ententemächte vom 3. Februar 1920 von 895 führenden deutschen Militärs.49 Frankreich warf ihm vor, den Befehl gegeben zu haben, keine britischen Gefangenen zu machen, sondern sie zu töten. Diese wie andere Vorwürfe bestritt er vehement und konnte dies durch Zeugenaussagen belegen. Schließlich überließen die Siegermächte die Prozessführung gegen die wegen Kriegsverbrechen beschuldigten Personen der deutschen Gerichtsbarkeit. Das Reichsgericht erklärte alle gegen Kronprinz Rupprecht erhobenen Beschuldigungen „für haltlos und widerlegt“, das Verfahren wurde am 4. Juni 1923 endgültig eingestellt.
Mit dem Tod seines Vaters König Ludwigs III. am 18. Oktober 1921 übernahm Kronprinz Rupprecht dessen Thronansprüche, ohne diese konkret umsetzen zu wollen.50 Ein vorläufiges Ende fand die direkte Revolutionszeit mit der Regelung der Versorgungsansprüche des Königshauses durch die Einrichtung des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) im Jahr 1923. Nun war ein Weg gefunden, der es Kronprinz Rupprecht und den übrigen Angehörigen des Königshauses ermöglichte, repräsentative Aufgaben zu übernehmen und damit zur Beruhigung der politischen Verhältnisse in der Zwischenkriegszeit beizutragen.
Der Kronprinz hielt sich von den politischen Alltagsgeschäften fern, repräsentierte aber bei zahlreichen Versammlungen nicht nur von Patriotenund Kriegervereinen in ganz Bayern wie ein Souverän.51 Für weite Kreise der Bevölkerung wirkte er als Identifikationsfigur, die in der schweren Not von Nachkriegszeit und Inflation Halt und Orientierung bot. Sein Verhältnis zum Nationalsozialismus war ähnlich wie bei der Bayerischen Volkspartei (BVP) und der katholischen Kirche durch grundsätzliche Ablehnung gekennzeichnet.52 Seit sich zum Jahresende 1932 die Gefahr einer nationalsozialistisch dominierten Reichsregierung immer drohender abzeichnete, schien die Ausrufung der Monarchie als letztes Rettungsmittel für Bayern in greifbare Nähe gerückt, was aber scheiterte.53
Nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler protestierte Kronprinz Rupprecht mehrfach gegen die praktische Aufhebung der Länder und plädierte für eine neue Verfassung, um das Verhältnis zwischen Reich und Ländern im Sinne Bismarcks zu regeln.54 Als dies ungehört verhallte, zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück, stand aber unter Beobachtung des nationalsozialistischen Regimes. Kein Wittelsbacher trat der NSDAP oder einer ihrer Formationen bei, was als deutliche Ablehnung verstanden wurde. Während des Zweiten Weltkriegs ging Rupprecht ins Exil nach Italien, seine Familie war harter Verfolgung und KZ-Haft ausgesetzt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte er nach Deutschland zurück und starb am 2. August 1955 auf Schloss Leutstetten.
Kronprinz Rupprecht war ein erfolgreicher Feldherr, der Sieger in der Schlacht von Lothringen, ein strategischer Kopf, der verschiedene Konzepte entwarf, den Stellungskrieg aufzubrechen, und der den erfolgreichen Rückzug in die Siegfried-Stellung plante. Scharfe Kritik übte er an dem zunehmenden Einfluss des Generalstabschefs wie der Stabschefs der einzelnen Armeekorps sowohl auf die militärischen Entscheidungen wie auf die Politik.55 Er war aber auch der bayerische Thronfolger und überblickte aus dieser Verantwortung stets mehr als das reine Kampfgeschehen. Aus seiner realistischen Einschätzung der Kriegsentwicklung wandelte er sich ab dem Herbst 1915 vom Anhänger eines Sieg- zu dem eines Verständigungsfriedens. Frühzeitig erkannte er die drohenden Gefahren von Niederlage und Revolution, doch konnte er seine Erkenntnisse nicht durchsetzen. Auch eine Persönlichkeit im Rang des bayerischen Thronfolgers war eingebunden in vorgegebene politische und militärische Strukturen. So bleibt etwas von Tragik um die Gestalt seiner Persönlichkeit. Im Zentrum seines politischen Denkens stand stets Bayern, bei seinen Überlegungen zum Sieg wie zum Frieden, in der Zeit der Monarchie wie anschließend in der des Freistaates.