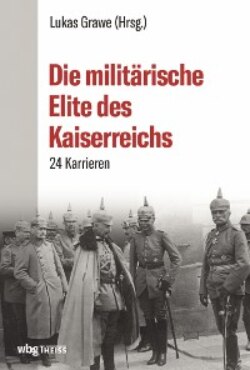Читать книгу Die militärische Elite des Kaiserreichs - Группа авторов - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Oberst Max Bauer
Оглавлениеvon Heiko Suhr
Am 31. Januar 1869 kam Max Bauer in Quedlinburg als Sohn des Stadtrates Friedrich Carl Bauer zur Welt.1 Der Familientradition folgend begann der junge Bauer nach erfolgreicher Reifeprüfung 1888 ein Studium der Rechtswissenschaften in Berlin, brach dieses aber aus finanziellen Gründen nach nicht einmal einem Semester ab und trat noch im selben Jahr in das 2. Fußartillerie-Regiment in Swinemünde ein. Nach dem Besuch der Kriegsschule in Hannover tat Bauer Dienst bei der Fußartillerie in Danzig-Neufahrwasser, Swinemünde und Metz. Eine erste richtungsweisende Kommandierung erfolgte im Januar 1899 mit seinem Eintritt in die Artillerieprüfungskommission, wo er zunächst als Assistent und später – ab Januar 1890 befördert zum Sekondeleutnant – als Adjutant des Präses fungierte. Hier wurden ihm fundierte technische Kenntnisse des Geschützbaus vermittelt. Ab 1902 war Hauptmann Bauer Batterie-Chef im Fußartillerie-Regiment Nr. 7 in Westfalen.
1905 wurde er dann zur Festungsabteilung im Großen Generalstab kommandiert, nachdem er bei einem vorangegangenen Bataillons-Schießen durch unkonventionelle Taktik und selbstkritisches Verhalten positiv aufgefallen war.2 Im Großen Generalstab war er für die russischen Festungen zuständig und erstellte bald eine Denkschrift über die Narew-Befestigungen, die er erstmals in ihrer Gesamtheit analysieren wollte. Mangels verfügbarer schriftlicher Zeugnisse begab er sich getarnt als Holzhändler nach Warschau, um von dort einzelne Erkundungsreisen zu unternehmen. Da während der revolutionären Wirren die militärische Wachsamkeit eher gering ausfiel, konnte er mehrere Festungen auch von innen erkunden und abschließend urteilen, dass sich die Festungen in „überaus kläglichem Zustand“ befänden.3 In einer zweiten Spionagereise begab er sich erneut nach Russland, um sich nun auch der schweren Artillerie zu widmen. Dabei kam er wieder zu sehr skeptischen Einschätzungen, aus denen er schlussfolgerte, dass auch die japanische schwere Artillerie – man stand sich im Sommer 1905 in Port Arthur in einer verlustreichen Schlacht gegenüber – nicht sonderlich leistungsfähig gewesen sein konnte. Da dies der Lehrmeinung im Großen Generalstab widersprach, kam es zu ersten Auseinandersetzungen mit seinen Vorgesetzen. Fernab seines eigentlichen Aufgabenspektrums fertigte Bauer als direkte Folge aus dem Konflikt bis Ende 1906 eigenmächtig eine Denkschrift über schwere und schwerste Artillerie aus technischer, organisatorischer und taktischer Perspektive an. Dazu pflegte er – den üblichen Verhaltensweisen des Generalstabs durchaus widersprechend – enge private Kontakte zu den führenden Ingenieuren der Rüstungsdynastie Krupp in Essen. Weil sich einige Feldversuche als überaus erfolgversprechend erwiesen, konnte Bauer den eigentlich zuständigen Leiter der Aufmarschabteilung Oberst Hermann Stein auf seine Seite ziehen, womit er fortan im Generalstab „freie Bahn“ hatte.4 Steins Nachfolger Erich Ludendorff holte Bauer dann im September 1909 zur Aufmarschabteilung, womit eine äußerst enge und folgenreiche Zusammenarbeit ihren Anfang fand. Zu seinen Aufgaben gehörten nun unter anderem die Organisation der Spezialtransporte der schweren Artillerie, die Entwicklung neuer Taktiken zum Sturm von gegnerischen und auch die Erörterung der Mobilmachung deutscher Festungen. Bauer setzte sich also recht früh mit Fragen der kriegswirtschaftlichen Organisation und der wirtschaftlichen Mobilmachung insgesamt auseinander. Der im März 1911 zum Major beförderte Offizier blieb – abgesehen von einer etwa einjährigen Kommandierung 1912 als Generalstabsoffizier bei der 39. Division in Colmar/Elsass – bis Kriegsausbruch im Großen Generalstab. Seine Beförderungen verliefen bis dahin zwar den Richtlinien entsprechend, aber man muss trotzdem schon von einer Laufbahn sprechen, die über die normalen Erwartungen hinausging, da Bauer – ohne je die Kriegsakademie besucht zu haben – fester Bestandteil des Großen Generalstabs war.
Das komplexe und vielschichtige Wirken von Max Bauer in den Jahren des Ersten Weltkrieges kann hier nicht in seiner Gesamtheit beleuchtet werden. Bauers Einfluss auf die Einführung und die Entwicklung des Gaskrieges vor dem Hintergrund des industriellen Massenkriegs taugt aber als Fallstudie, um sein Wirken an den Schnittstellen von Militär, Industrie und Wissenschaft zu konkretisieren. Seine Ränkespiele gegen Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg sollen außerdem kurz gestreift werden. Ab dem 1. August 1914 fungierte Bauer als Leiter der Sektion II (schwere Artillerie und Festungen) der Operationsabteilung des Generalstabs des Feldheeres. Zum 16. Juli 1915 wurde er Chef der Operationsabteilung II. Mit dem Wechsel zur dritten OHL erhielt Bauers Abteilung eine entscheidende organisatorische Aufwertung durch die Angliederung der aufgelösten Stelle des Feldmunitionschefs und durch die Einrichtung einer kriegswirtschaftlichen Sektion. Bauer wuchs damit mehr und mehr zu Ludendorffs Fachmann für die Reorganisation der gesamten Kriegswirtschaft heran und konnte daraus auch innenpolitischen Einfluss ableiten. Im März 1916 wurde er zum Oberstleutnant und im August 1918 schließlich zum Oberst befördert. Ludendorff sorgte schließlich wegen seines – durchaus umstrittenen – Einflusses auf die Entwicklung der schweren Artillerie für Bauers Auszeichnungen mit der Ehrendoktorwürde der Universität Berlin und dem Pour le Mérite.
Beim 30jährigen Regierungsjubiläum im Großen Hauptquartier in Spa, 15. Juni 1918: Kaiser Wilhelm II. im Gespräch mit Oberst Max Bauer
Unmittelbar nach Kriegsausbruch dachte wohl keine der Krieg führenden Nationen ernsthaft an den Einsatz chemischer Giftstoffe.5 Fritz Haber – Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie und Elektrochemie – brachte das Hauptproblem zugespitzt auf einen Nenner: Militärs, Wissenschaftler und Techniker würden zwar „unter demselben Dache“ leben, sich „auf der Treppe“ auch grüßen, aber es gebe keinerlei „Ideenaustausch“. Erst nachdem sich nach der Schlacht an der Marne Anfang September 1914 die überaus prekäre Munitionsversorgung vollauf gezeigt hatte, nahm die ernsthafte Entwicklung von Gaskampfstoffen im Deutschen Reich ihren Anfang. Haber und der Physikochemiker Professor Walther Nernst – zwei spätere Chemienobelpreisträger – sorgten für die wissenschaftliche Expertise. Der Chef des Generalstabs des Feldheeres Falkenhayn beauftragte im Oktober 1914 den Artillerie-Experten Bauer, die entsprechenden Entwicklungen anzustoßen. Basierend auf den vorhandenen Kontakten zur Wissenschaft wandte sich Bauer an den für den Aufstieg Leverkusens zur Chemiestadt verantwortlichen Generaldirektor der Bayer AG Carl Duisberg. Zu ersten Versuchen auf dem Fußartillerie-Schießplatz in Köln-Wahn trafen sich dann die von Bauer zu einer Sonderkommission zusammengestellten Duisberg, Nernst und der im Kriegsministerium tätige Theodor Michelis. Bauer selbst war – entgegen gängiger Darstellungen – kein Mitglied dieser Kommission, sondern übermittelte als Impulsgeber deren Ergebnisse an die OHL.6
Zunächst konzentrierte man sich auf die Entwicklung sogenannter „Niespulver“ – Augen, Nasen und den Rachenbereich reizend –, die erstmals im Oktober 1914 an der Westfront mit geringem taktischem und strategischem Nutzen getestet wurden. Ab Januar 1915 begannen erste Tests mit Chlor, das in der chemischen Industrie massenhaft als Nebenprodukt vorhanden war. Auf Vorschlag Duisbergs wurde bald das weit toxischere Phosgen beigemengt. Chlor wurde im April 1915 erstmals an der Westfront verwendet. Dazu wurden spezielle Gastruppen aufgestellt, um die technische Umsetzung zu professionalisieren. Zu diesen beorderte Max Bauer unter anderem die späteren Nobelpreisträger Otto Hahn, James Franck und Gustav Hertz. Die Entwicklungen waren aber noch überaus improvisiert, liefen größtenteils mehrgleisig und in direkter Konkurrenz. Aus Bauers Sicht musste der Hauptzweck der von ihm zusammengestellten Kommission und der ersten Versuche sein, die vorhandene Skepsis der OHL und besonders Falkenhayns gegenüber Gaskampfstoffen zu brechen. Dies gelang vollkommen, wie der Übergang von Reizstoffen zu potenziell tödlichen Kampfstoffen zum Jahreswechsel 1914/1915 zeigt. Die weitere Entwicklung des Gaskrieges, entstandene Probleme wie die Abhängigkeit von den Windverhältnissen und Gegenmaßnahmen wie Gasmasken sollen hier übersprungen werden. Auffallend sind die überaus geringen Hemmungen der beteiligten Personen. Bauer selbst hielt nach dem Krieg ein Verbot chemischer Kampfmittel für einen Widerspruch gegen jeden „Grundsatz technischer Kulturentwicklung“.7 Haber argumentierte, dass chemische Kampfstoffe den Krieg insgesamt abkürzen und somit Menschenleben retten würden. Bauers Rolle war es auch, bei seinen Vorgesetzten und den beteiligten Wissenschaftlern und Industriellen Widerstände gegen den massenhaften Einsatz tödlich wirkender Gaskampfmittel zu brechen.
Bauer war nicht nur die entscheidende Figur bei der Genese des Gaskrieges durch das Zusammenbringen militärischer, industrieller und wissenschaftlicher Vertreter, sondern auch einer der wenigen Militärs, der vom Wert der Gaskampfmittel restlos überzeugt war. Zusammen mit dem für die Detailplanung verantwortlichen Hermann Geyer war er derjenige, der die operativen Entscheidungen des Gaseinsatzes traf und dafür von Ludendorff fast völlige Handlungsfreiheit erhielt. Das Verhältnis zu Carl Duisberg illustriert in auffälliger Weise sowohl Bauers Rolle als auch seine Charakterzüge. Auf funktioneller Ebene zeichnete Max Bauer dafür verantwortlich, auf informellen Wegen strukturelle Hemmnisse bei der Umsetzung des Gaskampfes abgebaut bzw. schlicht andere Beteiligte – wie die Artillerieprüfungskommission (Apeka) – ausgeschaltet zu haben. Duisberg schrieb im Oktober 1915, dass Bauers Eingreifen „Wunder getan“ hätte und er von der Apeka schließlich zu weiteren Versuchen aufgefordert worden sei. Im März 1916 beschwerte sich Duisberg bei Bauer, dass der „heilige Bürokratismus“ bei der Apeka und im Kriegsministerium seine Bemühungen um den Gaskrieg ausbremsen würde. Bauer solle doch bald eingreifen, damit „die so schön ins Werk gesetzte neue Waffe“ nicht einschlafe.8 Auf persönlicher Ebene zeigt die Korrespondenz der beiden Max Bauers große Beeinflussbarkeit, die schon Walter Nicolai negativ aufgefallen war.9 Duisberg hat sich diese Schwäche gezielt zunutze gemacht, indem er Bauer schmeichelnd nicht nur als „Vater und Anstifter“ einzelner Gaskampfmittel, sondern gar als „Spiritus rector“ der gesamten Entwicklung des deutschen Gaskrieges titulierte.10
Weiterhin stand das für die Kriegsführung „untragbare System Bethmanns“ (Walter Nicolai) Bauers Auffassung des totalen Krieges im Weg, sodass er bald gezielt nach Schwachstellen seines Gegners suchte, um Druck auf den Reichskanzler aufzubauen. Material für seine Agitation erhielt Bauer aus Industriekreisen unter anderem von Carl Duisberg. Ein erster Faktor war dabei die Reform des preußischen Wahlrechts, die Bauer kategorisch ablehnte. Es sei ein „Unglück“, dass diese Frage im Krieg überhaupt angeschnitten worden sei, denn ein reformiertes Wahlrecht würde das Ende Preußens und Deutschlands als Monarchie bedeuten.11 Dieser Aspekt war vor allem für Bauer deswegen von Belang, weil die OHL nicht direkt gegen den Reichskanzler als engen Vertrauten des Kaisers vorgehen konnte. Erst als sich der Reichskanzler mit seiner recht moderaten Haltung in der Frage der Wahlrechtsreform zunehmend selbst isolierte, bot sich eine Chance, Bethmann Hollweg anzugehen. Dafür instrumentalisierte Bauer als Nächstes die Debatte um den rücksichtslosen U-Boot-Krieg, den er retrospektiv als „nötig und erfolgversprechend“ ansah.12 Das Beispiel des U-Boot-Krieges – Kaiser und Reichskanzler hatten in ihrer ablehnenden Haltung in dieser Frage den Militärs jahrelang Paroli geboten – zeigt deutlich die Vermischung militärischer und politischer Ziele bei Bauer. Er verstand die politische Diskussion um den U-Boot-Krieg vor allem als Vehikel, um weiter gegen den Reichskanzler vorzugehen. Bauer ging es insgesamt also deutlich um die völlige militärische Dominanz über politische Erwägungen. Der Krieg war für ihn so einschneidend, dass sich die deutsche Außen- und Innenpolitik ohne Vorbehalt dem militärisch Notwendigen zu beugen habe. Diese Pervertierung des berühmten Clausewitz-Zitates legt nahe, dass es für Bauer im Krieg weder Innenpolitik allgemein noch speziell Diskussionen um Parteien und Parlamentarismus geben dürfe. Clausewitz erwecke – so Bauer – mit seinem Zitat den Anschein, dass derjenige, der den Krieg leite, unter demjenigen stehe, der die Politik bestimme. Der Kriegsausbruch habe aber die Politik bedeutungslos gemacht, sodass es nur Kriegspolitik geben könne und die OHL somit das Recht und die Pflicht habe, aktiv die Politik zu gestalten.13
Hielt der preußische Sittenkodex Ludendorff von versteckter politischer Opposition ab, so kannte Bauer diese Maßstäbe offensichtlich nicht.14 Ihm war jedes Mittel recht, um den Reichkanzler aus dem Amt zu drängen. Bauer suchte daher ganz bewusst Kontakte zu den politischen Gegnern von Bethmann Hollweg. Im März 1917 verfasste Bauer eine Denkschrift Demokratie oder Monarchie, die wohl am deutlichsten überhaupt seinen politischen Standpunkt umreißt und die typische Ansichten konservativer wilhelminischer Eliten auf die Spitze treibt: die naive Banalisierung politischer Zusammenhänge, die unerbittliche Geringschätzung politischer Gleichberechtigung, die groteske Herabwürdigung demokratischer Kräfte, die panische Furcht vor linksliberalen Kräften. Der eigentliche Zweck der Denkschrift war aber die Absetzung des Reichskanzlers; Bauers Bestrebungen erreichten Anfang Juli 1917 ihren Höhepunkt. In Berlin prüfte er im Wissen von Ludendorff, ob die verschwörerische Allianz mittlerweile stark genug war, um beim Kaiser offen gegen den Reichskanzler zu intervenieren. Am 12. Juli 1917 fand eine von Bauer initiierte Besprechung des preußischen Kronprinzen mit Parteivertretern (unter anderem Stresemann, Erzberger, Westarp) statt, die von Bauer versteckt protokolliert wurde. Wilhelm II. weigerte sich zunächst, dieses Protokoll als authentisch anzuerkennen, sodass Ludendorff und Hindenburg erst offen mit ihrem Rücktritt drohen mussten, ehe der Kaiser schließlich Bethmann Hollweg abberief. Diese politische Intrige war zu einem Großteil ein Werk Bauers, der als treibende Kraft und Bindeglied zwischen politischen und militärischen Kreisen fungierte, um den aus seiner Sicht den totalen Krieg ausbremsenden Reichskanzler zu entfernen. Ähnlichen Einfluss hatte Bauer auch auf die Entlassungen des Chefs des Geheimen Zivilkabinetts Rudolf von Valentini, des Chefs des Kriegsamtes Wilhelm Groener und des Chefs des Generalstabs des Feldheeres Erich von Falkenhayn.
Nach dem Ersten Weltkrieg und seiner im Juni 1919 erfolgten Entlassung aus dem Militärdienst durchlebte Max Bauer eine überaus wechselvolle berufliche Entwicklung.15 Er wurde zunächst publizistisch aktiv und gehörte wie Gerhard Tappen, Walter Nicolai und Wilhelm Groener zur Autorengruppe der jüngeren Stabsoffiziere, die über ihren Rang hinaus als Experten des industrialisierten Großkrieges operativen und politischen Einfluss ausgeübt hatten. War das Schreiben für Bauer zunächst vor allem eine Strategie zur Finanzierung des Lebensunterhaltes und zur Bewältigung der unerwarteten Freizeit, erwuchs daraus bald ein aktiver Kampf gegen das politische System der Weimarer Republik. In seinen politischen Hauptschriften Konnten wir den Krieg vermeiden, gewinnen, abbrechen (Berlin 1918) und Der Irrwahn des Verständigungs-Friedens (Berlin 1919) schwang Bauer sich zu einem der wichtigsten Verfechter der Dolchstoßlegende auf. Die OHL habe an der Front zunehmend das „Stocken des Pulsschlags der Heimat“ gespürt, sodass der Ersatz entweder ganz ausgeblieben oder nur mit einer großen „moralischen Verseuchung“ durch „internationalistische“ Kräfte an der Front angekommen sei. Die „Vergiftung der Heimat“ sei die eigentliche Ursache der Niederlage. Die deutschen Siegchancen – so Bauer – seien anfangs „glatt“ und später immer noch „aussichtsvoll“ gewesen. Die Niederlage „um eine Nasenlänge“ war daher für Bauer „nur und ausschließlich durch das Versagen der Heimat“ zu erklären. Als im Hintergrund wirkende Kraft glaubte Bauer, die „Irrlehren des Marxismus“ identifiziert zu haben.16
Bauers politische Aktivitäten gipfelten im konterrevolutionären Kapp-Lüttwitz-Putsch ab dem 13. März 1920.17 Angefangen hatten die Bestrebungen dazu bereits im Frühjahr 1919, als sich um Ludendorff, Bauer und Waldemar Pabst nationale Kräfte sammelten, um aus der Isolierung zu einer einheitlichen Front zusammenzufinden. Während der entscheidenden Stunden des Putsches spielte Bauer eine politische Führungsrolle, in die er sich einerseits selbst hineindrängte, andererseits aber auch durch den hadernden Kapp hineingetrieben wurde. Trotz des ausgerufenen Generalstreiks versuchte Bauer, den Putsch bis zur allerletzten Konsequenz aufrechtzuerhalten, musste aber am 17. März das Palais des Reichskanzlers verlassen, womit der Putsch auch symbolisch sein Ende fand. Auch wenn Bauer dem Namen nach hinter Kapp, Lüttwitz oder Ludendorff zurückstand, muss er doch als eine Zentralfigur des gesamten Putsches identifiziert werden. Er wurde nun steckbrieflich gesucht und floh ins Ausland.
Die folgenden drei Jahre verbrachte Bauer im Exil zunächst in Bayern, dann in Ungarn und Wien.18 Hauptziel war – neben weiterer Schriftstellerei, unter anderem sein Hauptwerk Der große Krieg in Feld und Heimat (Tübingen 1921) – vor allem die Vereinigung der europäischen Rechten zu einer internationalen gegenrevolutionären Front gegen den Kommunismus. Dazu kooperierte Bauer eng mit verschiedenen Gruppen: sowohl mit Freikorps-Führern um Hermann Ehrhardt und Waldemar Pabst oder mit den ungarischen Rechten um Gyula Gömbös als auch mit monarchistischen russischen Kreisen im Gefolge von Max Erwin von Scheubner-Richter. Aus der Frage der Bewaffnung der aufzustellenden Freikorps erwuchsen dabei bald Bauers neuerliche Kontakte zum weltweiten Rüstungsmarkt, u.a. zu Emil Georg Bührle in der Schweiz oder zum Hamburger Chemiefabrikanten Hugo Stoltzenberg.
Die letzte Karrierestufe waren schließlich Bauers private militärische Beratertätigkeiten von Winter 1923 bis zu seinem Tod 1929, so in der Sowjetunion, in Spanien und Argentinien sowie vor allem in China. Auf diese genauer einzugehen, ist hier nicht möglich, verwiesen sei aber auf einige Konstanten. Zentral erscheinen zunächst die wohl irgendwann in Madrid erfolgte endgültige Abkehr von aller politischen Tätigkeit und die vollständige Fokussierung auf das militärische Fachgebiet. Nur so war Bauers offizielle Amnestie in Deutschland möglich, der er auch aufgrund finanzieller Sorgen zustimmen musste. Weiterhin zu nennen sind Bauers privilegierte Kontakte aus den Jahren im Exil. Die Mission in der Sowjetunion zu Leo Trotzki verdankte Bauer einer Vermittlung des ihm seit Anfang 1919 bekannten Karl Radek. Der Bauer aus München und Wien aus dem Umfeld von Scheubner-Richter bekannte Erzherzog Wilhelm von Habsburg vermittelte ihn an seinen Cousin, den spanischen König Alfons XIII. Abschließend sind Bauers nach wie vor bestehende Kontakte zur Rüstungsindustrie zu erwähnen. So versuchte Bauer in Spanien und in Russland, sowohl Stoltzenberg als auch den Flugzeugpionier Hugo Junkers an dortigen Rüstungsprojekten zu beteiligen. Die Kontakte zu Carl Duisberg waren hingegen abgerissen, als dieser sich schon bald nach Kriegsende deutlich von Max Bauers politischen Aktivitäten distanzierte.19
Während seiner letzten Mission in China erkrankte Bauer Anfang April 1929 in Nanking schwer. Nachdem ein österreichischer Arzt zunächst Typhus festgestellt hatte, wurde Bauer auf einem britischen Dampfer nach Shanghai gebracht. Schon während der Überfahrt stieg sein Fieber rapide an und er bekam einen ungeklärten Hautausschlag, sodass Ärzte des deutschen Krankenhauses zunächst die Aufnahme wegen Pockenverdachts verweigerten, Bauer aber dann doch aufnehmen mussten. Als am 26. April schließlich endgültig die hämorrhagischen Pocken diagnostiziert wurden, kam Bauer auf die Isolierstation des britischen Militärkrankenhauses. Dort verstarb er 60-jährig am 6. Mai 1929 in den frühen Morgenstunden. Sein Leichnam wurde nach Swinemünde überführt und dort bestattet.20
Auffallend an Bauers Persönlichkeit ist zunächst seine zutiefst destruktive Handlungs- und Denkweise. Der Nachrichtendienstchef Walter Nicolai sprach pointiert von einer typischen Art Bauers, „Bestehendes zu zerstören, ohne Besseres an seine Seite zu stellen“.21 Hier sind nicht nur seine Bestrebungen zur Ausschaltung von Bethmann Hollweg zu nennen, sondern auch seine pessimistische Deutung revolutionärer Ereignisse. Er schrieb 1921 – rückblickend auf die Novemberrevolution 1919, aber auch bezugnehmend auf seine Erlebnisse 1905 in Russland –, dass Revolutionen nie durch die „Kraft ihrer Idee“ oder durch die „Stärke ihrer Organisation“ zum Erfolg kämen, sondern allein durch die Schwäche der zu stürzenden Regierungen.22
Bauer war ein führender Vertreter eines totalen Krieges, der alle Kreise der Gesellschaft zu erfassen hatte und in dem die Militärs auch Politik, Wissenschaft und Industrie maßgeblich steuern sollten. Dieses Ideal gesamtgesellschaftlicher militärischer Führung liefert dann die Erklärung dafür, warum Bauer sich unablässig in nahezu alle diese Aspekte einzumischen versuchte. Der Großteil des preußisch sozialisierten Offizierskorps mag unpolitisch gewesen sein in dem Sinn, dass man zwar von der Gesinnung klar antidemokratisch, antisozialdemokratisch, kaisertreu und patriotisch war, sich aber sonst von jeder Einmischung ins Politische fernhielt. Es gab nur wenige Offiziere, die für sich in Anspruch nehmen konnten, Kenntnisse von den Mechanismen der Politik zu besitzen und erkannt zu haben, dass die Politik letztlich ganz anders funktioniert als ihr eigenes Metier. Von diesen wenigen Offizieren haben sich noch weniger angemaßt, aktiv gestaltend in die Politik einzugreifen. Oberst Bauer ist hier ein seltener und extremer Ausnahmefall, denn er nahm für sich in Anspruch, ohne politische Ausbildung, mit nur primitivem politischem Verständnis und frei von dem Skrupel seiner Standesgenossen stets dann Politik machen zu können, wenn er es für den Verlauf des Krieges als entscheidend ansah.
So drängte Max Bauer stärker als andere militärische Eliten darauf, das Problem, geschulte Arbeitskräfte für die wachsende Rüstungsproduktion zur Verfügung zu stellen, rücksichtslos zu lösen. Mit dem Hindenburgprogramm verließ die OHL im August 1916 unter maßgebendem Einfluss von Bauer den moderaten Weg des Kriegsministeriums und zog ab September 1916 auch in Betracht, belgische Arbeiter zwangsweise für die deutsche Industrie zu rekrutieren. Am 28. September verlangte Bauer im Namen der OHL die unmittelbare Bereitstellung von Arbeitskräften für den Heeresersatz. Die dafür notwendigen Zwangsmaßnahmen seien – so Bauer – durch die Haager Konventionen gedeckt, da Arbeitslose in Belgien die dortige öffentliche Ordnung bedrohen würden. Ludendorff setzte sich schließlich über die Bedenken des Auswärtigen Amtes und der deutschen Zivilverwaltung hinweg und setzte den Zwangseinsatz durch.
Oberst Max Bauer war im Ersten Weltkrieg der „Prototyp des sich gewaltsam in die politischen Angelegenheiten einmischenden Militärs“ bei gleichzeitig auffallenden weltanschaulichen Parallelen zu späteren Nationalsozialisten.23 Dazu zählt auch, dass Bauer als Hauptberater verheerenden und massiv radikalisierenden Einfluss auf Ludendorff hatte. So konnte Bauer stets mit der vollen Autorität der OHL auftreten, was entscheidend zu seinem Einfluss weit über den militärischen Rang hinaus beigetragen hat. Diese Positionierung Bauers ist einzuordnen in die allgemeine Entwicklung der Militärs im Weltkrieg. Aus einem reinen Kampfverband war immer mehr ein „gesamtgesellschaftlich agierender Organisator von Gewalt“ (Michael Geyer) geworden. Man mag Bauer aber zugutehalten, dass sein übersteigerter Ehrgeiz und seine Tendenz, sich wirklich überall einzumischen, nicht in egoistischen Motiven wurzelten, sondern viel eher in seinem pervertierten Militarismus-Verständnis. Dazu passt auch sein geringschätziger Umgang mit dem eigenen Körper. Von Bauer ist bekannt, dass er unter chronischen Schmerzen sowie Schlafstörungen litt und sich selbst exzessiv mit Sanatogen – einem Kräftigungsmittel für Nerven und Körper – medikamentierte.24
Bauers Wirken nach 1918 gliedert sich in zwei Phasen. Zunächst gilt es, sein federführendes politisches Wirken in rechtsextremen Kreisen zu betrachten. Seine Unzufriedenheit und seine Verbitterung nach Kriegsende mögen als typisch für viele Offiziere seines Standes gelten. Sein realitätsfremdes politisches Wirken bis zum Kapp-Putsch und seine abenteuerlichen Planungsversuche im Exil unterstreichen seine politische Naivität, die ihn von dem Großteil seiner Standesgenossen negativ abhebt. Seine theoretisch orientierte militärische Beratertätigkeit zeigt aber auch, dass Max Bauer schon im Ersten Weltkrieg ein anerkannter militärischer Fachmann, ein hervorragender Organisator und ein begnadeter Netzwerker war. Nach Kriegsende zog er durchaus die richtigen Schlüsse, rückte von dem Konzept der schweren Artillerie ab und trat für die Verwendung kleiner und möglichst eigenständig agierenden Trupps ein. Er erkannte auch früh den Wert einer Luftwaffe oder der vollständigen Motorisierung. Bei der Gesamtbewertung muss aber deutlich das politische Element überwiegen.