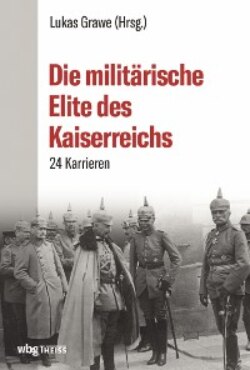Читать книгу Die militärische Elite des Kaiserreichs - Группа авторов - Страница 17
Generaloberst Hans Hartwig von Beseler
Оглавлениеvon Christian Th. Müller
Innerhalb der Generalität des Deutschen Kaiserreiches nahm Hans Hartwig von Beseler gleich in mehrfacher Hinsicht eine Sonderstellung ein. Anders als die meisten Spitzenmilitärs stammte er aus einer explizit bildungsbürgerlichen Familie mit liberal-konservativer Prägung und hatte seine militärische Laufbahn in der zwar als gelehrt, aber auch als wenig vornehm geltenden Pioniertruppe begonnen. Neben Richard von Schubert war Beseler der einzige Pionier, der bis zum Ende des Kaiserreiches den Dienstgrad Generaloberst erreichen sollte. Umfassend gebildet und vielseitig interessiert verkörperte er – wie außer ihm wohl nur noch Colmar von der Goltz und Hermann von Kuhl – den Typus des gelehrten Offiziers.
Inwieweit es diese Spezifika waren, welche seinen Aufstieg in die höchsten militärischen Positionen verhinderten, muss Spekulation bleiben. Trotz anerkannt herausragender geistiger Fähigkeiten und militärischer Leistungen wurde seine Karriere jedoch gleich mehrfach durch persönliche Zurücksetzungen ausgebremst, bevor er ab 1915 als Generalgouverneur in Kongress-Polen vor eine primär politische Aufgabe gestellt wurde, an der er erst scheiterte und schließlich zerbrach.
Hans Hartwig von Beseler wurde am 27. April 1850 in Greifswald geboren. Seine Mutter Emilie war die Tochter eines Geheimen Oberbergbaurates und kam aus Berlin. Sein aus dem Herzogtum Schleswig stammender Vater war der angesehene Juraprofessor und liberale Abgeordnete Georg Beseler. Nach dessen Berufung an die Friedrich-Wilhelms-Universität 1859 verbrachte Beseler seine Jugendjahre in Berlin. Hier erhielt er am Königlichen Wilhelms-Gymnasium eine humanistische Bildung, wobei er schon bald ein ausgeprägtes Interesse für Mathematik und moderne deutsche Literatur entwickelte. Mindestens genauso prägend war aber auch die intellektuelle Atmosphäre seines Elternhauses, wo unter anderem führende deutsche Historiker der damaligen Zeit wie Duncker, Mommsen, Ranke, Sybel und Treitschke verkehrten.1
Im Hochgefühl der preußischen Siege von 1864 und 1866 mochte sich Beseler jedoch nicht für die vom Vater favorisierte Gelehrtenlaufbahn erwärmen. Ihn zog es zum Militär. Immerhin konnte der Vater ihm den ursprünglich angestrebten Eintritt in die noch völlig unbedeutende Marine des Norddeutschen Bundes ausreden. So trat Beseler nach dem Abitur am 1. April 1868 in das Gardepionierbataillon ein, wo er nach „vorzüglich“ bestandener Offiziersprüfung ab Oktober 1868 als Sekondeleutnant diente.2
Während des Krieges 1870/71 nahm er an den Kämpfen um Metz und an der Belagerung von Paris teil, wofür er mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet wurde. Danach besuchte er zunächst die Artillerieund Ingenieurschule und erhielt im Herbst 1874 sein Ingenieurzeugnis. Schon bald vermochte der ihm allzu „handwerksmäßig“3 daherkommende Pionierdienst Beseler jedoch nicht mehr zu befriedigen. Der angestrebte Wechsel zur Infanterie gestaltete sich allerdings schwierig. Stattdessen wurde er 1876 zum Studium an der Kriegsakademie zugelassen. Mit deren erfolgreichem Abschluss drei Jahre später standen ihm dann aber auch noch ganz andere Karrierewege offen.
Bereits im Frühjahr 1880 wurde er in den Großen Generalstab kommandiert, wo er durch Alfred von Waldersee gefördert wurde. Nun folgten „drei reich erfüllte Jahrzehnte“4 in wechselnden Truppen-, vor allem aber Stabsdienstverwendungen. Zeitgleich mit der Beförderung zum Hauptmann wurde Beseler 1882 in den Großen Generalstab versetzt. 1884 bis 1887 diente er im Truppengeneralstab der 30. Division in Metz. In dieser Zeit heiratete er 1885 die gerade 18-jährige Clara Cornelius, mit der er drei Töchter bekam. Nach sieben Jahren im Generalstab gelang schließlich auch der Wechsel zur Infanterie und Beseler wurde Kompaniechef im Infanterieregiment 74 in Hannover. Doch seine Verwendung als Kompaniechef blieb ebenso wie die als Kommandeur des Infanterieregiments 65 in Köln (1898/99) und der 6. Division in Brandenburg (1903/04) nur eine kurze Episode.
Bereits ab 1888 lehrte er für vier Jahre Kriegsgeschichte an der Kriegsakademie, bevor er 1892/93 unter Waldersee im Generalkommando des IX. Armeekorps in Altona diente. Danach war er beinahe fünf Jahre lang Chef der Armeeabteilung im preußischen Kriegsministerium, wo er maßgeblich die Heeresvorlage von 1898 und die damit verbundene Verstärkung der technischen Truppen vorbereitete.
1899 kehrte er schließlich in den Großen Generalstab zurück und wurde Anfang 1900 zum Generalmajor ernannt. Als Oberquartiermeister III, dem die für Operationsstudien bzw. Kriegsakademie/Generalstabsdienst zuständige 5. und 8. Abteilung unterstanden, sowie als Mitglied der Studienkommission der Kriegsakademie nahm Beseler nun tief greifenden Einfluss auf die Heranbildung der künftigen Generalstabsoffiziere.5
In dieser Zeit arbeitete er eng mit Generalstabschef Alfred von Schlieffen zusammen. Als sich Ende 1903 Schlieffens baldige Pensionierung abzeichnete, galt der inzwischen zum Generalleutnant avancierte Beseler als aussichtsreicher Kandidat für dessen Nachfolge. Der Chef des Militärkabinetts Dietrich von Hülsen-Haeseler machte auch einen entsprechenden, von Kriegsminister Karl von Einem entschieden unterstützten Vorschlag. Daraufhin wurde Beseler am 27. Januar 1904 von Wilhelm II. in den erblichen Adelsstand erhoben. Der Kaiser selbst präferierte jedoch – wie Helmuth Rogge hervorhob – den „Träger eines großen Namens“ gegenüber dem „Könner“. So trat statt Beseler Generalleutnant Helmuth von Moltke (d. J.) die Schlieffen-Nachfolge an.6
Mehr als diese Entscheidung seines Dienstherren enttäuschte Beseler aber der Umstand, dass ihm die erhoffte Übernahme eines Armeekorps verwehrt blieb. Stattdessen wurde er im Herbst 1904 zum Chef des Ingenieur- und Pionierkorps und Generalinspekteur der Festungen bestimmt. In dieser Funktion kümmerte er sich um den Ausbau der Festung Metz und drängte auf die aus seiner Sicht bislang völlig vernachlässigte Befestigung der deutschen Nordseeküste. Im Kriegsministerium stieß Letzteres jedoch auf nur wenig Gegenliebe. Auf Betreiben von Kriegsminister Josias von Heeringen erhielt der 1907 zum General der Infanterie beförderte Beseler daher im Dezember 1910 die Aufforderung, seinen Abschied einzureichen, und wurde Anfang 1911 zur Disposition gestellt.7
General Hans v. Beseler (Fotopostkarte um 1915)
Nach dem für Beseler überraschenden Ende seiner Militärkarriere erschloss er sich in Politik und Militärpublizistik zwei neue Tätigkeitsfelder. Bereits während seines Militärdienstes hatte Beseler die Zeitläufe aufmerksam, aber wohl auch etwas ratlos verfolgt. So betrachtete er den Aufstieg der „scheußlichen Sozialisten“8 und den „technisch-materialistischen Zeitgeist“ mit Sorge, während er zugleich die öffentliche Repräsentation des Kaiserreiches als aus der Zeit gefallene „Rumpelkammer mittelalterlichen Gepränges“9 kritisierte. Oder, um es mit Werner Conze zu formulieren: „Er beobachtete das Versagen der Konservativen und der Liberalen, die ihm verhaßte Schlüsselstellung des ‚Ultramontanismus‘ durch das Zentrum und die als volkszerstörend angesehene Sozialdemokratie. So blieb ihm allein die Armee als der schützende Hort.“10
Obschon durch sein Elternhaus eher liberal geprägt, schloss er sich daher der staatstragend auftretenden Freikonservativen Partei an und bereitete sich darauf vor, für diese ein Land- oder Reichstagsmandat zu übernehmen. Doch bevor dies zustande kam, wurde Beseler Anfang 1912 durch Wilhelm II. auf Lebenszeit in das Preußische Herrenhaus berufen. Hier trat er jedoch kaum hervor, sondern widmete sich in der Hauptsache der Mitarbeit in verschiedenen Kommissionen des Hauses.11
Anders verhielt es sich mit seiner militärpublizistischen Tätigkeit, welche ganz durch die Vorstellung einer bevorstehenden „Weltkrisis“ geprägt war. Beseler sorgte sich um Ausbildung und Geist des Heeres.12 In seiner Jubiläumsschrift zum 100. Jahrestag der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Preußen plädierte er 1913 angesichts des heraufziehenden großen Krieges vehement für deren vollständige Ausschöpfung.13
Mit Beginn des Ersten Weltkrieges wurde Beseler reaktiviert und zum Kommandierenden General des – brandenburgischen – III. Reservekorps ernannt. Als Teil der 1. Armee unter Generaloberst Alexander von Kluck marschierte sein Korps am äußersten rechten Heeresflügel in das neutrale Belgien ein. Nachdem sich das Gros des belgischen Feldheeres am 20. August 1914 in den Schutz der zum „Nationaal Reduit“ ausgebauten Festung Antwerpen zurückgezogen hatte, erhielt Beseler den Auftrag, Flanke und Rücken des deutschen Umfassungsflügels gegen die zahlenmäßig deutlich überlegene belgische Gruppierung im Raum Antwerpen zu sichern. Bereits am 25./26. August 1914 sah sich das III. Reservekorps mit einem belgischen Ausfall konfrontiert, der in heftigen Kämpfen zurückgeschlagen werden musste. Nach Verstärkung durch die Marinedivision gelang es Beseler vom 9. bis 13. September, auch den zweiten großen Ausfall abzuwehren.14
Zu diesem Zeitpunkt hatte die Oberste Heeresleitung (OHL) Beseler bereits den Auftrag zur Einnahme Antwerpens erteilt. Ein vor 1914 im Großen Generalstab erarbeiteter Angriffsplan hatte dafür einen Kräfteansatz von fünf Reservekorps vorgesehen. Beseler verfügte jedoch nur über drei Divisionen. Auch wenn diese später noch um die 4. Ersatzdivision, zwei gemischte Landwehrbrigaden sowie diverse Artillerieeinheiten verstärkt wurden, stand die derart konstituierte Armeegruppe Beseler vor einer kaum durchführbaren Aufgabe.15 Aufgrund des Mangels an Kräften und Munition sollte der Angriff nur an einem relativ schmalen Abschnitt im Südosten der Festung geführt werden. Dabei befanden sich Beselers Truppen selbst in höchst exponierter Lage und liefen Gefahr, ihrerseits von überlegenen belgischen und alliierten Kräften angegriffen zu werden.16
Tatsächlich kam der am 27. September beginnende deutsche Angriff nur knapp einem geplanten belgischen zuvor. Während die Infanterie das Vorgelände der Festung einnahm, wurden 173 schwere Geschütze, davon 13 schwerste Mörser der Kaliber 30,5 cm und 42 cm, auf Schussweite an den äußeren Fortgürtel herangebracht. Am 28. September eröffnete die Belagerungsartillerie das Feuer auf die Forts. Drei Tage später trat die Infanterie zum Sturm an und eroberte in wechselvollen Kämpfen bis zum 3. Oktober die südöstlichen Forts. Zu diesem Zeitpunkt verdichteten sich die Hinweise auf einen bevorstehenden Entsatz der Festung durch französische und britische Truppen. Beseler drängte daher zum beschleunigten Angriff auch auf den inneren Fortgürtel. Vom 3. bis 6. Oktober wurde unter großen Schwierigkeiten – behindert durch überflutetes Gelände und fortwährende Gegenangriffe – das Flüsschen Nete forciert und die Artillerie vorgezogen. Ab 7. Oktober wurden dann auch die inneren Forts unter Beschuss genommen. Als am Morgen des 9. Oktober die Forts 4 und 5 vom Gegner geräumt vorgefunden wurden, begann der letzte Akt der Kämpfe um Antwerpen.17
Während Vertreter der Stadtverwaltung mit Beseler über die Übergabebedingungen verhandelten und schließlich die Kapitulation unterzeichneten, schlossen deutsche Verbände Antwerpen nun auch von Westen ein. Doch sie kamen zu spät, um dem sich per Bahn und Straße nach Westen absetzenden belgischen Feldheer noch den Weg verlegen zu können.18 Gleichwohl hatte die Armeegruppe Beseler einen beachtlichen Erfolg errungen. Trotz äußerst ungünstiger Rahmenbedingungen war es ihr gelungen, eine der stärksten europäischen Festungen in lediglich 13 Tagen, im verkürzten Angriffsverfahren zu erobern. Beselers Expertise als Pionier und vormaliger Generalinspekteur der Festungen, „sein klarer Blick, sein treffendes Urteil, sein zielbewußtes, sicheres Handeln sowie seine außerordentlich geschickte Einwirkung“ auf die ihm unterstellten Truppen hatten daran – neben der überschweren Belagerungsartillerie und der mangelnden Initiative des zahlenmäßig überlegenen Gegners – entscheidenden Anteil. In Anerkennung dieser Leistung wurde Beseler mit dem Pour le Mérite ausgezeichnet.19
Nach dem Fall von Antwerpen verfolgte Beseler den zurückgehenden Gegner bis an die Yser und nahm dann im Rahmen der neu aufgestellten 4. Armee an der Ersten Flandernschlacht teil. Nachdem die deutsche Offensive hier gescheitert war, wurde Beselers III. Reservekorps bis Ende November 1914 zur Verstärkung der 9. Armee an die Ostfront verlegt. Hier konnte er im Sommer 1915 noch einmal seine besondere Befähigung zur Führung des Festungskrieges unter Beweis stellen. Ende Juli 1915 wurde Beseler vom Oberbefehlshaber Ost (Ober Ost) beauftragt, den Angriff auf Nowogeorgiewsk – die größte und stärkste der russischen Festungen – zu leiten. Wie schon vor Antwerpen waren auch hier die bereitgestellten Kräfte und Mittel denkbar knapp bemessen. Die neu gebildete Armeegruppe Beseler verfügte „über Truppen in Stärke von etwa vier Divisionen, die mit Ausnahme eines Teils der Belagerungsbatterien nur aus Landwehr und Landsturm bestanden und im ganzen rund 300 Geschütze einsetzen konnte, davon reichlich 100 schweres und 14 schwerstes Steilfeuer.“20
Angesichts des Umstandes, dass die verfügbare Angriffsinfanterie fast durchweg aus älteren Jahrgängen bestand, setzte Beseler primär auf eine überwältigende Artilleriewirkung. Begleitet von kleineren Ablenkungsangriffen wurden unter radikaler Zusammenfassung des Artilleriefeuers in einem schmalen Angriffsabschnitt an der Nordostfront zunächst Breschen in die gegnerischen Befestigungen geschossen. Dann wurden diese durch die dichtauf folgende Infanterie in teils noch heftigen Kämpfen eingenommen. Auf diese Weise arbeiteten sich die Angreifer fast zwei Wochen lang von den äußeren Forts bis zur Zitadelle der Festung hindurch. Mit dem Fall der Zitadelle war das Schicksal der Festung am 19. August 1915 besiegelt. 90.000 russische Soldaten kapitulierten und gingen in Gefangenschaft.21
Für Beseler markierte die Kapitulation von Nowogeorgiewsk das Ende seiner kurzen Feldherrnkarriere. Dekoriert mit dem Eichenlaub zum Pour le Mérite wurde er am 24. August 1915 zum Generalgouverneur des Generalgouvernements Warschau ernannt. Ohne größere Verwaltungserfahrung und ohne sich zuvor mit der polnischen Frage beschäftigt zu haben, wurde Beseler damit praktisch über Nacht zum Exponenten der deutschen Polenpolitik. In Briefen an seine Frau kommen sein Respekt vor der ihm übertragenen „riesenhaften Aufgabe“ und die Sorge, „ob etwas Staatsmann und Politiker in mir steckt“, klar zum Ausdruck.22
Mit Beginn des Ersten Weltkrieges stand das Projekt eines eigenständigen polnischen Staates und die Frage nach dessen territorialem Zuschnitt plötzlich wieder auf der Agenda der europäischen Großmächte. Sowohl Russland als auch die Mittelmächte weckten bei der polnischen Bevölkerung Hoffnungen auf politische Autonomie oder gar einen eigenen Staat, um sie für ihre Kriegszwecke zu instrumentalisieren. Während des ersten Kriegsjahres hatte dies aber fast ausschließlich propagandistischen Charakter. Mit dem großen Rückzug des russischen Heeres und der Besetzung Kongress-Polens durch die Mittelmächte, ergab sich im Sommer 1915 jedoch die Frage, was mit dem besetzten und nun in die Generalgouvernements Warschau und Lublin geteilten Gebiet geschehen sollte.
Aus deutscher Sicht waren dabei möglichst zwei Ziele zu erreichen: die Sicherung des Reiches gegenüber Russland und die Einbindung der polnischen Gebiete in das Mitteleuropaprojekt der Reichsleitung. Für die Lösung der polnischen Frage ergaben sich somit drei grundsätzliche Optionen: 1. die Aufteilung Kongress-Polens zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn, 2. die Bildung eines deutsch kontrollierten Pufferstaates gegen Russland sowie 3. die sogenannte austro-polnische Lösung. Danach wäre der größte Teil Kongress-Polens der nun trialistisch zu reformierenden Habsburgermonarchie zugeschlagen worden. Zugleich hätte Deutschland den sogenannten „polnischen Grenzstreifen“ annektiert, um die Verteidigungsfähigkeit seiner Ostgrenze zu verbessern.23
Von Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg mit einer „gerechten und loyalen Verwaltung“ beauftragt, aber ohne klare politische Vorgaben machte sich Beseler mit seiner neuen Aufgabe vertraut. Beraten durch Bogdan von Hutten-Czapski, einen preußischen Politiker polnischer Herkunft, beschäftigte sich Beseler mit der „vertrackten“ polnischen Frage, reiste durchs Land und knüpfte Kontakte zu den verschiedenen politischen Strömungen.24 Bereits Ende 1915 legte Beseler mit seiner Denkschrift „Grundsätze für eine neue Landesverteidigung“ ein erstes Konzept für die Zukunft Kongress-Polens vor. Darin sprach er sich für die Annexion eines polnischen Grenzstreifens entlang der Warthe-Narew-Linie und gleichzeitig für die Bildung eines polnischen Pufferstaates als Bollwerk gegen Russland aus. Damit wurde Beseler zum Akteur in den äußerst schwierigen und langwierigen Auseinandersetzungen um die Lösung der polnischen Frage.25
Hier hatte er es mit einer hochkomplexen Akteurs- und Interessenkonstellation zu tun. Weder auf deutscher noch auf österreichisch-ungarischer Seite und erst recht nicht zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn herrschte Einigkeit über den einzuschlagenden Weg. Die polnische Seite stellte sich politisch noch stärker fragmentiert dar. Kennzeichnend war dabei, dass die große Gruppe der Nationaldemokraten mit der Entente sympathisierte, während Pilsudskis Sozialisten und die „Passivisten“ nur eingeschränkt zur Zusammenarbeit mit den Mittelmächten bereit waren. Lediglich die kleine Gruppe der konservativ und monarchistisch eingestellten „Ultraaktivisten“ unterstützte die Politik der Besatzungsmächte.
Eine stringente Politik war unter diesen Umständen kaum möglich. Insbesondere der Reichskanzler lavierte zwischen den antipolnisch eingestellten preußischen Eliten, der sich zunehmend verselbstständigenden Baltikumspolitik des Ober Ost, den Forderungen der OHL nach kriegswirtschaftlicher Ausbeutung der besetzten Gebiete sowie dem österreichungarischen Verbündeten. Damit verbunden waren handfeste Zielkonflikte in Beselers Besatzungspolitik. In dem Bestreben, in der polnischen Bevölkerung Sympathien für Deutschland zu wecken, unterstützte Beseler den Aufbau der polnischen Verwaltung, eröffnete die Warschauer Hochschulen wieder, förderte polnische Kultureinrichtungen und gewährte auch für patriotische Kundgebungen weitgehende Freiräume. Gleichzeitig ächzte das Land aber unter der Ausbeutung durch die Besatzungsmacht. Während Agrarprodukte und Bodenschätze rigoros der deutschen Kriegswirtschaft zugeführt wurden, hungerte die polnische Bevölkerung. Als dann auch noch Kirchenglocken beschlagnahmt und Arbeitskräfte zwangsrekrutiert wurden, kam es zu heftigen, auch gewaltsamen Protesten.26
Immerhin machte sich Bethmann, der zunächst der austro-polnischen Lösung zugeneigt hatte, im Sommer 1916 zögerlich die Idee des polnischen Pufferstaates zu eigen. Angesichts der deutlich verschlechterten Kriegslage erhofften sich Reichsleitung und OHL in Polen einen neuen Verbündeten, der die Kriegsanstrengungen der Mittelmächte möglichst bald mit einer „polnischen Wehrmacht“ unterstützen sollte. Nach einigem Hin und Her proklamierten Beseler und sein österreichisch-ungarischer Kollege Karl Kuk am 5. November 1916 in Warschau bzw. Lublin das Königreich Polen. Allerdings hatte dieses einstweilen weder einen König noch eine Regierung und vor allem kein klar definiertes Territorium. Beseler plädierte zwar vehement für die Gründung eines polnischen Staates. Doch gleichzeitig forderte er die Annexion eines verkleinerten Grenzstreifens entlang der Bobr-Narew-Linie. Zum Ausgleich sollte der neue polnische Staat Gebietsentschädigungen im Osten erhalten.27
Reagierte die polnische Bevölkerung auf die Proklamation daher bereits nur mäßig begeistert, so sorgte Beselers nächster Schritt, die Veröffentlichung eines Werbeaufrufs für die neue polnische Armee am 9. November 1916, für massive öffentliche Proteste – ohne polnische Regierung könne es auch keine polnische Armee geben. Die Einsetzung des 25-köpfigen Staatsrates im Januar, die Benennung des den noch fehlenden Monarchen vertretenden Regentschaftsrates im September sowie schließlich die Einsetzung eines polnischen Ministerpräsidenten im November 1917 kamen zu spät, um die wachsende Ablehnung gegenüber den Besatzungsmächten noch verhindern zu können.
Bereits in seinem Bericht vom 20. Dezember 1916 war Beselers vorübergehender Optimismus einer trüben Lagebeurteilung gewichen. Angesichts deren zunehmend renitenter Haltung fürchtete Beseler, dass er bald gegen Jozef Pilsudski und seine Anhänger vorgehen müsse, was dann aber zum offenen Aufstand gegen die Besatzungsmacht führen könnte. Bei der OHL schlug Beselers Bericht wie eine Bombe ein. Paul von Hindenburg sah darin eine politische „Bankrotterklärung“ und forderte – allerdings erfolglos – Beselers umgehende Ablösung.28
Von nun an wurde seine Tätigkeit als Generalgouverneur immer mehr zu einer „Leidensgeschichte“.29 Der Aufbau der „polnischen Wehrmacht“ kam nur schleppend voran, bevor im Juli 1917 die „Eidkrise“ die vorangegangenen Bemühungen weitgehend zunichtemachte. Die von Beseler maßgeblich mitgetragene deutsche Polenpolitik hatte sich spätestens jetzt als illusionär erwiesen. So sah Beseler seine Aufgabe nun vor allem darin, „den Wirrwarr in einer für uns möglichst vorteilhaften Weise aufzulösen.“30
Die Chancen dafür verschlechterten sich jedoch rapide. Mit den 14 Punkten von US-Präsident Woodrow Wilson hatte die von den Mittelmächten propagierte Lösung der polnischen Frage aus polnischer Sicht massiv an Wert verloren. Damit schrumpften die Handlungsspielräume für Beseler, der im Januar 1918 zum Generaloberst befördert worden war, noch mehr.
Angesichts der sich abzeichnenden Niederlage der Mittelmächte wurde Beselers Position schließlich im Oktober 1918 unhaltbar. Ohne klare Richtlinien aus Berlin und ohne militärische Unterstützung durch die OHL stand er auf verlorenem Posten. Hilflos musste er der Machtübernahme durch polnische Politiker und Paramilitärs sowie der Selbstauflösung seiner Truppen im Zuge der Novemberrevolution zusehen. Nachdem das Generalgouvernement faktisch nicht mehr existierte und er am 9. November den Kaiser telegrafisch um seine Ablösung gebeten hatte, verließ er Warschau im Morgengrauen des 12. November 1918 inkognito auf einem von Pilsudski bereitgestellten Weichseldampfer.
Als kranker Mann kehrte Beseler nach Berlin zurück. Hier sah er sich alsbald den Vorwürfen nationalistischer Kreise ausgesetzt, die seine Politik als zu polenfreundlich und seine Abreise aus Warschau als schändliche Flucht verurteilten. Obschon er in einem von ihm selbst beantragten Kriegsgerichtsverfahren 1919 rehabilitiert wurde, war sein Ruhm als Sieger von Antwerpen und Nowogeorgiewsk dahin. Am 20. Dezember 1921 starb er als gebrochener Mann in einem Neubabelsberger Sanatorium.