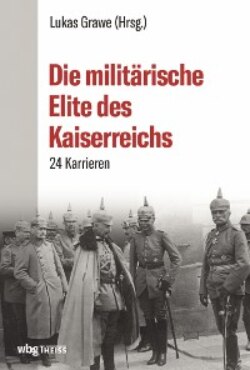Читать книгу Die militärische Elite des Kaiserreichs - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung – Die militärische Elite des Kaiserreichs
Оглавлениеvon Lukas Grawe
In der deutschen Öffentlichkeit stand der Erste Weltkrieg lange Zeit im Schatten des Zweiten Weltkriegs. Angesichts der deutschen Verantwortung für 55 Millionen Tote und den Mord an den europäischen Juden ist dies mehr als verständlich. Eine verstärkte Aufmerksamkeit erfuhr der „Große Krieg“, wie der Erste Weltkrieg in Frankreich und Großbritannien genannt wird, dann allerdings im Jahr 2014, als sich der Kriegsausbruch zum 100. Mal jährte. Zahlreiche Historiker, Journalisten und Autoren nahmen das Jubiläum zum Anlass, sich ausführlich mit der viel zitierten „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ (George F. Kennan) zu befassen. Eine kaum zu überschauende Menge an neuen Monografien, Sammelbänden und Zeitschriftenbeiträgen flutete den Markt und sorgte dafür, dass wir über den Ersten Weltkrieg nun weitaus mehr wissen als noch vor wenigen Jahren.
Doch auch im vermeintlich komplett durchleuchteten Feld des Ersten Weltkriegs lassen sich Lücken ausmachen. Dies gilt sogar für den Bereich der biografisch orientierten Militärgeschichtsschreibung, einem traditionell viel bearbeiteten Forschungszweig. Während etwa die militärische Elite Hitlers in mehreren Sammelbänden sowie in zahlreichen Einzelbiografien umfassend abgehandelt worden ist,1 liegen vergleichbare Studien für das Deutsche Kaiserreich nur in geringer Zahl vor. So existierten zu besonders prominenten Militärs wie Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff oder Erich von Falkenhayn bereits vorzügliche Darstellungen.2 Doch über andere hochrangige und einflussreiche Oberbefehlshaber und Generalstabsoffiziere wie Karl von Einem, Friedrich Graf von der Schulenburg oder Albrecht Herzog von Württemberg lassen sich kaum fundierte Arbeiten finden. Diese Leerstelle betrifft auch die kaiserliche Marine. Wissenschaftliche Literatur über Reinhard Scheer oder Franz von Hipper sucht man vergeblich.
Dieser Befund verwundert umso mehr, wenn man bedenkt, dass des Kaisers militärische Elite nicht nur eine wesentliche Mitverantwortung für den Ersten Weltkrieg trug. Dass dieser nicht durch Friedensinitiativen vorzeitig beendet wurde, sondern in einen jahrelangen Abnutzungskrieg mit dem Einsatz neuer industrieller Tötungstechniken eskalierte, lag eben auch an einer lange Zeit friedensunwilligen deutschen Militärführung. Diese verschloss noch im Angesicht des drohenden militärischen Zusammenbruchs des Reichs ihre Augen vor der unabwendbaren Niederlage und trieb schließlich mit der „Dolchstoßlegende“ einen verhängnisvollen Spaltpilz in die Gesellschaft der Weimarer Republik, der wesentlich zum Untergang der ersten gesamtdeutschen Demokratie beitrug.
Sicherlich hängt das Fehlen einschlägiger Studien zur Elite des Kaisers auch mit der problematischen Quellenlage zusammen. Da zahlreiche Nachlässe der hochrangigen Militärs des Kaiserreichs während des Zweiten Weltkrieges durch den alliierten Luftangriff auf das Potsdamer Heeresarchiv Opfer der Flammen wurden, ist eine lückenlose Lebenslaufrekonstruktion bei vielen Offizieren nicht mehr möglich. Die nach wie vor vorhandenen Quellen sowie der reiche Fundus an zeitgenössischen Veröffentlichungen ermöglichen es aber, diese Lücken zu schmälern und auch auf diese Weise wichtige Anstöße für tiefer gehende Forschungen zu liefern.
Wer aber war des Kaisers militärische Elite? Aus welchem Umfeld setzte sie sich zusammen? Diesen Fragen hat die Geschichtsschreibung bereits mehrfach Aufmerksamkeit geschenkt. Das Offizierkorps nahm innerhalb des Deutschen Kaiserreichs bereits seit den erfolgreichen „Einigungskriegen“ von 1864, 1866 und 1870/71 eine herausragende Stellung ein und bildete einen zentralen Stützpfeiler der preußisch-deutschen Monarchie.3 Das Offizierkorps wies dabei eine äußerst hohe Homogenität auf. Die meisten Offiziere stimmten mit einer konservativen, königstreuen und zuweilen auch reaktionären Grundhaltung überein, die ihnen erst den Weg zur Offizierslaufbahn eröffnete. War die Offizierskaste jahrhundertelang ein Privileg des Adels gewesen, so sorgten die wiederholten Heeresverstärkungen im Deutschen Kaiserreich dafür, dass die Armee auch auf den „Adel der Gesinnung“ (Wilhelm II.) und damit auf Söhne aus großbürgerlichen Kreisen zurückgreifen musste. Auch wenn der Anteil des Adels vor dem Krieg kontinuierlich abnahm, vermochte er es doch, seine Vormachtstellung in den höchsten Diensträngen und in den prestigeträchtigen Garderegimentern zu behaupten. Klassenunterschiede bestanden demnach auch nach der Jahrhundertwende innerhalb des Offizierkorps fort. Doch auch hier setzte sich der bürgerliche Professionalismus, der das Kriegshandwerk als Wissenschaft ansah, immer mehr durch – der Stellenwert der Bildung nahm nach der Jahrhundertwende zu. Erhalten blieb das feudale Erscheinungsbild des Offizierkorps, das Traditionen und althergebrachten Überlieferungen einen großen Stellenwert einräumte.
Ungeachtet der landsmannschaftlichen Unterschiede zwischen Sachsen, Bayern, Württembergern und Preußen, wies das wilhelminische Offizierkorps ein ausgewiesenes Kastendenken auf. Offiziere sahen sich als gesellschaftliche und staatstragende Elite, die eine herausgehobene gesellschaftliche und soziale Stellung einnahm. Die vor allem nach der Jahrhundertwende von der deutschen Reichsleitung verfolgte Machtpolitik trugen die meisten Offiziere bedenkenlos mit – vielfach sehnten hochrangige Militärs sogar einen Krieg herbei, um ihre Fähigkeiten endlich unter Beweis stellen zu können.4 Zahlreiche Offiziere folgten darüber hinaus sozialdarwinistischen und nationalistischen Ideen. Ein Krieg wurde auf diese Weise als Lackmustest für die deutsche „Volkskraft“ aufgefasst.
Als Elite des deutschen Offizierkorps galten die Generalstabsoffiziere, erkennbar an ihren karmesinroten Streifen an den Uniformhosen. Anders als im restlichen Offizierkorps spielten persönliche Beziehungen bei der Auswahl der Generalstabsoffiziere eine geringere Rolle, das Leistungsprinzip war hier wichtiger. Dies führte unter anderem zu einem höheren Anteil an Bürgerlichen innerhalb des Korps. In wechselnden Dienststellungen zwischen „Front“, dem Großen Generalstab in Berlin und den einzelnen Truppengeneralstäben der Armeekorps oder Divisionen wurden die Generalstabsoffiziere zu Führergehilfen erzogen, um ihren jeweiligen Kommandieren General im Falle eines Krieges operativ beraten zu können. Dank einer einheitlichen Doktrin sollten die angehenden Führergehilfen austauschbar sein. Die strenge Auslese hatte schließlich zur Folge, dass von den 22.000 deutschen Offizieren vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs lediglich ein Prozent dem Generalstab angehörte.5
In ihrem operativen Denken war die Generalität zu großen Teilen einem Dogma der Beweglichkeit verhaftet, das durch schnelle und offensive Stöße die Vernichtung des Gegners vorschrieb. Die Frage, ob diese mittels eines Frontaldurchbruchs oder einer Umfassung der Flanken angestrebt werden sollte, wurde nach dem Amtsantritt Alfred von Schlieffens als Chef des Generalstabs im Jahr 1891 weitgehend zugunsten der letzteren Variante entschieden. Zwar fanden sich auch unmittelbar vor 1914 noch einige Befürworter einer flexibleren Vorgehensweise, die ein starres Festlegen auf die Umfassung verneinte, doch blieben diese Stimmen in der Minderheit. Einig war sich die höhere deutsche Militärführung jedoch in der Frage, dass ein Krieg durch ein offensives Vorgehen und eine totale Vernichtung der gegnerischen Streitkräfte entschieden werden musste. Ein defensives Verharren an den eigenen Grenzen schloss man von vornherein aus und begründete dies unter anderem mit der geografischen Zwangslage, in der sich das Deutsche Reich zwischen den Großmächten Frankreich und Russland befand.
Nur wenige hochrangige Offiziere rechneten aber mit jenen Ereignissen, die spätestens im November 1914 zu einem Erstarren der Fronten im Westen führten. Dass ein Krieg mit Millionenheeren und modernen Waffen in einem Grabenkrieg festlaufen konnte, hatte man zwar seit dem Russisch-Japanischen Krieg von 1904/05 grundsätzlich erkannt, aber für den europäischen Kriegsschauplatz als unwahrscheinlich verworfen. Auf diesen Wandel der Qualität des Krieges musste die Militärführung neue Antworten finden. Der Einsatz von schwerer Artillerie, von Flammenwerfern und Maschinengewehren sowie die Bedingungen des Grabenkriegs stellten auch die höhere Führung vor neue Herausforderungen. Lange fehlte es der Militärelite jedoch an einem Konzept, wie der festgefahrene und verlustreiche Grabenkrieg wieder zu einem Bewegungskrieg gemacht werden konnte. In breiter Erinnerung ist dabei vor allem ein geflügeltes britisches Sprichwort geblieben, das die einfachen britischen Soldaten „Löwen“ nannte, die von „Lämmern“ geführt worden seien6 – eine Umschreibung, die häufig auch auf die deutsche Generalität angewandt wird. Tatsächlich symbolisiert nichts besser die Sinnlosigkeit des Ersten Weltkrieges als die Menschenleben verschlingenden Kämpfe um wenige Meter umgepflügten Ackerboden vor Verdun oder an der Somme.
Die Erwartungen der deutschen Militärführung an den Ablauf eines Krieges wurden auch im Hinblick auf den Seekrieg enttäuscht. Die deutsche Marineführung hatte seit Jahren auf eine alles entscheidende Seeschlacht gegen Großbritannien hingearbeitet, die dann im Verlaufe des Krieges ausblieb. Auch wenn sich die beiden Kontrahenten in mehreren Gefechten gegenüberstanden, kam es nicht zu jener Konfrontation, die sich beide erhofft hatten. Schließlich riegelte die britische Royal Navy, anders als von der kaiserlichen Marine erwartet, die Nordsee nicht in der Nähe der deutschen Küste, sondern zwischen Großbritannien und Norwegen ab. Für die deutsche Flotte und ihre Führer bedeutete der Erste Weltkrieg daher in erster Linie eine Zeit angespannten Wartens, häufig verbunden mit gähnender Langeweile.
Der Erste Weltkrieg unterschied sich jedoch nicht nur an der Front, sondern auch in der Heimat von vorangegangenen Konflikten. Die zunehmende Totalisierung des Kriegs forderte nicht nur ein „Volk in Waffen“, bei dem jeder taugliche Mann eingezogen wurde. Vielmehr wurde auch die gesamte Wirtschaft dem Primat des Militärischen untergeordnet. Damit änderte sich auch die gesellschaftliche Rolle der Frauen, die nun den Platz der Männer in der heimischen Kriegswirtschaft einnehmen mussten. Diese Ereignisse in der Heimat ließen auch die deutsche Militärelite nicht kalt. Abseits ihrer kriegerischen Tätigkeit verfolgten viele Generäle auch die politischen, gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen im Reich. Gerade die zunehmenden gesellschaftlichen Spannungen, die aus der Forderung der Bevölkerung nach mehr politischen Mitspracherechten entstanden und schließlich in ausgedehnten Streiks und zaghaften Parlamentarisierungsbemühungen der kaiserlichen Regierung gipfelten, wurden von der Militärelite an der Front kritisch beäugt. Andere Militärs verschlossen hingegen ihre Augen vor den Vorgängen in der Heimat, fokussierten sich auf ihr kriegerisches Kerngeschäft und wurden von den Ereignissen im November 1918 umso härter getroffen.
Die lange Dauer des Krieges und die Tendenz zur Totalisierung des Konflikts führten zu einem Machtwachstum der Militärführung. Verkörpert wurde dieses vor allem durch die 3. Oberste Heeresleitung (OHL) unter Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff, die ab August 1916 in alle militärischen und zivilen Bereiche eingriff. Auch wenn die beiden Militärs de jure nicht die politische Leitung des Reiches übernahmen, übten sie aufgrund ihres militärischen Prestiges de facto eine Militärdiktatur mit weitreichenden Kompetenzen aus.7 Mit dem „Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst“, das die OHL vehement gefordert hatte, wurden alle deutschen Männer vom 17. bis zum 60. Lebensjahr erfasst und zur Dienstleistung in der Kriegswirtschaft verpflichtet. In sozialpolitischer Hinsicht erkannte es erstmals die Gewerkschaften an und kam damit der Arbeiterschaft entgegen, um Streiks zu verhindern und die Unzufriedenheit zu verringern. Militärisch setzten Hindenburg und Ludendorff auf eine Entscheidung des Konflikts mithilfe des uneingeschränkten U-Boot-Krieges, was den finalen Ausschlag zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten von Amerika gab.
Die deutsche Militärführung war letztlich auch verantwortlich für zahlreiche Kriegsverbrechen, die vor allem, aber nicht nur im Rahmen des deutschen Einmarschs in Belgien verübt wurden. Mit der Verletzung der belgischen und luxemburgischen Neutralität, aber auch mit der Verkündung und Durchführung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges nahmen die hochrangigen Militärs den Bruch des Völkerrechts in Kauf, um den Krieg siegreich zu beenden. Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg hatte dabei die wirkmächtigste Parole bereits am 4. August 1914 im Reichstag vorgegeben: „Not kennt kein Gebot.“8 Das deutsche Vorgehen erwies sich letztlich als äußerst kontraproduktiv, gab es den Alliierten doch die Möglichkeit, mit dem „blutrünstigen Hunnen“ ein wirkmächtiges Propagandamotiv zu erschaffen. Deutsche Kriegsverbrechen wirkten auch nach Ende der Kampfhandlungen noch nach und veranlassten die Siegermächte schließlich zur Forderung nach Auslieferung der beteiligten Offiziere.
Angesichts des erfolgreichen Beginns des Krieges, bei dem die deutschen Truppen tief in französisches, belgisches und später auch in russisches, serbisches und rumänisches Gebiet vorstießen, mündeten die Kriegszieldiskussionen im Deutschen Reich rasch in weitreichenden Annexionsforderungen, wobei auch die deutsche Generalität zu großen Teilen als Verfechter eines „Siegfriedens“ in Erscheinung trat. Es waren unter anderem diese „Siegfrieden-Illusionen“, die eine frühzeitige Beilegung des Konflikts verhinderten und dazu beitrugen, dass viele Militärs wider besseres Wissen auch im Sommer 1918 noch keine Verhandlungen mit den Alliierten über eine Beendigung des Krieges führen wollten.9
Als sich der militärische Zusammenbruch nicht mehr vermeiden ließ, gelang es der deutschen Militärführung, sich der Verantwortung zu entziehen und das Odium der Niederlage der neuen politischen Führung zuzuschieben. Unter dem Schlagwort „im Felde unbesiegt“ klagten zahlreiche hochrangige Militärs nach dem Krieg die deutsche Heimatfront an, den „siegreichen“ deutschen Truppen in den Rücken gefallen zu sein. Diese „Dolchstoßlegende“ sollte sich schnell als schwere Hypothek für die neu entstandene deutsche Republik erweisen.10
Für die Militärs zeitigte die Niederlage aber noch wesentlich tiefgreifendere Folgen: Als erste Verfechter des monarchischen Gedankens brach für einen Großteil der deutschen Militärelite mit der Abdankung und Flucht des Kaisers eine Welt zusammen. Das schmachvolle Ende der Hohenzollern-Dynastie beraubte die Offiziere ihres „Obersten Kriegsherrn“, auf den sie ihren Eid geleistet hatten. Gerade in Marinekreisen genoss Wilhelm II. aufgrund seiner Förderung der deutschen Flotte bis zum Ende des Krieges ein ungeheuer großes Ansehen, der Schock über den Verlust der Leitfigur wirkte hier noch stärker als im Heer. Die neue demokratische Staatsform blieb vielen hochrangigen Offizieren daher zeitlebens fremd. Viele verharrten in innerer Opposition, einige betätigten sich öffentlich gegen die Weimarer Republik. Die meisten Militärs schrieben sich den Kampf gegen den als „Schandfrieden“ empfundenen Versailler Vertrag auf die Fahnen und suchten innerhalb des rechten politischen Spektrums nach neuen Leitfiguren, die diesen Kampf zu führen bereit waren.
Der vorliegende Band stellt 24 hochrangige Militärs des Deutschen Kaiserreichs vor, die während des Ersten Weltkrieges wichtige Kommandooder Generalstabsstellen innehatten. Viele der hier beleuchteten Offiziere sind bislang noch nicht durch eine fundierte biografische Skizze untersucht worden. Aufgrund der hohen Anzahl von Personen, die im Zeitraum des „Großen Krieges“ in den Generals- und Admiralsrang aufstiegen oder wichtige Stabsstellen besetzten, kann die hier getroffene Auswahl natürlich nur einen kleinen Ausschnitt bieten.11 Die vorgestellten Personen sollten sowohl die West- und die Ostfront als auch die Nebenfronten auf dem Balkan, im Orient und in den deutschen Kolonien repräsentieren.
Aufgenommen wurden Offiziere, die in ihrer Stellung über ein gewisses Maß an Einfluss auf militärische oder politische Entscheidungen verfügten, sei es als Oberbefehlshaber eines Großverbands, als Generalstabschefs oder als ranghohe Generalstabsoffiziere in der Obersten Heeresleitung. Die Auswahl der Marineoffiziere beschränkte sich bewusst auf lediglich zwei Personen, da die Kaiserliche Marine in weiten Teilen des Krieges zu einer passiven Rolle verurteilt war und die Entscheidung des Konflikts auf dem Land fiel. So groß die politische und finanzielle Bedeutung der Flotte in der Vorkriegszeit war, so wenig trug sie letztlich zur militärischen Entscheidung des „Völkerringens“ bei. Hinzu kommt mit Ernst von Hoeppner der „Kommandierende General der Luftstreitkräfte“ und damit der erste deutsche Soldat, der die Aufsicht über eine deutsche Luftwaffe in Kriegszeiten führte. Dass bei dieser Auswahl einige Offiziere nicht mit aufgenommen werden konnten, die während des Ersten Weltkriegs ebenfalls als meinungsstarke und einflussreiche Personen in hohen Stellungen gedient haben, ist dem begrenzten Platz innerhalb dieses Sammelbandes geschuldet.
Inhaltlich soll bei diesen biografischen Abrissen vor allem, aber nicht ausschließlich, die Zeit des Ersten Weltkriegs im Mittelpunkt stehen. Zentral sind dabei die Fragen, wer die Angehörigen der Militärelite waren und wie sie zu den wichtigsten militärischen, politischen, gesellschaftlichen und sozialen Ereignissen des Krieges standen.12 Sofern es die Quellenlage zulässt, sollen sowohl innenpolitische Ansichten der Militärs berücksichtigt werden (etwa über die deutsche Sozialdemokratie oder den Sturz der Hohenzollern-Monarchie) als auch außenpolitische Anschauungen Erwähnung finden (etwa über die russische Oktoberrevolution, die Verletzung der belgischen Neutralität oder den Kriegseintritt der USA). Auch soll ihre Beteiligung an der Kriegszieldiskussion miteinbezogen werden. Zeigten sich die Militärs als Annexionisten oder setzten sie sich für einen Vernunftfrieden ein? Drängten sie auf einen Waffenstillstand oder verschlossen sie bis zum Schluss die Augen vor der militärischen Realität? Politischen Fragestellungen soll dabei ebenso nachgegangen werden wie wirtschaftlichen und technischen Perspektiven.
Zudem sollen die Militärs auch im Hinblick auf militärische Fragen durchleuchtet werden. Wie beurteilten sie die deutschen Chancen auf einen Sieg? Für welche strategischen und operativen Maßnahmen machten sie sich stark? Wie standen die hier untersuchten Generäle und Admiräle zu dem Einsatz von Giftgas, wie zur Verkündung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges? Wie standen sie zu den von deutschen Truppen verübten Kriegsverbrechen? Nahmen sie die unmenschlichen Lebensbedingungen der einfachen Soldaten in den Schützengräben wahr, und wenn ja, standen sie diesen Entbehrungen gleichgültig oder mitfühlend gegenüber? Wie wirkte auf die hochrangige Generalität und Admiralität der zum Grabenkrieg erstarrte Abnutzungskampf? Welche Lösungsansätze suchten die Militärs, um die gescheiterten operativen Vorkriegsvorstellungen wieder zum Leben zu erwecken und so den Stellungskrieg aufzubrechen? Im Hinblick auf die Marine ist zudem die Frage interessant, wie die deutsche Admiralität mit der weitgehend passiven Rolle ihrer Teilstreikraft zurechtkam und wie sie die Leistungen des deutschen Heeres beurteilte.13 Hier wäre neben den operationsgeschichtlichen Fragen auch Raum für sozialhistorische und kulturgeschichtliche Perspektiven.
Abseits der Jahre 1914 bis 1918 sollen die biografischen Skizzen auch den Werdegang der einzelnen Militärs nachzeichnen, wobei auch hier die Fragen nach politischen und gesellschaftlichen Ansichten im Mittelpunkt stehen. Sehnten sich die hier untersuchten Generäle und Admiräle nach einem Krieg, wie dies beispielsweise für Erich von Falkenhayn konstatiert werden kann?14 Auch die Zeit nach der deutschen Niederlage soll in den Beiträgen zur Sprache kommen. Hier ist vor allem die Frage interessant, wie die Militärs, die im Kaiserreich eine monarchietragende Säule waren, zur neuen demokratischen Staatsform Deutschlands standen. Schließlich soll die Haltung jener Militärs, die 1933 noch lebten, zum Nationalsozialismus geklärt werden.
Diese Fragen sollen, soweit es die Quellenlage zulässt, durch die folgenden biografischen Skizzen aufgegriffen und beantwortet werden. Angesichts des begrenzten Raums können verständlicherweise nicht alle Aspekte gleichermaßen behandelt werden. Der vorliegende Sammelband versteht sich jedoch auch als Anreiz zu weiter gehenden Forschungen. Schließlich bleiben nach wie vor genügend hochrangige Militärs, deren Lebenslauf im Rahmen einer umfangreichen Biografie erforscht werden könnte. Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Während die Kriegserfahrung der einfachen Soldaten vielfach schon im Stile einer Mentalitätsgeschichte oder einer „Militärgeschichte von unten“ untersucht wurde,15 lassen sich vergleichbare Studien über die höhere Militärführung bislang nicht finden. Auch wenn sie nicht in den Schützengräben einen täglichen Kampf ums Überleben führen mussten, erlitten sie doch auch persönliche Schicksalsschläge. Auch sie „erlebten“ den Ersten Weltkrieg – eben auf eine andere Art und Weise als die einfachen Soldaten.
Als Herausgeber danke ich ganz herzlich allen Beiträgern dieses Sammelbands, die mit vielen Biografien historiografisches Neuland betreten haben. Auch sei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft gedankt, die sich zur Drucklegung der Studien bereit erklärt hat. Hier ist vor allem Daniel Zimmermann hervorzuheben, der sich für die Verwirklichung der Idee kontinuierlich eingesetzt hat und auf offene Fragen stets eine Antwort hatte. Ein Wort zur Angabe archivalischer Bestände: Das Bundesarchiv in Freiburg wird bewusst mit „BA-MA“ abgekürzt, um es von den anderen Dienststellen des Bundesarchivs abzuheben.