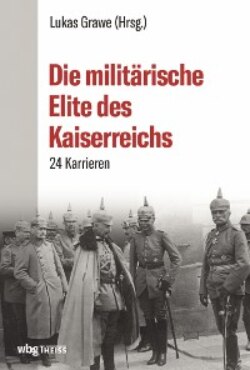Читать книгу Die militärische Elite des Kaiserreichs - Группа авторов - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
General der Infanterie Erich von Falkenhayn
Оглавлениеvon Holger Afflerbach
Erich von Falkenhayn, der am 11. September 1861 in Graudenz geboren wurde und am 8. April 1922 in Schloss Lindstedt bei Potsdam starb, war eine der wichtigsten militärischen und politischen Persönlichkeiten des späten Wilhelminismus. Eine außergewöhnliche soldatische Karriere brachte ihn an die Spitze des deutschen Heeres. Falkenhayn war von 1913 bis 1915 preußischer Kriegsminister und von 1914 bis 1916 Generalstabschef und damit Oberkommandierender der deutschen Armee. Er muss dem kleinen Kreis europäischer Politiker, Diplomaten und Militärs zugerechnet werden, die während der Julikrise 1914 über Krieg und Frieden zu entscheiden hatten. Der General zählt damit zu den Mitverantwortlichen für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und hat später, als Generalstabschef, die deutsche Strategie der ersten beiden Kriegsjahre geprägt.
Generalstabschef Erich von Falkenhayn (Foto um 1913/14)
Das Thema Soldatentum und Krieg dominierten Falkenhayns Leben in ungewöhnlicher und fast ausschließlicher Weise. Schon seine Familie – Falkenhayn war, vom familiären Hintergrund her, ein „preußischer Junker“ – war militärisch geprägt. Von seinen fünf Brüdern wurden vier Berufssoldaten, einer Reserveoffizier; seine einzige Schwester heiratete einen späteren General. Mit zehn Jahren kam Falkenhayn in die Kadettenanstalt, machte dort Abitur, wurde Leutnant, durchlief seine soldatische Laufbahn, bis er, als bereits todkranker Mann, 1919 seinen Abschied erhielt.
Seine militärische Karriere führte ihn ganz nach oben. Er kam als Oberleutnant in die Generalstabsausbildung, was bereits ein bedeutender Karrieresprung war, den nur die Tüchtigsten schafften. Doch dann, im Jahre 1896, nahm er als Hauptmann plötzlich seinen Abschied und ging als Militärinstrukteur nach China. Dieser Schritt war für einen preußischen Offizier äußerst ungewöhnlich und es wurde von den Zeitgenossen vermutet, Falkenhayn habe wegen Spielschulden die Armee verlassen müssen. In Wahrheit jedoch nahm er den Posten als Militärinstrukteur mit kaiserlichem Segen an; der Schritt hing mit dem deutschen Versuch zusammen, den Einfluss in Ostasien auszubauen. Falkenhayn blieb nicht lange in chinesischen Diensten und wechselte zuerst in das gerade erworbene Pachtgebiet von Kiaochow, dann, im Zusammenhang mit dem Boxerkrieg, zum Ostasiatischen Expeditionskorps und später zur Ostasiatischen Besatzungsbrigade über; er war auch der deutsche Vertreter in der Militärregierung in Tientsin. Als er 1903 nach Deutschland zurückkehrte, stieg er durch Tüchtigkeit und kaiserliche Protektion sehr schnell zum General auf. Seine Karriere erreichte einen ersten Höhepunkt, als er im Juli 1913 zum preußischen Kriegsminister ernannt wurde. In dieser Funktion hatte er eine wichtige Rolle in der Zabern-Affäre; seine forsche Verteidigung der parlamentsunabhängigen Kommandogewalt trug wesentlich dazu bei, dass sich dieser Kasernenhofskandal zu einer schweren parlamentarischen Krise ausweiten konnte.
Falkenhayn hatte eine Blitzkarriere gemacht. Und trotzdem war er mit seinem Leben nicht zufrieden. Aus einem privaten Briefwechsel mit Constantin von Hannecken, einem in Nordchina tätigen deutschen Unternehmer, geht hervor, dass Falkenhayn sich im Kasernenalltag und vor allem bei der Stabsarbeit tödlich langweilte. Er fühlte sich nicht als „richtiger Generalstäbler“1 und träumte davon, als Militärberater nach China zurückzugehen und sich mit dem hohen Gehalt finanziell sanieren zu können. Und in gleicher Weise ersehnte er sich als militärischer Aktivist dringlichst einen europäischen Krieg. Das Leben eines Friedenssoldaten empfand er als unerträglich öde.2 Deshalb übte er an Kaiser Wilhelm II. wegen dessen angeblicher Friedensliebe auch immer wieder scharfe Kritik.
Doch muss gefragt werden, ob Falkenhayn, als er 1913 als preußischer Kriegsminister eine einflussreiche Stellung erreicht hatte, diesen Gefühlen Taten folgen ließ und tatkräftig mitwirkte, den Weltkrieg herbeizuführen. Gelegenheit dazu bot sich ihm nach der Ermordung Erzherzog Franz Ferdinands in Sarajevo am 28. Juni 1914. Falkenhayn nahm als preußischer Kriegsminister an den entscheidenden Sitzungen im Juli 1914 teil. Sein Einfluss war aber begrenzt: Als Kriegsminister war er für die Organisation, Ausrüstung und Mobilmachung des Heeres zuständig, aber nicht für dessen Führung; dies war Aufgabe des Generalstabschefs, also des jüngeren Moltke, dessen Einfluss auf die politischen Entscheidungen in der Julikrise 1914 weit größer war. In der Besprechung am 5. Juli 1914 („Blankoscheck“) glaubte Falkenhayn nicht, dass sich die österreichisch-ungarische Regierung trotz energischer Worte tatsächlich zum Handeln aufraffen würde, er unterschätzte also die Entschlossenheit der Wiener Regierung zur Eskalation.
Im weiteren Verlauf der Julikrise gab es einen deutlichen Unterschied zwischen Falkenhayn und Generalstabschef Moltke, der den kommenden Weltkrieg für eine europäische Katastrophe hielt und ihn trotzdem herbeiwünschte. Moltke schwankte unter dem Gewicht der gewaltigen Verantwortung, befürwortete aber aus strategischen Gründen den Krieg. Auch Falkenhayn versuchte nicht, den Konflikt zu verhindern, sondern presste auf möglichst frühe Mobilmachung. Gemeinsam mit Moltke, dessen Schwanken und Zögern ihn enervierte, suchte er durch Druck auf Kaiser und Reichskanzler den Kriegsausbruch zu beschleunigen. Falkenhayn glaubte bei seinem Drängen einerseits, auf die Kriegsvorbereitungen der anderen Seite antworten zu müssen. Andererseits wird aus seinen tagebuchähnlichen Aufzeichnungen offensichtlich, dass er sich den Krieg auch in diesen entscheidenden Tagen herbeisehnte. Damit war er absolut kein Einzelfall im deutschen Offizierkorps; aber selten kann ein zu großen Teilen nichtpolitischer, aktivistischer Kriegswunsch so klar belegt werden wie bei ihm. Bei Kriegsbeginn war er begeistert. Zu Reichskanzler Bethmann Hollweg sagte er, mitgerissen vom Enthusiasmus der Menge in Berlin, am 4. August 1914: „Und mögen wir auch darüber zu Grunde gehen, schön wars doch!“3 Allerdings wusste Falkenhayn, dass dieser Krieg – anders als es der Kaiser den Truppen versprochen hatte – nicht vorbei sein würde, „bevor das Laub von den Bäumen fällt.“ Er sprach von einem „furchtbar ernsten Ringen“, das „mindestens eineinhalb Jahre“ dauern werde, und äußerte sich bei Kriegsausbruch sogar skeptisch über die deutschen Siegeschancen.4
Moltke hatte sich in der Julikrise so fahrig und nervös gezeigt, dass der Chef des Militärkabinetts, Moriz Freiherr von Lyncker, sich schon bei Kriegsausbruch nach einem Nachfolger umsah, der in der Lage sein sollte, im Notfall Moltkes Aufgaben sofort übernehmen zu können. Er fragte Falkenhayn, ob er bereitstünde; und dieser bejahte die Frage. Falkenhayn zog mit dem deutschen Hauptquartier, mit Kaiser und Generalstab ins Feld. Dort blieb ihm, als Kriegsminister, zunächst wenig mehr zu tun übrig, als im Hauptquartier in Luxemburg an Moltkes Operationsführung und dessen sklavischem Festhalten am Schlieffen-Plan herumzunörgeln und sich mit diesem darüber vollkommen zu zerstreiten. Nach der Marneschlacht, am 14. September 1914, war es dann so weit. Moltke, der wegen dieser Rückschläge nervös und überreizt war, wurde vom Militärkabinett abgesetzt und Falkenhayn übernahm die Führung der deutschen Armeen, wenn auch zunächst nur kommissarisch, aber ab November 1914 auch offiziell.
Er hielt zunächst am bisherigen strategischen Konzept fest: Die Erringung des Sieges im Westen gegen Frankreich sollte der Ausgangspunkt für den siegreichen Kriegsausgang sein. Er glaubte, durch Umgruppierungen der Angriffsarmeen und Ausgreifen nach Westen die Westmächte doch noch überflügeln zu können, wurde aber in den Flandernschlachten des Herbst 1914 (Ypern und Langemarck) eines Besseren belehrt. Die enormen Verluste dieser ergebnislosen Offensive beschädigten Falkenhayns Reputation außerordentlich. Die Front erstarrte Ende Oktober/Anfang November 1914 endgültig im Schützengrabenkrieg, der sich schon im September angekündigt hatte.
Spätestens Anfang November 1914 erkannte Falkenhayn die Unmöglichkeit, noch einen entscheidenden Durchbruch erzielen zu können. Hier zeigte sich, dass er lernfähig war; zunehmend verfestigte sich bei ihm die Ansicht, dass ein Durchbruch und damit die Schlachtentscheidung im Schützengrabenkrieg an der Westfront nicht mehr erwartet werden dürfe und auch erst nach Erfindung neuer technischer Mittel gelingen könne. Gedrückt durch die Misserfolge an der Westfront und beklemmenden Munitionsmangel wog er nüchtern die langfristigen Perspektiven des Krieges ab und kam zu dem Ergebnis, dass die Entente bei Mobilisierung ihrer weltweiten Ressourcen noch beträchtlich zulegen und die Mittelmächte irgendwann durch das immer ungünstigere Stärkeverhältnis erdrücken werde. Falkenhayn zog daraus die Folgerung, dass so bald wie möglich ein politischer Ausweg aus dem Krieg gesucht werden müsse. Er teilte dem Reichskanzler am 18. November 1914 mit, dass die deutsche Armee nicht mehr in der Lage sei, auf militärischem Wege den Sieg zu erzwingen, und dass deshalb politische Schritte erforderlich seien. Er schlug eine neue Strategie vor, die auf seinen eigenen politischen und strategischen Einschätzungen basierte.
Falkenhayn hielt Russland für einen durch Größe und Bevölkerungsstärke unbezwingbaren Gegner, dem man zwar schwere Niederlagen zufügen, ihn aber niemals vollständig niederwerfen könne. Im Falle Frankreichs spielten in Falkenhayns Einschätzung sowohl politische wie historische Erwägungen eine Rolle. Der westliche Nachbar war für ihn ein Gegner, dessen Unterlegenheit gegenüber dem Deutschen Reich seit 1870 eine Tatsache war, die nicht erneut bewiesen zu werden brauchte; auch hier befürwortete er einen Separatfrieden. Den eigentlich gefährlichen Feind sah Falkenhayn in Großbritannien. Er schlug dem Kanzler eine dieser Einschätzung entsprechende Strategie vor: Sonderfrieden mit Frankreich und Russland, anschließend die Niederzwingung Großbritannien durch die Marine, wenn es nicht nach dem Ausscheiden der kontinentalen Verbündeten von sich aus aufgebe. Um die Friedensverhandlungen nicht zu erschweren, schlug Falkenhayn gegenüber beiden kontinentalen Gegnern einen Annexionsverzicht vor.
Diese Warnung des obersten Soldaten hatte aber nicht die Konsequenzen, die man erwarten sollte. Bethmann Hollweg glaubte Falkenhayn nicht und hielt ihn für einen Schwarzseher, der die Nerven verloren habe. Er wandte sich stattdessen an Paul von Hindenburg und dessen Gehilfen Erich Ludendorff, die beide infolge des Sieges bei Tannenberg und als Retter Ostpreußens vor der russischen Invasion mythischen Ruhm nicht nur in der Armee, sondern auch in der Bevölkerung genossen. Beide vertraten die Ansicht, der deutsche militärische Schwerpunkt sollte nun in den Osten verlegt und Russland durch schwere Niederlagen aus dem Krieg gedrängt werden. Das wiederum harmonierte mit Ideen Bethmann Hollwegs und des Auswärtigen Amtes, den Sinn des Krieges in einer Zurückdrängung Russlands und der Schaffung einer Pufferzone in Osteuropa zu sehen. Somit prallten zwei Konzepte der politischen und militärischen Führung aufeinander: Falkenhayns Erkenntnis der deutschen Schwäche und der daraus resultierende Wunsch nach einem Sonderfrieden vorzugsweise mit Russland und Bethmann Hollwegs, von Hindenburg und Ludendorff lebhaft unterstützter Plan eines militärischen Sieges gegen Russland.
Die Chancen für einen Sonderfrieden waren gering, da sich die Entente-Staaten am 4. September 1914 im Londoner Abkommen verpflichtet hatten, keinen Separatfrieden abzuschließen. In Großbritannien und Frankreich konnten sich die Befürworter eines alliierten Siegfriedens gegen die Vorstöße Andersdenkender immer durchsetzen und über den gesamten Krieg hinweg die Linien der Kriegspolitik bestimmen. Und ähnlich war es, zumindest in den ersten beiden Kriegsjahren, auch in Deutschland. Auch deshalb blieb eine dritte Alternative neben Sieg- oder Separatfriedensstrategie sowohl von Falkenhayn als auch von Bethmann im November 1914 unerörtert: ein Friedensangebot an die gesamte Entente. Falkenhayn nahm an, dieses würde als Schwäche ausgelegt werden und die Gegner nur anspornen, nicht entmutigen.
Es gelang ihm im Winter 1914/15, die militärische Krise des November 1914 zu überwinden. Die Westfront widerstand auch den mit großer Überlegenheit geführten Frühjahrsangriffen der Franzosen. Aus strategischem Zwang heraus musste Falkenhayn im Frühjahr 1915 dann doch eine Offensivoperation an der Ostfront einleiten. Dies lag daran, dass die österreichisch-ungarische Armee gegen die Russen immer weiter zurückging; schon in den ersten Kriegsmonaten hatte sie schwere Verluste erlitten und Territorium preisgeben müssen. Auch zeichnete sich ab, dass Italien, durch die österreichische Schwäche verlockt, zur Eroberung der „irredenten Gebiete“ Trient und Triest in den Krieg eintreten würde. Um die österreichische Ostfront zu stützen und damit Italien abzuschrecken, organisierte Falkenhayn einen Entlastungsangriff an der österreichischen Ostfront in Galizien. Dieser – der Durchbruch von Gorlice-Tarnów, begonnen am 2. Mai 1915 – entwickelte sich zum größten deutschen Sieg des Ersten Weltkriegs. Die Verfolgung der geschlagenen russischen Armeen wurde ein strategischer Erfolg mit großen Auswirkungen auf den gesamten weiteren Kriegsverlauf und führte in seiner Fortsetzung bis in den Herbst 1915 hinein nicht nur zur Befreiung weiter, bisher russisch besetzter österreichischer Gebiete, sondern auch zur Eroberung Russisch-Polens und von Teilen des Baltikums.
Doch, darin im scharfen Gegensatz zu Hindenburg und Ludendorff, war und blieb Falkenhayn an der Eroberung weiter Landstriche im Osten desinteressiert. Stattdessen drängte er den Reichskanzler schon im Mai 1915, die militärischen Erfolge zu einem Sonderfriedensangebot an Russland auszunutzen – auch „unter Verzicht auf jeden Landerwerb“ im Osten. Dieser Vorstoß scheiterte weniger an der lauwarmen Haltung des Kanzlers als vielmehr am Zaren, der diese historische Chance, sein Land, seine Regierung, seine Familie und seine Person zu retten, ablehnte; er begründete sein Nein mit der Loyalität gegenüber seinen Verbündeten.
Das Kriegsjahr 1915 war für die Mittelmächte das erfolgreichste des gesamten Krieges. Zu den Erfolgen an der Ostfront gesellte sich die erfolgreiche Abwehr im Westen und an den Dardanellen sowie die Eroberung Serbiens im Herbst 1915. Für Falkenhayn stellte sich nun die Frage, wie er diesen Krieg jetzt weiterführen sollte. Immerhin schien eines erreicht: die Brechung der russischen Offensivkraft. Nun wollte Falkenhayn durch ähnliche Teilschläge den Kriegswillen der Westmächte brechen: Durch einen Angriff gegen Verdun sollten die Franzosen friedensbereit gemacht und durch die Erklärung des warnungslosen U-Boot-Krieges die Briten zum Nachgeben gezwungen werden. Hier sehen wir erneut seine Konzeption begrenzter Schläge: Er zielte nicht auf einen militärischen Totalsieg ab, sondern auf die „Ermattung“ der Gegner, um ein letztlich politisches Kriegsende zu ermöglichen.
Der Angriff auf Verdun wurde von Falkenhayn im Dezember 1915 konzipiert. Er stellte sich vor, dass mithilfe von starker Artillerie, aber nur beschränktem infanteristischem Einsatz – zehn Divisionen aus der Heeresreserve – eine lang gezogene Höhenlinie vor dieser wichtigen französischen Festung im Handstreich erobert werden sollte. Dort sollte dann schwere deutsche Artillerie postiert werden. Die Festung Verdun wäre damit dem deutschen Beschuss hilflos ausgeliefert gewesen. Dem französischen Oberkommando würden nur zwei Alternativen bleiben: Verdun zu räumen, was für Deutschland ein gewaltiger, wenn auch nicht kriegsentscheidender Erfolg gewesen wäre, oder aber, was Falkenhayn als wahrscheinlich annahm, zur Rückeroberung der Höhenlinien anzutreten, um diese Bedrohung auszuschalten. Falkenhayn wollte die Franzosen also, im buchstäblichen Sinne, zu einer „uphill battle“ zwingen, die scheitern musste und ihnen gewaltige Verluste zufügen würde. Daran knüpfte er auch die Hoffnung, die Briten würden ihren wankenden Verbündeten durch einen überhasteten Entlastungsangriff stützen müssen, zu dessen Abwehr er einen beträchtlichen Teil seiner Reserven zurückhielt. Also wollte er auch die Briten zum verlustreichen Angriff im Schützengrabenkrieg zwingen.
Eng damit verbunden waren Falkenhayns Forderungen, den unbeschränkten U-Boot-Krieg wieder aufzunehmen. Die, wie die anglophobe Fraktion in der deutschen Führung, allen voran Falkenhayn und Tirpitz, glaubte, von einer kühl rechnenden Handelsoligarchie regierte Inselnation würde den Krieg abbrechen, wenn es infolge des warnungslosen U-Boot-Krieges an ihre eigene Substanz ginge – und das wäre bei der Versenkung wesentlicher Teile ihrer Handelsflotte, vielleicht sogar einer Hungersnot in Großbritannien der Fall. Allerdings besaß die Marine zur Durchführung einer effektiven Blockade der Britischen Inseln nicht die nötige Zahl an Hochsee-U-Booten. Tirpitz half sich, indem er die Zahl einsatzbereiter U-Boote manipulierte, unter anderem durch Hinzunahme der im Bau befindlichen und reiner Küsten-U-Boote. Falkenhayn wiederum hinterfragte die Angaben der Marine nicht und versuchte auch dem kritischeren Reichskanzler, der den unbeschränkten U-Boot-Krieg verhindern wollte, die Einmischung in eine Ressortangelegenheit der anderen Teilstreitkraft zu verwehren.
Falkenhayns Kriegsplan für 1916 fußte auf grundfalschen und unmilitärischen Spekulationen. Er basierte auf der Hoffnung, dass nicht geschlagene und militärisch auch nicht zu schlagende Gegner die Nerven verloren und aufgaben, obwohl sie bei kühlem Kopf weiterkämpfen konnten. Ursache für diese eigenartige Form der Kriegsplanung, die nicht mehr auf die stärkeren Bataillone, sondern auf völkerpsychologische Betrachtungen setzte und strategische Fehler der anderen Seite fest einkalkulierte, war allerdings die vollständige Alternativlosigkeit der Politik, das heißt Bethmanns, ein politisches Kriegsende herbeiführen zu können und zu wollen; und die wachsende Verzweiflung Falkenhayns, der angesichts der von ihm oftmals eingestandenen kräftemäßigen Unterlegenheit der deutschen Armeen nicht wusste, wie er den Krieg zu Ende bringen sollte, bevor die deutschen Kräfte erschöpft waren.
Falkenhayn konnte sich in der Frage des unbeschränkten U-Boot-Krieges gegen die Diplomaten, die dies mit Rücksicht auf das neutrale Amerika verhindern wollten, nicht durchsetzen, wohl aber setzte er den Angriff gegen die Franzosen in die Tat um. Der Angriff auf Verdun war eine Idee von zynischer Genialität, die, wenn alles wie geplant funktioniert hätte, für die Franzosen unangenehme Folgen hätte haben können. Die Voraussetzung zu ihrem Erfolg war aber die rasche Einnahme der entscheidenden Höhenlinien vor der Festung. Der Angriff begann am 21. Februar 1916. Er misslang jedoch aufgrund verschiedener taktischer Fehler, die Falkenhayn zu verantworten hatte; vor allem war die Angriffsarmee infantristisch zu schwach berechnet und der Angriff wurde gegen das Anraten aller Experten nur auf einem Maasufer vorgetragen.
Das Ergebnis war jedoch schlimmer als ein sofortiges Scheitern; der Angriff wurde ein verhängnisvoller halber Erfolg. Es wurden spektakuläre Anfangserfolge erzielt, wie die Eroberung von Fort Douaumont, die nicht einfach wieder aufgegeben werden sollten; die erreichte Linie war aber taktisch so ungünstig, dass sie auf Dauer nicht zu halten war. Stattdessen entschieden Falkenhayn und der Stabschef der vor Verdun kämpfenden 5. Armee, Konstantin Schmidt von Knobelsdorf, im langsamen Vorkämpfen die ursprünglich erstrebte Linie doch noch zu erreichen. Beide halfen sich auch gegenseitig über zahlreiche Momente des Zweifelns hinweg; diese waren allerdings nur zu berechtigt. Die Kämpfe waren bald schon für die deutschen Truppen sehr verlustreich; die Opfer wurden von Falkenhayn aber in Kauf genommen, da er die französischen Verluste weit überschätzte und glaubte, dass die Franzosen bedeutend stärker litten. Ursprünglich hatte er nur mit den Verlusten gerechnet, die den Franzosen beim Angriff auf die Höhenlinie entstehen sollten; jetzt, da die deutschen Truppen die andere Hälfte dieser Höhenlinie erst noch erobern mussten und ebenfalls stark litten, tröstete er sich mit dem Gedankengang, dass sein Plan zwar nicht wie vorausberechnet funktioniert hatte, aber doch gut genug und die Franzosen proportional derart stärker litten als die Deutschen, dass sie irgendwann keine Soldaten – wie man damals sagte, kein „Menschenmaterial“ – mehr haben würden. Jeder deutsche Soldat, der fiel, war in dieser Sicht zu verantworten, denn für ihn fielen, wie Falkenhayn glaubte, drei Franzosen. Tatsächlich lag die Verlustbilanz am Ende der Kämpfe vor Verdun aber nur bei 1:1,1 zu deutschen Gunsten.
Falkenhayn schaffte es nicht, das schon Ende Februar 1916 im Kern misslungene Unternehmen einfach abzubrechen, sondern krallte sich fest und ließ den Angriff monatelang weiterlaufen. Doch ist hier zu erwähnen – nicht zu seiner Entlastung, sondern zur historischen Einordnung eines solchen Verhaltens –, dass die politischen Planer und die militärischen Stäbe ihr Ziel, den Krieg zu gewinnen, höher einschätzten als die Opfer, die dies kostete. Bethmann Hollweg, Clemenceau und Lloyd George waren infolge ihrer Weigerung, den Krieg politisch und auf dem Kompromissweg beenden zu wollen, indirektere, aber keine geringeren Schlächter als Falkenhayn, Joffre oder Haig. Hinzu kam, dass in allen Planungsstäben des Ersten Weltkriegs Soldaten nicht als Menschen, sondern wie ein Nachschubartikel behandelt wurden. Auch Falkenhayn gab mehrfach die typische Anweisung aus, „Männer und Munition“ zu sparen.
Angesichts der angeblichen „Ausblutungs-Erfolge“ vor Verdun, eines österreichischen Sieges gegen die Italiener und der Passivität aller Gegner rechnete Falkenhayn im Mai 1916 mit dem Sieg noch im Herbst 1916, spätestens im Frühjahr 1917. Da schien es zunächst nur ein Schönheitsfehler zu sein, als die Russen bei einem überraschenden Angriff bei Luck Ende Juni 1916 einen Abschnitt der österreichischen Front überrannten, obwohl sie zahlenmäßig dem Verteidiger kaum überlegen waren. Es dauerte Wochen, bis Falkenhayn und der Generalstab den Ernst der Lage erkannten. Sie mussten den Österreichern mit umfangreichen Truppenentsendungen aushelfen, um ihren Zusammenbruch zu verhindern. Doch es kam noch schlimmer: Die Alliierten griffen im Juli 1916 an allen Fronten an. Mit den gleichzeitigen Angriffen an der Somme, am Isonzo und der Brussilow-Offensive nahmen sie die Mittelmächte in die Zange. Allerdings erwies sich der alliierte Angriff an der Somme für Franzosen wie Briten schnell als ungeheurer Fehlschlag. Die Briten hatten schon am ersten Angriffstag fast 60.000 Verluste zu beklagen, und kein Erfolg wog die Opfer auf.
Falkenhayn gelangte Mitte Juli 1916 zu der Erkenntnis, dass im Westen „die Situation ernst und schwer“ sei, allerdings würde die Westfront halten.5 lm Osten wollte die Stabilisierung der Österreicher trotz des immer größeren Einsatzes deutscher Reserven, die als „Korsettstangen“ zur Stützung der österreichischen Front beitragen sollten, hingegen nicht richtig gelingen. In dieser Situation kam es erneut zum Strategiestreit in der deutschen Führungsspitze. Bethmann war nunmehr entschlossen, Falkenhayn auszutauschen. Sein Konzept des unbedingten Vorranges der Westfront schien falsch, denn die Westfront hielt zwar, aber die russischen Erfolge gegen die Österreicher drohten den Krieg zu entscheiden. Aktive Schützenhilfe erhielt der Reichskanzler dabei von Hindenburg und Ludendorff, die ihren Befehlsbereich an der Ostfront auszuweiten suchten; gleichzeitig arbeiteten sie auf die Ablösung Falkenhayns hin. Diesem gelang es zunächst, sich gegen seine Opponenten zu behaupten. Doch nahm die Kritik an seiner Führung ebenso wie die Nervosität der deutschen Führung infolge des Allfrontenangriffes weiter zu. Wie angespannt die Lage war, sieht man an der Entwicklung der Heeresreserven: Anfang 1916 hatte das Deutsche Reich eine Heeresreserve von 25½ Divisionen, die im August 1916 auf eine einzige Division zusammengeschrumpft war.6 Noch hielten die Fronten, aber jede weitere, auch nur kleine Belastung drohte den Zusammenbruch nach sich zu ziehen.
Als Ende August 1916 die Wucht der alliierten Angriffe bereits wieder abzunehmen begann und sich die Lage leicht entspannte, trat Rumänien, verleitet durch die militärische Schwäche Österreich-Ungarns, an alliierter Seite in den Krieg ein. Das war der Todesstoß für Falkenhayn, der den sich ankündigenden Kriegseintritt des Agrarlandes Rumänien erst für Ende September, nach der Ernte erwartet hatte. Am 28. August 1916 wurde er durch Hindenburg und Ludendorff ersetzt. Der Wechsel des Generalstabschefs war nicht nur ein Personenwechsel, es war ein Wechsel in der gesamten Strategie und, um mit dem Historiker Gerhard Ritter zu sprechen, ein „epochaler Abschnitt“ in der Geschichte des Deutschen Reiches.7 Falkenhayn hatte viele Fehler begangen, von denen die Flandernschlachten und Verdun zu Lande, der von ihm geforderte unbeschränkte U-Boot-Krieg zur See die schwersten waren. Er hatte von seinen Soldaten Ungeheuerliches verlangt und ihren massenhaften Tod mit einem Zynismus in Kauf genommen, der sein Andenken für immer verdunkeln wird. Andererseits hatte er, was das Strategische angeht, den Blick für das Mögliche nicht verloren, war deshalb gegen das Streben nach einem Totalsieg eingetreten und hatte auf ein politisches Kriegsende hingearbeitet. Er hatte Annexionen abgelehnt und befürwortete im Wesentlichen den Status quo. Sein Credo war: „Wenn wir den Krieg nicht verlieren, haben wir ihn gewonnen.“8
Mit Ludendorff und seinem nominellen Chef Hindenburg kehrten nun ein anderer Geist und ein anderes Konzept des Krieges im Generalstab ein.9 Dies war ein Wechsel mit ungeheuren historischen Fernwirkungen. Der wesentliche strategische Unterschied war, dass Ludendorff glaubte, durch geschickte strategische Dispositionen und unter Anspannung aller Kräfte den militärischen Sieg gegen einen nicht kompromissbereiten Gegner erfechten und ihm den deutschen Willen aufzwingen zu können. Er zog den militärischen Totalsieg als einzige realistische Möglichkeit des Kriegsendes – neben der Niederlage – in Betracht. Die historischen Folgen des Führungswechsels im August 1916 gehen weit über den Ersten Weltkrieg hinaus. Ludendorff war nicht nur an der Überspannung der deutschen Kräfte schuld, die in der Niederlage des Jahres 1918 gipfelte. Seine Überzeugung von der Bezwingbarkeit Russlands und seine Pläne eines deutsch kontrollierten Osteuropas formten das Weltbild deutscher Offiziere der Zwischenkriegszeit und sind ein direkter Vorläufer der katastrophalen Ideen, die hin zum Unternehmen „Barbarossa“ führten.
Nach seiner mit Haltung hingenommenen Ablösung war Falkenhayn ein resignierter und gebrochener Mann. Er war nicht freiwillig ausgeschieden und hatte das Gefühl, versagt zu haben. Der General verbrachte den Rest seines Lebens damit, vor dieser nur halb eingestandenen Erkenntnis zu fliehen. Falkenhayn konnte aber noch einige wichtige Kommandos übernehmen. Im Herbst 1916 wurde er als Armeeführer gegen Rumänien eingesetzt und konnte dort durch einen brillanten Feldzug, der nach wenig mehr als zwei Monaten zur Eroberung Bukarests führte, sein militärisches Renommee wieder auffrischen. Mit dieser Offensive, einer der eindrucksvollsten des Ersten Weltkriegs, hatte Falkenhayn sich selbst, den Zeitgenossen und der Nachwelt gezeigt, dass er ein großer militärischer Könner war. Danach wurde er in die Türkei entsandt, um die Wiedereroberung Bagdads in die Wege zu leiten; tatsächlich erzwangen es die strategischen Umstände, dass er sich in Wahrheit um die Verteidigung Palästinas kümmern musste. Hier scheiterte er, wofür aber die äußerst ungünstigen Umstände, die Überlegenheit der Alliierten, die katastrophalen Nachschubverbindungen und die Erschöpfung und Unterernährung der türkischen Truppen die Hauptursache waren. Es gelang Falkenhayn nicht, Jerusalem gegen die Briten zu verteidigen. Stattdessen erwarb er ein ganz anderes, großes Verdienst: Er beschützte die jüdischen Siedler in Palästina gegen eine von den Osmanen geplante Umsiedelung, die wegen deren angeblicher Kollaboration mit den Alliierten geplant wurde, und verhinderte damit, dass diese sich, wie bei den Armeniern 1915, vielleicht zu einem Völkermord entwickelt hätte.
1918 wurde er aus der Türkei abberufen und verbrachte den Rest des Krieges als Armeeführer an der Ostfront, wo er jedoch, nach dem Friedensschluss von Brest-Litowsk, nur noch eine Besatzungsarmee kommandierte. Schon hier zeigten sich die ersten Symptome einer dann zum Tode führenden Krankheit, nämlich einer Niereninsuffizienz. Er kehrte im Januar 1919 nach Deutschland zurück und nahm, bereits schwer krank, seinen Abschied. Physisch und psychisch äußerst mitgenommen, außerdem angefeindet durch seine Gegner in der Generalität und der Öffentlichkeit schrieb er seine Memoiren. Im Mai 1920 mietete er das Schlösschen Lindstedt bei Potsdam, das ihn finanziell zu ruinieren drohte. Am 8. April 1922 starb Falkenhayn und wurde unter großem militärischem Gepränge auf dem Friedhof Bornstedt in Potsdam beigesetzt.
Falkenhayns Geschichte ist die eines Mannes, bei dem sich vernünftige, abgewogene, sachliche Anschauungen ebenso nachweisen lassen wie höchst unvernünftige, ja mörderische Ideen. Er gehörte zu der alten Schule preußischer Militärs, die, bei allen Fehlern, in Kategorien der begrenzten deutschen Möglichkeiten dachten und deshalb uferlose Welteroberungspläne ablehnten. Er kann stellvertretend für jene Generation wilhelminischer Offiziere genommen werden, die sich aus einer Mischung von militärischem Aktivismus und soldatischem Überlegenheitsgefühl in erschreckender Leichtfertigkeit einen Krieg herbeisehnten. Für Falkenhayn war die Aussicht, sich als Soldat im Krieg bewähren zu können, offenbar wichtiger als die politischen Momente, die gegen einen solchen Krieg sprachen und die er kannte und offenbar auch für zutreffend hielt. Hier trug Falkenhayn eine ungeheure Verantwortung, der er nicht gerecht geworden ist. Seine Führung von 1914 bis 1916 zeigt ebenfalls ein Doppelgesicht: Seine Einsicht in die beschänkten deutschen Möglichkeiten, sein Streben nach einem politischen Kriegsende und seine flexible Anpassung an die strategischen Notwendigkeiten verdienen Anerkennung, sein überlanges Festhalten an den nutzlosen Massenschlächtereien vor Ypern und vor Verdun hingegen und der Zynismus, mit dem er hohe Verluste in Kauf nahm und rechtfertigte, schärfste Kritik. Falkenhayns Kriegstreibereien vor 1914 und dann vor allem der „Ausblutungsgedanke“, mit dem er das Massaker vor Verdun erklärte und rechtfertigte, verdunkeln sein Andenken bis heute und überschatten die positiven Seiten seiner militärischpolitischen Tätigkeit während des Ersten Weltkriegs.