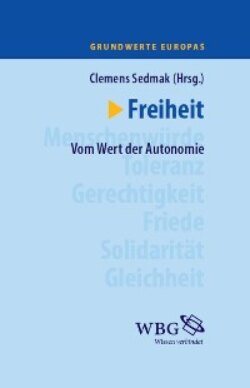Читать книгу Freiheit - Группа авторов - Страница 10
Moralische Verantwortung6
ОглавлениеDie Ausdrücke „verantwortlich“ und „Verantwortung“ werden vieldeutig verwendet. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf die Frage, unter welchen Bedingungen es objektiv gerechtfertigt ist, jemanden moralisch verantwortlich zu machen (und sie insofern als frei anzusehen); dies ist allein schon deshalb zu klären, weil aus naturalistischer Sicht das subjektive Gefühl, frei zu handeln, eine Sache ist, eine ganz andere aber die Frage nach den Ursachen, in Bezug worauf unser Handeln wissenschaftlich erklärt werden kann. Mithin ist entscheidend, ob es möglich ist, Bedingungen anzugeben, die notwendig sind, damit es gerechtfertigt ist, jemandem moralische Verantwortung zuzurechnen. Um dies zu klären, müssen wir genau genommen zwei Fragen beantworten, nämlich einerseits, unter welchen Bedingungen es gerechtfertigt ist, jemandem überhaupt Verantwortung zuzurechnen, und andererseits, was es heißt zu sagen, jemand sei moralisch verantwortlich für etwas.
Wenn jemandem Verantwortung zugerechnet wird,7 so kann dies auf mindestens zweierlei Arten geschehen, die miteinander zusammenhängen, aber nicht identisch sind, nämlich im deskriptiven und im normativen Sinne. Das Zurechnen von Verantwortung im deskriptiven Sinne ist laut Hans Kelsen mit kausalen Erklärungen der Art „Wenn A der Fall ist, dann ist auch B der Fall“ verwandt.8 Wenn wir jemandem in diesem Sinne Verantwortung zurechnen, so behaupten wir, dass ein bestimmter empirischer Sachverhalt besteht. Dies ist etwa der Fall, wenn eine Sachverständige vor Gericht erklärt, dass die Angeklagte für ihre Tat verantwortlich sei, und damit meint, dass sie über gewisse psychische und physische Anlagen verfüge, die für ihre Zurechnungsfähigkeit notwendig sind. Ebenso rechnen wir Verantwortung im deskriptiven Sinne zu, wenn wir z.B. sagen, eine Ministerin sei verantwortlich für die Umwelt, und damit meinen, sie sei in der Regierung ihres Landes für das Ressort Umwelt zuständig. Diese Art des Zurechnens von Verantwortung liegt nicht zuletzt dann vor, wenn jemandes Handeln als Ursache eines Ereignisses und die Person damit als dessen Verursacherin identifiziert wird. Wenn es z.B. heißt, Kaiser Nero sei für den Brand von Rom im Jahre 64 n. Chr. verantwortlich, so ist damit demzufolge möglicherweise nicht mehr gemeint, als dass Nero jenen Brand der Stadt Rom verursacht (bzw. veranlasst) hat.
Wer jemanden für den Brand einer Stadt verantwortlich macht, kann auch mehr meinen als die bloße Feststellung eines Kausalzusammenhangs – und viele Leute dürften eine derartige Äußerung tatsächlich normativ verstehen. Mit der Feststellung des Kausalzusammenhangs sind noch nicht unbedingt moralische oder rechtliche Forderungen verknüpft,9 obwohl die Feststellung eines solchen Kausalzusammenhangs umgekehrt oft notwendig ist, damit es gerechtfertigt ist, in normativem Sinne von Verantwortung zu sprechen. Andererseits ist es noch nicht einmal gerechtfertigt, deskriptiv von Verantwortung in diesem kausalen Sinne zu sprechen, sofern nicht bestimmte Bedingungen erfüllt sind; so erfolgt die kausale Zurechnung im Recht ebenso wie in der Moral gewöhnlich kontrafaktisch nach der Regel, dass es nur dann gerechtfertigt ist, jemanden als Verursacherin eines bestimmten Sachverhalts anzusehen (und ihr mithin die kausale Verantwortung dafür zuzurechnen), wenn mit guten Gründen anzunehmen ist, dass dieser Sachverhalt nicht eintritt (bzw. nicht eingetreten wäre), sofern sie nicht eine bestimmte Handlung vollzieht (bzw. vollzogen hätte).10
Das Zurechnen von Verantwortung im normativen Sinne setzt ebenfalls gewisse Bedingungen voraus. Insbesondere ist es notwendig, dass es gerechtfertigt ist, der betreffenden Person auch in deskriptivem Sinne Verantwortung zuzurechnen. Zurechnungen im normativen Sinne schließen also stets Zurechnungen im deskriptiven Sinne ein (aber nicht umgekehrt). Wenn etwa im normativen Sinne gesagt wird, dass Eltern für ihre Kinder verantwortlich sind, so ist damit oft gemeint, dass Eltern gegenüber ihren Kindern zu bestimmten Handlungen verpflichtet sind, eben weil sie die Eltern der betroffenen Wesen sind; dies schließt nicht nur ein, dass sie fähig sind, diese Wesen zu schaffen und für sie zu sorgen sowie gegebenenfalls für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen zu werden, sondern auch, dass sie faktisch die Ursache für die Existenz der Kinder sind und dass sie für deren Wohlergehen zuständig sind, solange diese nicht im umfassenden Sinne selbst dafür sorgen können. Wenn jemandem im normativen Sinne Verantwortung zugerechnet wird, so wird mithin (unter der Voraussetzung, dass gewisse andere Bedingungen erfüllt sind, vor allem die Bedingungen für das Zurechnen von Verantwortung im deskriptiven Sinne) die Gültigkeit einer an sie gerichteten Norm behauptet. Die allgemeine Form von normativen Zurechnungen lautet dabei (wiederum in Anlehnung an Kelsen): „Wenn A der Fall ist (d.h., wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind), dann ist gesollt, dass B.“
Das Zurechnen von Verantwortung gehört folglich (ebenso wie das Versprechen) zu jenen Sprechakten, die aufgrund der in einer Sprachgemeinschaft vorausgesetzten Regeln Verpflichtungen zur Folge haben.11 So können etwa Versprechen insofern nicht beliebig gegeben werden, als es von mehreren Bedingungen abhängt, ob sie auch gültig sind.12 Dabei ist Folgendes entscheidend: Wenn alle für die Gültigkeit eines Versprechens notwendigen Bedingungen erfüllt sind, dann ist es nicht nur gerechtfertigt, einen Satz als Versprechen aufzufassen, sondern dann verpflichtet sich jemand durch das Äußern eines Versprechens auch zu etwas, d.h., dann ist es (auch für andere Menschen) gerechtfertigt zu sagen, dass die Person, die etwas verspricht, das Versprochene tun soll.13 Vorausgesetzt, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind, ist es also allgemein gerechtfertigt, die Gültigkeit einer Norm zu behaupten und von ihren Adressatinnen deren Einhaltung zu fordern.
Wenn wir von jemandes Verantwortung sprechen, geht es letztlich um Verantwortung im normativen Sinne, doch ist es unseren Überlegungen zufolge dabei auch notwendig, das Bestehen bestimmter empirischer Sachverhalte festzustellen, die jemandem im deskriptiven Sinne zuzurechnen sind. Genauer gesagt ist es nur dann gerechtfertigt, einem Subjekt x Verantwortung normativ zuzurechnen, wenn zumindest folgende Bedingungen erfüllt sind:
(i) Zurechnungsfähigkeit. Demnach ist es nur dann gerechtfertigt, einem Subjekt x Verantwortung zuzurechnen, wenn x subjektiv über die Voraussetzungen verfügt, das zu tun und zu verstehen, wovon sich die Frage stellt, ob es x objektiv zuzurechnen ist. Jemand mag z.B. durch eine Handlung Unheil anrichten; wenn Grund zur Annahme besteht, dass sie wegen mangelnder psychischer Voraussetzungen ihr Handeln und dessen Konsequenzen ebenso wenig verstehen konnte wie die Normen, die dabei ins Spiel kommen, dann ist es jedoch nicht gerechtfertigt, sie im normativen Sinne dafür verantwortlich zu machen, da es witzlos ist, an sie irgendwelche moralischen Ansprüche zu richten.
(ii) Handlungsfreiheit. In diesem Sinne ist es nur dann gerechtfertigt, einem Subjekt x die Verantwortung für einen Sachverhalt p zuzurechnen, wenn es für x prinzipiell möglich ist, den Sachverhalt p mit einer Handlung h kausal zu beeinflussen, also zwischen mindestens zwei Handlungsaltemativen (und zwar zumindest dem Vollziehen oder Unterlassen einer Handlung h) zu wählen, sodass p dadurch kausal beeinflusst wird. In diesem Sinne meinte bereits Aristoteles, jemand sei für eine Handlung nur dann zu tadeln (bzw. verantwortlich zu machen), wenn diese Handlung freiwillig ist. Für unfreiwillig vollzogene Handlungen gebührt uns Vergebung und manchmal sogar Mitleid.14
(iii) Kausalität: Dieser Bedingung zufolge ist es nur dann gerechtfertigt, einem Subjekt x die Verantwortung für einen Sachverhalt p zuzurechnen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass x den Sachverhalt p nicht nur durch eine Handlung h kausal beeinflussen kann, sondern dass p tatsächlich kausal von einer Handlung h von x abhängt. Jemand mag z.B. die Absicht haben, einen anderen Menschen zu töten, dazu prinzipiell in der Lage sein und auch alles tun, was in ihrer Macht steht, um den Tod dieses Menschen herbeizuführen, de facto allerdings ohne „Erfolg“. Wenn nun dessen Tod ohne das Zutun der betreffenden Person eintritt, dann ist diese nicht dafür verantwortlich, was auch immer sie tun wollte und konnte.15
(iv) Betroffensein: Es ist zudem nur dann gerechtfertigt, einem Subjekt x die Verantwortung für einen Sachverhalt p zuzurechnen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass der Sachverhalt p nicht nur kausal von einer Handlung h von x abhängt, sondern dass von p auch mindestens ein Wesen y betroffen ist (das nicht mit x identisch ist). Einen Sachverhalt zu verursachen, heißt noch nicht, dass auch jemand davon betroffen ist. Nehmen wir z.B. an, eine Wanderin schlage mit dem Stock auf Steine, sodass diese herumpurzeln; wenn das alles ist, so stellt sich nicht die Frage nach der Verantwortung jener Frau – wohl aber, wenn es sich um ein „Steinmännchen“ handelte, das den Wanderinnen als Wegzeichen diente, vor allem aber, wenn andere Leute von einem Stein oder vom Stock getroffen werden. In solchen Fällen ist jemand vom bewirkten Sachverhalt betroffen.
(v) Normative Relevanz. Schließlich ist es nur dann gerechtfertigt, einem Subjekt x die Verantwortung für einen Sachverhalt p zuzurechnen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass davon ein Wesen p nicht nur schlichtweg betroffen ist, sondern dass das Betroffensein von y durch eine Norm n als etwas bewertet wird, das x zu berücksichtigen hat, wenn x mit einer Handlung h kausal auf den Sachverhalt p einwirkt. Nicht jede Art von Betroffensein bringt Verantwortung ins Spiel. Es ist z.B. etwas anderes, ob jemand durch mein Verhalten in ihrer Bequemlichkeit eingeschränkt ist oder ob dadurch ihr Leben gefährdet wird. Die durch einen Sachverhalt betroffenen Interessen sind also in Bezug auf ihre Relevanz zu bewerten. Dies ist jedoch eine Angelegenheit des Normensystems, das wir beim Zurechnen von Verantwortung voraussetzen. Wenn wir nach moralischer Verantwortung fragen, müssen wir also offenlegen, auf welche Moralprinzipien wir uns stützen.16
Die Antwort auf die Frage, was unter moralischer Verantwortung zu verstehen ist, hängt davon ab, wie wir den Ausdruck „Moral“ verwenden. Im deskriptiven Sinne ist der Spielraum der Antworten nahezu unbegrenzt: So mag etwa jemand sagen, eine Handlung sei für sie moralisch richtig, wenn diese ihren Profit maximiert oder ihr Lust bereitet, während eine andere Person die moralische Qualität einer Handlung darin erblicken kann, dass sie gewisse schöne Gegebenheiten schafft, dass sie dem Willen Gottes dient oder was auch immer. Sofern wir gemäß einer von uns de facto jeweils vorausgesetzten Norm handeln, ist unser Tun so gesehen „moralisch richtig“. Wenn wir z.B. ausschließlich unseren Vorteil maximieren, so handeln wir in diesem deskriptiven Sinn mit Bezug auf die von uns vorausgesetzten Normen ebenso „moralisch richtig“, wie wenn wir nur an das Wohlergehen anderer denken, wenn es uns um die strikte Befolgung von Gottes Willen geht usw. Der einzige Unterschied besteht darin, dass unser Handeln jeweils durch eine andere „Moral“ bestimmt ist.
Wenn in diesem Sinne von „Moral“ die Rede ist, so geht es (etymologisch gesehen korrekt) um die von Menschen de facto gepflegten Sitten. Auch die philosophische Ethik geht von einer Beschreibung dieser Sitten aus – freilich ohne sich damit zu begnügen, denn in diesem Sinne kann prinzipiell jede Verhaltensregel als „Moral“ gelten, ist Moral also nicht von anderen normativen Grundlagen des Handelns zu unterscheiden. Wenn uns daran liegt, bestimmte Verhaltensformen als Moral im normativen Sinne der Sittlichkeit von anderen Verhaltensformen abgrenzen zu können, müssen wir gewisse Minimalbedingungen voraussetzen, etwa die von Richard Hare eingeführten Bedingungen der Präskriptivität und der Universalisierbarkeit von Normen, durch die im Wesentlichen Folgendes verlangt wird:17
(i) Eine Norm n ist präskriptiv genau dann, wenn eine Person x dadurch, dass x die Norm n anerkennt, auf bestimmte Handlungen festgelegt wird, die n vorschreibt.
(ii) Eine Norm n ist universalisierbar genau dann, wenn gilt: Wenn zufolge der Norm n ein Gegenstand x (ein Lebewesen, eine Handlung, ein Sachverhalt usw.) einen bestimmten moralischen Status hat, so haben n zufolge alle Gegenstände, die x in relevanter Hinsicht gleich sind, denselben moralischen Status.
Würde die Ethik diese Bedingungen nicht voraussetzen, so hätte dies gravierende Folgen: Würden wir etwa auf die Bedingung der Präskriptivität verzichten, so ließen wir die Möglichkeit zu, dass jemand beliebig handelt, dabei aber zugleich beanspruchen darf, eine bestimmte moralische Norm zu befolgen. Ohne die Bedingung der Universalisierbarkeit bestände hingegen die Möglichkeit, dass identische Fälle moralisch gegensätzlich beurteilt werden, dass ich also z.B. für mich selbst in bestimmter Hinsicht ein Recht in Anspruch nehme, das ich zugleich anderen abspreche, obwohl alle relevanten Umstände gleich sind. Wenn Moral im Sinne der Sittlichkeit jene beiden Bedingungen voraussetzt, so werden wir dadurch zunächst „bloß“ zu konsequentem Handeln verpflichtet; im Sinne der Sittlichkeit geht es also darum, Gleiches gleich zu behandeln.
Ein solcher Begriff von Moral wirkt sich auf das Verständnis der erwähnten Zurechnungsbedingungen aus. So schließt etwa moralische Zurechnungsfähigkeit das Vermögen ein, den präskriptiven und universalen Anspruch moralischer Normen zu verstehen, d.h. einerseits zu verstehen, dass das Anerkennen einer moralischen Norm zu Handlungen verpflichtet, die dadurch vorgeschrieben sind, und andererseits, dass etwa eine moralische Norm, der zufolge eine bestimmte Handlung moralisch richtig bzw. falsch ist, gleichzeitig alle Handlungen als moralisch richtig bzw. falsch auszeichnet, die der betreffenden Handlung in relevanter Hinsicht gleich sind, und dass die Interessen aller Wesen, die einander in relevanter Hinsicht gleich sind, beim Handeln in gleicher Weise zu berücksichtigen sind.18
Dieses Merkmal der Zurechnungsfähigkeit moralischer Subjekte ist zugleich objektives Element der Zurechnung moralischer Verantwortung (also dessen, was jemandem als Gegenstand ihrer moralischen Verantwortung zugerechnet werden kann, sofern sie zurechnungsfähig ist). Für die Zurechnung moralischer Verantwortung gilt folglich das etwa von Peter Singer propagierte „Prinzip der gleichen Behandlung gleicher Interessen“19, das genau genommen lediglich eine Anwendung von Hares Bedingung der Universalisierbarkeit moralischer Normen ist. Entscheidend ist dabei die Klausel, dass welche Wesen auch immer gleich zu behandeln sind, sofern sie einander in relevanter Hinsicht gleich sind. Es geht also etwa nicht an, dass das Verbot, anderen mutwillig Schmerzen zuzufügen, mit der Begründung auf Menschen eingeschränkt wird, dass nur diese über Vernunft verfügen; das in dieser Hinsicht relevante Merkmal ist vielmehr das Vermögen, Schmerzen zu empfinden. Wenn gute Gründe dafür sprechen, dass mir aufgrund meiner Empfindungsfähigkeit nicht mutwillig Schmerzen zugefügt werden dürfen, dann gilt dies aus denselben Gründen für alle Wesen, die in der Lage sind, ähnlich wie ich Schmerzen zu empfinden.
Das Prinzip der gleichen Interessenabwägung ist zwar fundamental für Moral im Sinne der Sittlichkeit, doch reicht es nicht aus, um in konkreten Situationen zu beurteilen, welche Handlungen aus Sicht einer so verstandenen Moral richtig sind, allein schon deshalb, weil von einer Handlung gewöhnlich mehrere Wesen betroffen sind, deren Interessen nicht nur wegen ihrer Verschiedenartigkeit miteinander kollidieren können, sondern auch wegen ihrer Gleichheit. Vielmehr sind weitere Moralprinzipien heranzuziehen, um die von einer Handlung betroffenen Interessen ebenso abzuwägen wie die Schwere und das Ausmaß von Konsequenzen. Folgende Prinzipien kommen beispielsweise in Betracht:
(i) Prinzip der Priorität primärer gegenüber sekundären Interessen: Unter der (idealisierten) Voraussetzung, dass es möglich ist, Interessen auf einer Skala von den für das Leben eines Individuums fundamentalsten bis zu den allernebensächlichsten zu ordnen, können wir sagen, dass ein relativ zu dieser Skala fundamentaleres Interesse höher zu gewichten ist als ein weniger fundamentales Interesse.
(ii) Prinzip der Priorität des Gemeinwohls vor dem Individualwohl: Wenn die zu gewichtenden Interessen einander gleich oder ähnlich sind, dabei aber die Interessen einer größeren mit denen einer kleineren Gruppe kollidieren, so genießen die Interessen der größeren Gruppe Vorrang. Andererseits ist eine solche Quantität von Interessen deren Qualität nachzuordnen, denn sonst wäre es etwa moralisch gerechtfertigt, beliebige Interessen einer Mehrheit stets gegenüber den Interessen einer Minderheit zu bevorzugen, also selbst dann, wenn diese fundamentaler (bzw. primärer) Natur sind, jene aber nicht.
(iii) Prinzip des angemessenen Abwägens von Konsequenzen: Jede der Alternativen, zwischen denen wir wählen können, hat eine Reihe von beabsichtigten sowie von unbeabsichtigten, aber vorhersehbaren Konsequenzen für die davon betroffenen Wesen. Die verschiedenen Konsequenzen, die eine Handlungsaltemative hat, sind nicht nur gegeneinander abzuwägen bzw. hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Interessen aller Betroffenen zu gewichten, sondern auch mit der Summe der Konsequenzen der verfügbaren Alternativen zu vergleichen. Im Sinne eines Moralsystems, das (wie dies oft der Fall ist) eine teleologische Komponente enthält, ist die von jemandem gewählte Handlungsaltemative dabei nur dann richtig, wenn ihre vorhersehbaren Konsequenzen insgesamt zumindest gleich gut sind wie die der verfügbaren Alternativen.20 Eine Handlung kann so gesehen insgesamt auch schlechte Konsequenzen haben; wenn ich von den verfügbaren Alternativen eine wähle, deren vorhersehbare Konsequenzen zumindest gleich gut sind wie die der anderen Alternativen, so ist mir dennoch kein Vorwurf zu machen, denn die anderen Alternativen hätten keine besseren, vielleicht aber noch schlechtere Konsequenzen für die Betroffenen.
(iv) Unschuldsprinzip: Unser Tun gilt als moralisch richtig, solange nicht erwiesen ist, dass die Summe der vorhersehbaren Konsequenzen einer Handlung schlechter ist als die der verfügbaren Handlungsalternativen. Würden wir auf dieses Prinzip verzichten, so hätte dies allzu gravierende Konsequenzen, d.h., wir würden alle als schuldig gelten, solange wir nicht von jeder Handlung nachweisen könnten, dass ihre Konsequenzen zumindest gleich gut sind wie die der verfügbaren Handlungsaltemativen – ein Unterfangen, das einen unendlichen Aufwand erforderte. Andererseits ist das Unschuldsprinzip nur dann problemlos anwendbar, wenn hinreichend bekannt ist, welche Konsequenzen verschiedene Handlungsalternativen jeweils haben. Oft ist jedoch anzunehmen, dass bestimmte Handlungen wahrscheinlich gravierende, irreversible Folgen haben, ohne dass wir diese Folgen im Voraus angeben können. Wenn wir unter dieser Voraussetzung strikt am Unschuldsprinzip festhalten, sind viele Handlungen als moralisch erlaubt anzusehen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gravierender, irreversibler Folgen dabei relativ hoch ist, d.h., wir können niemandem eine moralische Pflicht zur Unterlassung einer Handlung zurechnen, von der wir nicht nahezu mit Gewissheit sagen können, welche Konsequenzen sie hat. In solchen Fällen liegt es nahe, dem Unschuldsprinzip ein Vorsichtsprinzip überzuordnen, wie es etwa Dagfinn Føllesdal vorgeschlagen hat und das besagt: Wenn wir keine sehr guten Gründe für die Annahme haben, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte Handlung negative Konsequenzen nach sich ziehen wird, sehr niedrig ist, so sollten wir diese Handlung unterlassen.21