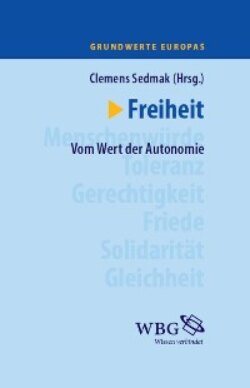Читать книгу Freiheit - Группа авторов - Страница 11
Freiheit für moralische Verantwortung
ОглавлениеDie erwähnten notwendigen Bedingungen für das Zurechnen moralischer Verantwortung sind in ihrer Kürze recht vage formuliert. Dies gilt auch für die Bedingung der Handlungsfreiheit. Um zu bestimmen, in welchem Sinne Freiheit eine notwendige Voraussetzung für moralische Verantwortung ist, müssen wir diese Bedingung also etwas klarer und deutlicher darstellen. Allgemein können wir sie als Aspekt dessen auffassen, was seit George Edward Moore als Sollen-Können-Bedingung bezeichnet wird. Demnach setzt jede (sinnvolle bzw. gerechtfertigte) Norm notwendigerweise voraus, dass diejenigen Wesen, an die sich die fragliche Norm richtet, prinzipiell in der Lage sind zu verstehen, was zu tun dadurch geboten ist, und die gebotenen Handlungen auch auszuführen. Nach Moores Ansicht spricht für die Annahme dieser Bedingung, „daß wir mit eines Menschen Pflicht nur die beste derjenigen Handlungen meinen, an die er gedacht haben könnte. Und es ist wahr, daß wir niemanden allzusehr für die Unterlassung einer Handlung tadeln, an die zu denken man ihm, wie wir sagen, nicht zumuten konnte“22.
Zwar mag der Punkt, um den es Moore geht, von ihm selbst nicht ganz glücklich formuliert sein, doch lässt er sich relativ einfach wie folgt wiedergeben: Damit es gerechtfertigt ist, eine Norm an jemanden zu richten, muss diese Person prinzipiell in der Lage sein, die Norm zu verstehen und zu erfüllen. Jemand könnte z.B. von mir verlangen, dass ich die Krümpflinge so schlumsig wie möglich brambalisieren soll oder dass ich ein Gewicht von zwei Tonnen allein mit meinen Händen heben soll. Sofern die betreffende Person vernünftig ist, wird sie dies jedoch nicht (bzw. zumindest nicht ernsthaft) tun, denn im ersten Fall bin ich unfähig zu verstehen, was sie von mir verlangt,23 im zweiten hingegen verstehe ich zwar, was gemeint ist (d.h., ich verstehe, dass mir durch eine Norm etwas vorgeschrieben wird und was zu tun dadurch von mir verlangt wird), doch besteht Grund zur Annahme, dass ich prinzipiell leider nicht in der Lage bin, das zu tun, was mir durch die Norm vorgeschrieben wird, also ein Gewicht von zwei Tonnen allein mit meinen Händen zu heben.
Der Sollen-Können-Bedingung zufolge ist es mithin nur dann sinnvoll, den Ausdruck „verantwortlich“ normativ zu verwenden, wenn es prinzipiell möglich ist, eine Norm an jenes Wesen zu richten, von dem es heißt, es sei für etwas verantwortlich. In diesem Sinne ist es sinnlos, von Steinen, Stürmen, Straßen oder anderen beliebigen Wesen zu sagen, dass sie im normativen Sinn für etwas verantwortlich sind, da sie nicht als Adressaten von Normen infrage kommen; sie können diese nämlich weder verstehen noch erfüllen. Da es nur dann sinnvoll ist, von einem Wesen im normativen Sinn zu sagen, es sei für etwas verantwortlich, wenn es prinzipiell möglich ist, eine Norm an dieses Wesen zu richten (und etwa zu sagen, dass es etwas tun soll, weil Grund zur Annahme besteht, dass es die fragliche Norm auch verstehen und erfüllen kann), ist es auch nur unter dieser Voraussetzung gerechtfertigt, das zu tun. Es ist nämlich schwer vorzustellen, wie ein (normativer) Sprachgebrauch zu rechtfertigen ist, von dem wir wissen, dass er sinnlos ist.
Der normative Gebrauch des Ausdrucks „verantwortlich“ wird durch die Sollen-Können-Bedingung genau genommen in zweierlei Hinsicht begrenzt:
(i) Dieser Bedingung zufolge ist es für jede (sinnvolle bzw. gerechtfertigte) Norm notwendig, dass sie grundsätzlich erfüllbar ist, d.h., es sollte zumindest für manche Wesen möglich sein, die fragliche Norm zu befolgen. Natürlich können wir nie ausschließen, dass jemand eine Norm aufstellt, die weit jenseits aller Erfüllbarkeit ist, und z.B. verlangt, dass alle Menschen auf der Stelle zu atmen aufhören; eine solche Norm kann jedoch von niemandem befolgt werden, zumindest insofern, als alle möglichen Adressatinnen der Norm nach kürzester Zeit stürben.24 So gesehen ist eine Norm also nicht gerechtfertigt, wenn es für jegliches Wesen, an das sie sich überhaupt richten kann, prinzipiell unmöglich ist, sie zu befolgen.
(ii) Andererseits ist es der Sollen-Können-Bedingung zufolge für jede (sinnvolle bzw. gerechtfertigte) Norm notwendig, dass sie nicht von jedem beliebigen Wesen erfüllt werden kann. Das bedeutet nichts anderes, als dass (sinnvolle bzw. gerechtfertigte) Normen nicht trivial sind; was sie verlangen, ist nicht etwas, das in jedem Fall von jedem beliebigen Wesen erfüllt werden kann.25 Die Annahme, dass durch Normen etwas Relevantes bzw. Bedeutsames verlangt wird, impliziert andererseits aber, dass die Adressatinnen der Norm mit gewissen Fähigkeiten ausgestattet sind und dass ihnen Möglichkeiten offen stehen, um die durch eine solche Norm gestellten Anforderungen zu erfüllen.
Die Fähigkeiten, über die jemand verfügen muss, damit es gerechtfertigt ist, ihr moralische Verantwortung im normativen Sinne zuzurechnen, lassen sich (wie angedeutet) im Wesentlichen darauf reduzieren, dass sie kognitiv in der Lage ist, all das zu verstehen, wovon sich die Frage stellt, ob sie dafür verantwortlich gemacht werden soll, und dass sie es prinzipiell in die Tat umsetzen kann. Sofern es sich um moralische Verantwortung handelt, ist insbesondere vorauszusetzen, dass jemand fähig ist zu verstehen, was zu tun moralisch richtig ist, und dementsprechend zu handeln. Nun kann aber der Fall eintreten, dass jemand zwar fähig ist zu verstehen, was zu tun moralisch richtig ist, dass es ihr aber dennoch nicht möglich ist, in diesem Sinne (frei) zu handeln, und zwar etwa aus folgenden Gründen:
(i) Jemand kann aufgrund eines inneren Zwangs (wie z.B. einer Neurose) gar nicht anders, als in gewissen Situationen eine bestimmte Handlung zu vollziehen, unabhängig davon, welche Alternativen objektiv zur Verfügung stehen und für sie subjektiv einsichtig sind. Der Sollen-Können-Bedingung zufolge ist es in solchen Fällen nicht gerechtfertigt, jemandem normativ die Verantwortung für eine Handlung und einen dadurch verursachten Sachverhalt zuzurechnen. Auf den ersten Blick scheint dabei die Bedingung der Zurechnungsfähigkeit nicht erfüllt zu sein, da jemand anscheinend unfähig ist, selbständig zwischen verschiedenen Handlungsaltemativen zu entscheiden. Die „Unfähigkeit“ ist in einem solchen Fall jedoch eine andere als bei Abwesenheit der für Zurechnungsfähigkeit notwendigen Anlagen: Jemandem fehlt nicht die Fähigkeit, Handlungsalternativen zu erkennen bzw. zu verstehen und zwischen ihnen abzuwägen;26 vielmehr ist es ihr unmöglich, etwas, das sie sehr wohl als richtig erkennen kann, in die Tat umzusetzen, und zwar deshalb, weil sie innerlich gezwungen ist, eine bestimmte Handlung zu vollziehen. Ein solcher Mangel ist etwas anderes als das Fehlen einer kognitiven Fähigkeit; vielmehr fehlt jemandem die Handlungsfreiheit, d.h., einer solchen Person ist es wegen einer Erkrankung unmöglich, eine Situation durch Wahl einer Handlungsalternative kausal zu beeinflussen.
(ii) Jemand kann aufgrund eines äußeren Zwangs (wie z.B. dadurch, dass ihr Leben oder das Leben eines ihr sehr nahe stehenden Wesens bedroht wird) nicht anders, als in einer gegebenen Situation so zu handeln, wie es von jemand anderem verlangt wird. In diesem Fall wäre jemand subjektiv nicht nur fähig, zwischen verschiedenen Handlungsalternativen zu entscheiden, sondern auch, eine als richtig erkannte Alternative zu verwirklichen; sie hat jedoch keine Wahl, diese Handlung zu vollziehen, da sie von einer anderen Person physisch oder psychisch gezwungen wird, eine andere Handlung zu vollziehen.27 Insofern, als der Zwang, der jemanden daran hindert, zwischen verschiedenen Handlungsalternativen zu wählen, von einer anderen Person ausgeht, handelt es sich in diesem anders als im zuvor geschilderten Fall um ein objektiv bestehendes Hindernis für jemandes Handlungsfreiheit und somit für das Zurechnen von moralischer Verantwortung im normativen Sinne.
(iii) Jemand ist zwar prinzipiell in der Lage, die verfügbaren Handlungsalternativen zu erkennen, selbständig zwischen ihnen zu entscheiden und eine Handlung zu vollziehen, die sie aus guten Gründen als moralisch richtig erkennt, doch liegen objektiv keine Handlungsalternativen vor, zwischen denen sie wählen könnte, um einen Sachverhalt zu beeinflussen, d.h., entweder sind überhaupt keine Handlungsalternativen verfügbar, zwischen denen sie wählen könnte, um durch eine davon den fraglichen Sachverhalt kausal zu beeinflussen, oder keine der verfügbaren Alternativen eröffnet ihr die Möglichkeit, kausal auf jenen Sachverhalt so einzuwirken, dass sie ihr Ziel erreicht (bzw. moralisch richtig handelt). Nehmen wir beispielsweise an, ein Flugzeug sei in ein Hochhaus gerast, doch bestehe Grund zur Annahme, dass die Pilotin diesen Vorgang in keiner Weise beeinflussen konnte (z.B. weil die Steuerinstrumente trotz aller Vorsorge ausgefallen waren). Zwar ist denkbar, dass selbst unter dieser Voraussetzung jemand in normativem Sinne sagt, die Pilotin sei dafür verantwortlich, dass das Flugzeug in das Hochhaus gerast ist, doch ist eine solche Zurechnung nicht gerechtfertigt, da die Pilotin keine Wahl hatte: Sie hatte keine Möglichkeit, das Ereignis durch irgendwelche Handlungen kausal zu beeinflussen. Selbst wenn die Pilotin noch so verzweifelt mit den Steuerinstrumenten hantiert hätte, war sie doch machtlos; darum trifft sie keine Schuld, sondern sie verdient ebenso Mitleid wie die anderen Opfer des Unglücks.28 In solch tragischen Fällen „nimmt das Schicksal seinen Lauf – unabhängig davon, was jemand „tut“ bzw. zu tun in der Lage wäre.
Wie diese Beispiele zeigen (sollen), ist es nur dann gerechtfertigt, jemandem im normativen Sinne die moralische Verantwortung für einen Sachverhalt29 zuzurechnen, wenn Grund zur Annahme besteht, dass sie diesen kausal beeinflussen kann, und zwar in dem Sinne, dass ihr objektiv eine Reihe von Handlungsaltemativen zur Verfügung steht, zwischen denen sie frei (d.h. ohne inneren oder äußeren Zwang) wählen kann, wobei mindestens eine Alternative die Möglichkeit eröffnet, die Situation auf eine Weise zu beeinflussen, die mit Bezug auf moralische Normen als richtig anzusehen ist. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, dann ist es nicht gerechtfertigt, jemandes Handeln normativ zu beurteilen, denn sie übt letztlich keinen Einfluss auf das Ereignis aus, sondern ist vielmehr in dieses verwickelt (und insofern mitunter bemitleidenswert).
Wenn jemand nicht über die Möglichkeit verfügt, aus mehreren zur Verfügung stehenden Alternativen eine bestimmte Handlung zu wählen und so einen Sachverhalt kausal zu beeinflussen, dann ist es genau genommen noch nicht einmal gerechtfertigt, davon zu sprechen, dass sie handelt, denn der Begriff der Handlung setzt voraus, dass jemand nicht nur bestimmte Körperbewegungen vollzieht, sondern dass sie eben diese Bewegungen auch beabsichtigt bzw. vollziehen will. Selbst die besten (oder auch die schlimmsten) Absichten sind indes witzlos, wenn sie nicht in jene Bewegungen umgesetzt werden können und wenn nicht durch deren Vollzug ein Sachverhalt, der nicht jemandes Vorstellungen entspricht, in einen anderen Sachverhalt überführt werden kann, der diesen Vorstellungen entspricht. Wir können aber nur dann sagen, dass jemand durch den Vollzug einer Handlung einen Sachverhalt schafft bzw. einen bestehenden Sachverhalt beeinflusst, wenn sie die Wahl hat, die als Handlung zu verstehenden Bewegungen zu vollziehen oder nicht. Wenn jemand keine Wahl hat, wenn ihr also keine Alternativen offenstehen (bzw. zumindest keine Alternativen, durch die sie einen Sachverhalt kausal beeinflussen könnte – insbesondere so, wie es für sie mit Bezug auf moralische Normen als richtig zu erkennen ist), dann ist es nicht gerechtfertigt zu sagen, dass die fragliche Person handelt, und zwar selbst dann, wenn sie noch so viele Bewegungen ausführt; vielmehr nimmt ein Ereignis seinen Lauf, was auch immer sie „tut“.
Aus der Annahme, dass es nur dann gerechtfertigt ist, jemandem Verantwortung im normativen Sinne zuzurechnen, wenn sie über Handlungsfreiheit verfügt, folgt, dass sich die Frage moralischer (oder anderer) Verantwortung nicht stellt, sofern diese Bedingung nicht erfüllt ist. Diese Überlegung wird von Harry Frankfurt in Zweifel gezogen, der mit einer Reihe von Beispielen zu zeigen versucht, dass wir moralisch verantwortlich sind, selbst wenn uns keine Handlungsalternativen zur Verfügung stehen.30 Tatsächlich können wir nicht ausschließen, dass jemandem de facto Verantwortung zugerechnet wird, obwohl die Bedingung der Handlungsfreiheit nicht erfüllt ist. Damit ist jedoch noch nicht gesagt, dass in solchen Fällen das Zurechnen moralischer Verantwortung auch gerechtfertigt ist. Da sich Frankfurt bloß auf Situationen bezieht, in denen jemand eine Sanktion nicht in Kauf nehmen möchte, sich davon beeindrucken lässt oder von vornherein gleich gehandelt hätte, kann er die Plausibilität jener Bedingung aber ohnehin nicht widerlegen.
In den hier diskutierten Fällen führt der Mangel an Freiheit dazu, dass wir in gewissem Sinne „frei“ von Verantwortung sind – freilich auf eine Weise, die kaum jemandem als erstrebenswert erscheinen dürfte. Wenn das Zurechnen von Verantwortung im normativen Sinne an die Bedingung der Handlungsfreiheit geknüpft ist, so hat deren Erfüllung also normative Konsequenzen, denen wir uns umgekehrt nur dann nicht stellen müssen, wenn wir in diesem Sinne nicht frei sind. Nach Ansicht mancher Neurobiologinnen ist freilich eben dies der Fall: Die Annahme, dass Menschen über Handlungsfreiheit verfügten, ist etwa laut Wolf Singer nicht gerechtfertigt; menschliches Handeln sei vielmehr als kausale Wirkung neuronaler Prozesse zu erklären, während die Annahme eines „bewussten Ich“, welches „das neuronale Substrat nur nutzt, um sich über die Welt zu informieren und seine Entscheidungen in Handlungen zu verwandeln, […] mit bekannten Naturgesetzen unvereinbar“31 sei.
Tatsächlich setzt all unser Erkennen und Tun ein sehr komplexes Gehirn voraus und beruht auch die Verantwortungsfähigkeit von Personen auf der komplexen Struktur bzw. Organisation des Zentralnervensystems solcher Wesen; daraus folgt indes noch nicht, dass die Annahme von Handlungsfreiheit mit dem „neuronalen Determinismus“ unvereinbar ist, und zwar allein schon deshalb, weil in den Texten von Wolf Singer und anderen die Begriffe der Kausalität und des Determinismus ebenso unklar bleiben wie ihr Verhältnis zueinander und zur Frage der Handlungsfreiheit. Wie bereits Moritz Schlick bemerkt hat, ist die Frage der Willensfreiheit „nur infolge grober Irrtümer, die seit Hume längst aufgeklärt sind, mit der Indeterminismusfrage verwechselt worden. Die sittliche Freiheit, welche der Begriff der Verantwortung voraussetzt, steht nicht im Gegensatz zur Kausalität, sondern wäre ohne sie sogar hinfällig.“32 Wenn dies zutrifft, so können wir ruhigen Gewissens weiter daran festhalten, dass Handlungsfreiheit notwendig ist, damit es gerechtfertigt ist, jemandem Verantwortung im normativen Sinne zuzurechnen, und dass Menschen im Allgemeinen auch tatsächlich zwischen Alternativen wählen können und dadurch – sofern ihnen daran liegt, moralisch zu handeln – vor der Aufgabe stehen, jene zu wählen, die moralisch richtig ist.