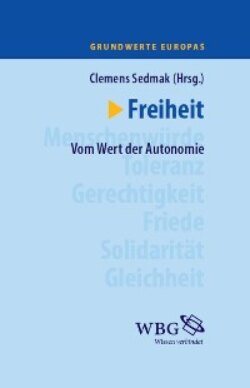Читать книгу Freiheit - Группа авторов - Страница 13
Freiheit durch moralische Verantwortung
ОглавлениеEs steht uns nicht nur frei, uns für moralisches Handeln zu entscheiden, sondern das Übernehmen moralischer Verantwortung bedeutet zudem in einem anderen Sinne Freiheit, nämlich insofern, als Verantwortung – so Eduard Spranger – in der „freiwilligen Übernahme von Aufgaben besteht, die kein Vorgesetzter gestellt hat und deren Erfüllung niemand überwacht“43. Wenn Spranger davon spricht, dass die Erfüllung der mit moralischer Verantwortung verbundenen Pflichten von niemandem überwacht werde, so meint er damit wohl nicht, dass jemand, die in diesem Sinne Verantwortung übernimmt, vor keiner moralischen Instanz verantwortlich wäre; als solche fungiert vielmehr ihr Gewissen.
Sofern die Rede von einem „Gewissen“ sinnvoll (und die Berufung darauf überprüfbar) sein soll, ist freilich mit Hans Lenk anzunehmen, dass es sich nicht um ein rein subjektives Gefühl handelt, sondern um
ein verinnerlichtes Konzept, ein im Zusammenhang mit der zugeschriebenen Verantwortlichkeit zugemutetes, akzeptiertes und entsprechend reflektiertes Konstrukt der Selbstdeutung, Selbstbeurteilung, Selbstmoralisierung. […] Als Konstrukt ist es kein Agens, kein handelnder Urheber: Nicht das Gewissen als kleiner Zensor in der Person, sondern die Person beurteilt ihre Handlungen und sich selbst unter dem verinnerlichten Gewissenskonzept.44
Der Ausdruck „Gewissen“ bezieht sich in diesem Sinne also auf ein rationales Konstrukt, auf ein wesentliches Element moralischer Autonomie, das aus der erwähnten Aufklärung darüber hervorgeht, was zu tun im Lichte der Vernunft richtig ist.
Derlei Überlegungen gehen letztlich auf Kant zurück, nach dessen Ansicht sich ja moralisches Handeln dadurch auszeichnet, dass wir erkennen, was zu tun moralisch richtig (und mithin Pflicht) ist, und eben diese Erkenntnis des moralisch Richtigen bzw. die erkannte Pflicht zur Triebfeder des Handelns machen.45 Ein solches pflichtgemäßes Handeln ist laut Kant nichts anderes als eine Art Selbstzwang nach einem Prinzip der inneren Freiheit. Von innerer Freiheit ist dabei insofern zu sprechen, als es für die Individuen darum geht einzusehen, was zu tun moralisch richtig ist, und aufgrund dieser Erkenntnis sich selbstständig zu entscheiden, dass sie so handeln, wie es moralisch richtig ist.
Wenn Kant davon schreibt, dass der Sinn moralischer und rechtlicher Prinzipien darin bestehe, die Freiheit jedes Menschen auf jene Bedingungen einzuschränken, unter denen sie mit der Freiheit jedes anderen Menschen nach einem allgemeinen Gesetz bestehen kann,46 so zeigt sich darin eine Mehrdeutigkeit des Ausdrucks „Freiheit“: Würde die Freiheit aller Menschen in nichts anderem bestehen, als dass sie nach einer Maxime handeln, die zugleich ein allgemeines Gesetz sein kann, so wäre es nicht notwendig, ihre Freiheit wechselseitig zu begrenzen, da ihr moralischer Wille letztlich ein gemeinsames Ziel hätte. Die Freiheit eines Individuums so zu begrenzen, dass sie mit der Freiheit aller anderen Individuen mit Bezug auf ein allgemeines Gesetz vereinbar ist, erscheint vielmehr nur dann erforderlich, wenn dabei auch eine gewisse Willkür zum Tragen kommt, also der Wunsch, eine Handlung im eigenen Interesse zu vollziehen, auch wenn sie sich zum Schaden anderer auswirkt.
Zwar ist in Kants Augen wichtig, dass ein friedliches Zusammenleben der Menschen, das er für ein Gebot der praktischen Vernunft hält,47 eine wechselseitige Begrenzung der Freiheit im Sinne von Willkür voraussetzt, doch geht es ihm in erster Linie um Freiheit in einem anderen Sinne, nämlich um jene „innere Freiheit“, die wir gewinnen, indem wir uns aus eigenen Stücken zu moralischem Handeln verpflichten:
Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der ihnen gemäßen Pflichten; alle Heteronomie der Willkür gründet dagegen nicht allein gar kein Verbindlichkeit, sondern ist vielmehr dem Prinzip derselben und der Sittlichkeit des Willens entgegen.48
Diese Autonomie der reinen praktischen Vernunft“ bezeichnet Kant als „Freiheit im positiven Verstande“, die von Freiheit im negativen Sinne zu unterscheiden ist, d.h. von der „bloßen“ Unabhängigkeit „von aller Materie des Gesetzes“49, zu der im Sinne von Kant wohl auch die früher erörterte Freiheit von moralischer Verantwortung gehört.
Durch Moralität „auf das Bewußtsein seiner Freiheit aufmerksam“ gemacht zu werden, bedeutet laut Kant nicht eitel Glück und Wonne, denn dazu gehört auch das Bewusstsein der selbst auferlegten Rücksichten und des Verzichts darauf, ursprüngliche Neigungen einfach auszuleben, wie es anderen, „bloß“ natürlichen Wesen möglich sein mag, die nicht über Vernunft verfügen. Obwohl „diese Entsagung eine anfängliche Empfindung von Schmerz erregt“, entzieht sie doch „jenen Lehrling dem Zwange selbst wahrer Bedürfnisse“ und kündigt
ihm zugleich eine Befreiung von der mannigfaltigen Unzufriedenheit, darin ihn all diese Bedürfnisse verflechten, an […]. Das Herz wird doch von einer Last, die es jederzeit insgeheim drückt, befreit und erleichtert, wenn an reinen moralischen Entschließungen […] dem Menschen ein inneres, ihm selbst sonst nicht einmal recht bekanntes Vermögen, die innere Freiheit, aufgedeckt wird, sich von der ungestümen Zudringlichkeit der Neigungen dermaßen loszumachen, daß gar keine, selbst die beliebteste nicht, auf eine Entschließung, zu der wir uns jetzt unserer Vernunft bedienen, Einfluß habe.50
Solche Formulierungen legen nahe, dass Kant unter „innerer Freiheit“ zunächst einmal eine der moralischen Verantwortung eigene Autonomie gegenüber unseren Trieben versteht. Damit nimmt Kant das von Sigmund Freud entwickelte Konzept der „kulturellen Sexualmoral“ voraus. Bekanntlich sah Freud ja die Sexualität als Triebkraft des menschlichen Lebens an. Weniger bekannt ist, dass Freud nicht so sehr von dem Sexualtrieb als von den Sexualtrieben sprach, denn die Sexualität setzt sich „aus vielen Komponenten, Partialtrieben, zusammen“. Durch die „Fähigkeit zur Sublimierung“, durch die wir bei manchen Partialtrieben „das ursprünglich sexuelle Ziel gegen ein anderes, nicht mehr sexuelles, aber psychisch mit ihm verwandtes, zu vertauschen“ vermögen, entsteht ein noch komplexeres Ganzes; zugleich stellt die Sexualität dadurch der Kultur „außerordentlich große Kraftmengen zur Verfügung“. Laut Freud ist indes für unsere psychophysische Entwicklung wichtig, die Partialtriebe in ein komplexes Triebsystem zu integrieren, dessen Elemente sie werden; wenn dies jemandem nicht gelingt, sodass sich Komponenten der Sexualität aus dem Ganzen lösen, so folgen daraus pathologische Verhaltensweisen. Es kommt zu einer „hartnäckigen Fixierung“ auf einen der Partialtriebe, durch die der Sexualtrieb als Ganzer „unverwertbar wird und gelegentlich zu den sogenannten Abnormitäten entartet“51.
Das Bemühen um die Integration der Partialtriebe zu einem Ganzen bedeutet letztlich nichts anderes als deren bewusste Kontrolle – und mithin die erwähnte Begrenzung unserer Willkür. Eine solche ist nicht nur im Sinne von Kant für das friedliche Zusammenleben der Menschen notwendig, sondern letztlich für alle Lebensbereiche. Wie etwa Bertolt Brecht mit Bezug auf Galileo Galilei bemerkt, ist auch der Forschungstrieb „nicht weniger lustvoll oder diktatorisch wie der Zeugungstrieb“52. Es kommt also darauf an, mit diesem Trieb ähnlich umzugehen wie mit anderen Trieben, d.h. ihn – wie Felix Hammer betont – einerseits nicht zu verdrängen, da Triebverdrängung krank mache, andererseits aber auch nicht blind walten zu lassen, damit er nicht zur Sucht entartet: „Bewußte Triebbeherrschung ist unerläßlich.“53 So gesehen beruht auch die wissenschaftliche Forschung nur dann auf der von Kant angesprochenen „inneren Freiheit“, wenn sie auf der Einsicht in das moralisch Richtige beruht. Dieser Hinweis ist nicht zuletzt deshalb erforderlich, weil die moralische Reflexion über die Ziele und Konsequenzen der Forschung mitunter als Behinderung wissenschaftlichen Fortschritts gesehen wird.54
Nicht nur in der Wissenschaft fällt es uns schwer, unsere ursprünglichen Begierden zu kontrollieren; vielmehr bereitet uns diese „Entsagung“ immer wieder „eine anfängliche Empfindung von Schmerz“. Dies hat wohl auch mit dem (durchaus erklärbaren) Wunsch zu tun, unsere Triebe unbeschränkt ausleben zu können. Dieser Wunsch ist jedoch nicht nur deshalb unerfüllbar, weil unsere Kräfte begrenzt und unsere Anlagen nicht in jeder Hinsicht miteinander vereinbar sind, sondern auch wegen des von Kant angesprochenen Interesses an einem friedlichen Zusammenleben.
Freiheit im Sinne schrankenloser Willkür stände uns nur dann zu Gebote, wenn sie uns von der Natur „geschenkt“ wäre. Da dem nicht so ist, können wir Freiheit letztlich nur gewinnen, indem wir uns von dieser „mannigfaltigen Unzufriedenheit“ befreien und uns bewusst für ein Leben auf Grundlage moralischer Autonomie entscheiden. Wir könnten nur dann mit Berufung auf unsere Triebbasis „die moralische Unschuld spielen“, wenn unser Verhalten ausschließlich durch Triebe gesteuert wäre und wir Grund zur Annahme hätten, dass wir in keiner Weise von Natur aus auch über Vernunft verfügten. Da dem nicht so ist, bedarf es jedoch der Anstrengung, durch Triebkontrolle Freiheit zu gewinnen.
Die positive Freiheit, die wir durch das Übernehmen von Verantwortung gewinnen, zeigt sich freilich nicht nur in der bewussten Kontrolle der unser Leben immer auch mitbestimmenden Triebe, sondern ebenso in der Unabhängigkeit von anderen „Autoritäten“, d.h. davon, was „die anderen“ gerne hätten. So gesehen ist die damit angesprochene negative Freiheit die Rückseite derselben Medaille, deren Vorderseite die positive Freiheit ist. Die „freiwillige Übernahme“ moralischer Verantwortung im normativen Sinne ist mithin aber auch Ausdruck philosophischer Reflexion; sie kann uns unabhängig davon, was „man“ für richtig hält, „viele Möglichkeiten zu bedenken geben, die unser Blickfeld erweitem und uns von der Tyrannei des Gewohnten befreien“ – und zwar durchaus unter Einschluss einer Möglichkeit, die Bertrand Russell allgemein als Merkmal des Philosophierens ansieht:
Die Philosophie kann uns zwar nicht mit Sicherheit sagen, wie die richtigen Antworten auf die gestellten Fragen heißen […]. Sie vermindert unsere Gewißheiten darüber, was die Dinge sind, aber sie vermehrt unser Wissen darüber, was die Dinge sein könnten.55
Die Überlegung, dass uns die Bereitschaft zur Übernahme moralischer Verantwortung insofern frei macht, als wir selbst über unser Handeln auf Grundlage unserer Vernunft entscheiden, wird nur akzeptieren, wer Freiheit im positiven Sinne der Autonomie versteht. Wer mit Freiheit die Erwartung verbindet, dass unserem Handeln keinerlei Schranken gesetzt sind, wird sich kaum damit anfreunden können. Allerdings steht uns Freiheit in diesem Sinne nicht zu Gebote – und so gesehen ist eine solche Erwartung nicht nur unvernünftig, sondern auch unverantwortlich.
1 Vgl. Kant, Immanuel, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“, in: Ders., Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik (Werke. Hrsg. von Wilhelm Weischedel, Bd. 6). Wiesbaden 1964, 51–61.
2 Vgl. Pico della Mirandola, Giovanni, Über die Würde des Menschen. Übers. von Norbert Baumgarten, hrsg. von August Buck. Hamburg 1990, 7.
3 Vgl. Kant, Immanuel, Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte, in: Ders., Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik (Werke. Hrsg. von Wilhelm Weischedel, Bd. 6). Wiesbaden 1964, 83–102, hier 90f. Weitere Sorgen, deren „alle Tiere enthoben sind“, ergeben sich laut Kant aus der „Erwartung des Künftigen“, die u.a. auch bedeutet, den Tod „mit Furcht voraus“ zu sehen.
4 Vgl. Fromm, Erich, Die Furcht vor der Freiheit. Übers. von Liselotte und Ernst Mickel, in: Ders., Analytische Sozialpsychologie (Werke. Hrsg. von Rainer Funk, Bd. 1). München 1989, 215–392, hier 221.
5 Im Sinne einer „positiven Diskriminierung“ verwende ich im vorliegenden Beitrag außer in Zitaten das weibliche grammatikalische Geschlecht, sofern sich ein Ausdruck sowohl auf weibliche als auch auf männliche Personen beziehen kann.
6 Zu einer tiefer gehenden Erörterung der hier behandelten Fragen in Zusammenhang mit moralischer Verantwortung vgl. Neumaier, Otto, Moralische Verantwortung. Beiträge zur Analyse eines ethischen Begriffs. Paderborn 2008.
7 Zur neueren Literatur über das Zurechnen von Verantwortung im moralischen und juristischen Sinne vgl. etwa Shaver, Kelly G., The Attribution of Blame. Causality, Responsibility, and Blameworthiness. New York/Berlin/Heidelberg/Tokyo 1985; Weinberger, Ota, Norm und Institution. Eine Einführung in die Theorie des Rechts. Wien 1988.
8 Vgl. dazu Kelsen, Hans, Vergeltung und Kausalität. Eine soziologische Untersuchung. Neudr. Wien/Köln/Graz 1982; ders., Kausalität und Zurechnung, in: Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht 6 (1954) 125–151.
9 Erst recht gilt dies in Fällen, in denen wir zwar sinnvoll sagen können, etwas sei in kausalem Sinne für etwas anderes verantwortlich (z.B. wenn es heißt, ein Wirbelsturm sei für Verwüstungen in Florida verantwortlich oder das Ozonloch sei für ein höheres Hautkrebsrisiko verantwortlich), während wir keinen Grund zur Annahme haben, dass das fragliche Wesen in normativem Sinne für etwas verantwortlich gemacht werden kann.
10 Der Ausdruck „Handlung“ bezieht sich dabei auch auf das Unterlassen einer Handlung, da wir eine Situation ja auch dadurch beeinflussen (können), dass wir nichts tun bzw. etwas, das wir tun könnten oder sollten, nicht tun. In diesem Sinne können wir dann auch sagen, dass eine bestimmte Situation nicht bestände, sofern jemand nicht eine bestimmte Handlung unterlassen (und auf diese Weise gehandelt) hätte.
11 Dass bestimmte soziale Akte darauf Zielen, von einem „Sein“ (der Feststellung empirischer Tatsachen) zu einem „Sollen“ (einem normativen Anspruch) überzugehen, betonte als erster Anton Reinach; vgl. Reinach, Anton, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, in: Ders., Sämtliche Werke. Textkrit. Ausg., hrsg. von Karl Schuhmann und Barry Smith. München 1989, 141–278.
12 Die für Versprechen notwendigen Bedingungen analysiert insbesondere John Searle; vgl. Searle, John R., Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay. Übers. von Renate und Rolf Wiggershaus. Frankfurt am Main 1971, 88–99.
13 Wenn jemand aufrichtig glaubt, ein Versprechen äußern zu können, ohne dass sie sich dadurch zu etwas verpflichtet, so hat sie die „Logik“ der normativen Sprache nicht verstanden, zu der laut Richard Hare auch das (noch zu diskutierende) Merkmal der Präskripüvität gehört; vgl. dazu etwa Hare, Richard M., Die Sprache der Moral. Übers. von Petra von Morstein. Frankfurt am Main 1972; ders., Freiheit und Vernunft. Übers. von Georg Meggle. Frankfurt am Main 1983.
14 Eine Handlung ist dabei laut Aristoteles als unfreiwillig anzusehen, wenn „der Handelnde oder Leidende keinen Einfluß darauf nehmen kann, etwa wenn der Sturm einen irgendwohin führt, oder die Menschen, die über einen herrschen.“ Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik. Übers. von Olof Gigon. München 41981, 99 (1109b32–1110a4).
15 Die Frage, wann die Annahme gerechtfertigt ist, dass ein Sachverhalt kausal von jemandes Handeln abhängt, kann dabei verschieden beantwortet werden; vgl. dazu etwa Heider, Fritz, Psychologie der interpersonalen Beziehungen. Übers. von Gerhard Deffner. Stuttgart 1977, 37f.
16 Die angeführten Bedingungen für das Zurechnen von Verantwortung müssten weiter präzisiert und differenziert werden, um verschiedene Formen von Verantwortung bestimmen zu können; einige Angaben dazu finden sich bei Neumaier, Moralische Verantwortung, 66–103.
17 Vgl. dazu Hare, Sprache der Moral; und ders., Freiheit und Vernunft; sowie Hare, Richard M., Universalisierbarkeit. Übers. von Georg Meggle, in: Grewendorf, Günther/Meggle, Georg (Hrsg.), Sprache und Ethik. Zur Entwicklung der Metaethik. Frankfurt am Main 1974, 198–216. Zur Deutung dieser Bedingungen vgl. z.B. Morscher, Edgar, Hares verschiedene Auffassungen von Universalisierbarkeit, in: Fehige, Christoph/Meggle, Georg (Hrsg.), Zum moralischen Denken. Bd. 1. Frankfurt am Main 1995, 179–193.
18 Dies zu erkennen, sind Menschen – wie bereits Jean Plaget bemerkte – anscheinend ab einem Alter von etwa zehn bis zwölf Jahren fähig; vgl. Plaget, Jean, Das moralische Urteil beim Kinde. Übers. von Lucien Goldmann. Frankfurt am Main 31979, 223ff. Mithin sind Menschen aber auch frühestens ab diesem Alter in vollem Sinne als moralisch zurechnungsfähig anzusehen, selbst wenn sie schon früher ein gewisses Bewusstsein von den Konsequenzen ihres Handelns und von dessen Sinn zeigen.
19 Vgl. dazu insbesondere Singer, Peter, Praktische Ethik. 2., rev. und erw. Aufl., übers. von Oscar Bischoff, Jean-Claude Wolf und Dietrich Klose. Stuttgart 1994, Kap. 2.
20 Vgl. dazu etwa Frankena, William K., Analytische Ethik. Eine Einführung. Übers. von Norbert Hoerster. München 1972, 32. Ähnlich fordert bereits Bernard Bolzano in seinem „obersten Sittengesetz“: „Wähle von allen dir möglichen Handlungen immer diejenige, die, alle Folgen erwogen, das Wohl des Ganzen, gleichviel in welchen Teilen, am meisten befördert“; vgl. Bolzano, Bernard, Lehrbuch der Religionswissenschaft. Sulzbach 1834, Bd. I, 236.
21 Vgl. dazu Føllesdal, Dagfinn, Einige ethische Aspekte der DNS-Rekombination, in: Morscher, Edgar/Neumaier, Otto/Zecha, Gerhard (Hrsg.), Philosophie als Wissenschaft. Essays in Scientific Philosophy. Bad Reichenhall 1981, 393–411, hier 396.
22 Moore, George Edward, Principia Ethica. Übers. von Burkhard Wisser. Stuttgart 1970, 214; vgl. auch ders., Grundprobleme der Ethik. Übers. von Annemarie Pieper. München 1975, 124f., wo eine Reihe von Beispielen für unsinnige Gebote gegeben wird.
23 Unter der Voraussetzung, dass ein Gebot von einer vernünftigen Person geäußert wird, gilt zudem, dass sie dieses selbst verstehen können sollte.
24 Wenn ein Moralsystem Normen enthält, die zu befolgen prinzipiell unmöglich ist, dann verliert es seinen „Witz“. Wozu sollte nämlich eine Norm überhaupt gut sein, wenn es auch nicht ein einziges Wesen gibt, das diese Norm befolgen kann?
25 Von der angesprochenen trivialen Art sind etwa die „Befehle“, die in Samt-Exupérys „Der kleine Prinz“ der König auf dem Asteroiden 325 den Sternen gibt, nämlich dass diese sich so „verhalten“, wie sie es ohnehin tun; vgl. Saint-Exupéry, Antoine de, Der kleine Prinz. Übers. von Grete und Josef Leitgeb. Bad Salzig 1950, 34ff Solche „Normen“ implizieren keinerlei Verpflichtungen. Dasselbe wäre etwa auch der Fall, wenn ich den Befehl äußerte: „Lesen Sie diesen Text oder lesen Sie ihn nicht!“
26 Zumindest ist denkbar, dass eine an Zwangsneurose leidende Person prinzipiell die zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen abwägen sowie angeben kann, welche Alternative normativ gesehen moralisch richtig ist, dass sie diese aber nicht wählt, da sie innerlich gezwungen ist, eine andere Handlung zu vollziehen. Diese ist zwar in einem gewissen Sinne auch eine Handlungsalternative, nicht aber in einem anderen, nämlich insofern, als es für eine solche Person faktisch keine Alternative zur Zwangshandlung gibt; vielmehr vollzieht sie diese, was auch immer sonst in Frage käme.
27 Davon zu unterscheiden sind sogenannte Sachzwänge, wonach jemand, die in einer bestimmten Situation zwischen mehreren Handlungsalternativen wählen könnte, eine bestimmte Handlung vollziehen „muss“, weil sachliche Gründe sie dazu „zwingen“. Sofern damit gemeint ist, dass sich jemand für eine bestimme Handlung entscheidet, weil Vernunftgründe dafür sprechen, und dass es (auch moralisch) richtig ist, rational zu handeln, ist gegen das Handeln dieser Person (bzw. gegen die Erklärung ihres Handelns) nichts einzuwenden. Wohl aber ist es falsch zu behaupten, dass sie gezwungen sei, jene Handlung zu vollziehen; vielmehr könnte sie sehr wohl auch anders handeln. Der Hinweis auf „Sachzwänge“ ist wohl eher ein Versuch, eine Handlung mit Bezug auf bestimmte zweckrationale Voraussetzungen als die einzig vernünftige zu erklären (wobei solche Erklärungen mitunter auch als Entschuldigungen fungieren, durch welche die Verantwortung für eine bestimmte Handlung auf „Sachen“ abgeschoben wird, die jemanden „zwingen“, eine bestimmte Handlung zu vollziehen).
28 Aus diesem Stoff ist anscheinend nicht nur die griechische Tragödie gemacht, sondern auch ein wesentlicher Teil der christlichen Heilsgeschichte, zumindest in der Interpretation von Walter Jens, in dessen „Fall Judas“ folgendes Argument zu finden ist: Wenn es wahr ist, dass Jesus durch Gottes Willen geopfert werden sollte, um die Menschen zu retten, und dass ein wesentlicher Teil in diesem Heilsplan war, dass Jesus von Judas an die Hohen Priester verraten wurde, dann blieb Judas keine Wahl, sondern er hatte Gottes Plan zu erfüllen – ob er wollte oder nicht. Darum kann er nicht des Verrates an Jesus beschuldigt werden. Laut Jens sollte er vielmehr für seinen Beitrag zur Erfüllung von Gottes Plan zur Erlösung der Menschheit gelobt werden. Vgl. Jens, Walter, Der Fall Judas. Stuttgart 1975. Damit widerspricht Jens freilich seinen eigenen Voraussetzungen: Wenn Judas keine Wahl hatte, dann erwarb er sich nämlich auch kein Verdienst; vielmehr verwendete ihn Gott als „Werkzeug“, das er für die Erfüllung seines Heilsplanes brauchte. Judas war demnach als Element dieses Planes darin verwickelt. Darum gebührt ihm – zumindest aus der Sicht eines Aristoteles – eher Mitleid als Lob.
29 Der Ausdruck „Sachverhalt“ bezieht sich genau genommen auf unterschiedliche Phänomene, die als etwas zu berücksichtigen sind, das wir kausal beeinflussen können, z.B. Ereignisse, Vorgänge, Zustände und Situationen.
30 Vgl. dazu Frankfurt, Harry G., Alternate Possibilities and Moral Responsibility, in: Ders., The Importance of What We Care About. Philosophical Essays. Cambridge 1988, 1–10. Zur Diskussion der mit Frankfurts Position verbundenen Probleme vgl. vor allem die Beiträge in French, Peter A./Wettstein, Howard K./Fischer, John M. (Hrsg.), Free Will and Moral Responsibility. Boston (Mass.)/Oxford 2005; sowie in Widerker, David/McKenna, Michael (Hrsg.), Moral Responsibility and Alternative Possibilities. Essays on the Importance of Alternative Possibilities. Aldershot 2003.
31 Singer, Wolf, Verschaltungen legen uns fest: Wir sollten aufhören, von Freiheit zu sprechen, in: Geyer, Christian (Hrsg.), Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente. Frankfurt am Main 2004, 30–65, hier 57f Vgl. auch Roth, Gerhard, Worüber dürfen Hirnforscher reden – und in welcher Weise?, in: Geyer, Christian (Hrsg.), Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente. Frankfurt am Main 2004, 66–85; ders., Wer entscheidet, wenn ich entscheide?, in: Elsner, Norbert/Lüer, Gerd (Hrsg.), „… sind eben alles Menschen“. Verhalten zwischen Zwang, Freiheit und Verantwortung. Göttingen 2005, 223–241. Zu einer Kritik dieser Position vgl. Neumaier, Otto, Etwas anderes tun können. Moralische Verantwortung und Handlungsfreiheit, in: Bauer, Emmanuel J. (Hrsg.), Freiheit in philosophischer, neurowissenschaftlicher und psychotherapeutischer Perspektive. München 2007, 191–214, hier 207ff. Eine grundlegendere Diskussion bieten etwa Bennett, Maxwell R./Hacker, Peter M. S., Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften. Übers. von Axel Walter. Darmstadt 2010.
32 Schlick, Moritz, Die Kausalität in der gegenwärtigen Physik, in: Ders., Gesammelte Aufsätze 1926–1936. Wien 1938, 41–82, hier 80.
33 Als Moraltheorie bestimmt die Ethik „lediglich“, unter welchen Voraussetzungen unser Handeln moralisch richtig bzw. gerechtfertigt ist, ohne dass dadurch bereits gefordert würde, dass das, was als richtig und gerechtfertigt gilt, auch von jedem Menschen befolgt werden muss. Vielmehr gilt lediglich die konditionale Annahme: Wenn jemandem daran liegt, moralisch zu handeln bzw. ein moralischer Mensch zu sein, dann ist sie verpflichtet, das moralisch Richtige zu tun. Es ist jedoch möglich bzw. denkbar, dass jemand erkennt, was in bestimmter Hinsicht moralisch richtig ist, sich aber zugleich entscheidet, anders zu handeln, z.B. deshalb, weil ihr die mit Moral verbundenen Ansprüche zu hoch sind. Ein solcher Mensch handelt dann eben nicht moralisch, d.h., er handelt anders, als durch die Moraltheorie im normativen Sinne als richtig bzw. gerechtfertigt erklärt wird. Nur wer einen Moralismus vertritt, nimmt nicht bloß an, was moralisch richtig bzw. gerechtfertigt ist, sondern fordert zudem auch, dass alle Menschen moralisch richtig handeln sollen. Dies ist in gewissem Sinne durchaus konsequent, d.h., wenn es darum geht, moralische Ansprüche an jemanden zu richten, so bieten sich dafür naheliegenderweise diejenigen Ansprüche an, die durch die Prinzipien der Moraltheorie als richtig bzw. gerechtfertigt ausgezeichnet werden. Allerdings stellt sich die Frage, mit welchem Recht die Ethik von allen Menschen verlangen kann bzw. soll, moralisch zu handeln, bzw. ob ein solcher Anspruch in der Lebenswirklichkeit, die allem Anschein nach (vorsichtig ausgedrückt) nicht durchgehend an moralischen Prinzipien ausgerichtet ist, überhaupt realistisch sein kann. Wenn überhaupt für jemanden, so gilt die Forderung, so zu handeln, wie es von einer bestimmten Moraltheorie als richtig bestimmt wird, demnach primär für die Person, die diese Moraltheorie vertritt und deshalb konsistenterweise selbst so handeln soll, wie es von ihrer eigenen Theorie als richtig erklärt wird. Vgl. dazu Neumaier, Moralische Verantwortung, 106ff.
34 Der Anspruch, moralisch zu sein, ist also mit „Kosten“ verbunden. Mit einem englischen Wortspiel könnten wir auch sagen, dass es keine „duty free morality“ gibt. Eine solche Einschränkung gilt indes nicht nur für die Moral, sondern genauso etwa für Wissenschaft und Technik: Wer z.B. beansprucht, technisch zu handeln bzw. im Rahmen einer technischen Disziplin tätig zu sein, hat nicht die „Freiheit“, beliebig zu handeln; vielmehr ist sie in diesem Rahmen verpflichtet, bestimmte methodische und andere Standards einzuhalten.
35 Vgl. Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Ders., Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie (Werke. Hrsg. von Wilhelm Weischedel, Bd. 4). Wiesbaden 1956, 7–102, hier 51. Die hier angestellten Überlegungen lassen sich ähnlich auf das in Anm. 20 erwähnte „oberste Sittengesetz“ anwenden, mit dem Bernard Bolzano eine teleologische Ethik zu begründen versucht.
36 Die Vorstellung einer persönlichen Kausalität geht auf Aristoteles zurück; vgl. dazu Anm. 14. Seit Francis Bradley wird sie nicht nur in der Philosophie diskutiert, sondern insbesondere auch in der Psychologie, etwa von William Stern, der den Begriff prägte. Vgl. Bradley, Francis H., Ethical Studies. 2nd ed., with add. notes. Oxford 1927; Stern, William, Die menschliche Persönlichkeit (Person und Sache. System des kritischen Personalismus, 2). 3., unveränd. Aufl. Leipzig 1923. John Glover kritisiert das Prinzip der persönlichen Kausalität als unklar, vertritt es jedoch selbst, wie etwa seine Annahme zeigt, dass niemandem moralische Schuld an etwas gegeben werden könne, was sie nicht selbst tut. Vgl. dazu Glover, John, Responsibility. London/New York 1970, 14, 166f.
37 Vgl. Hart, H. L. A., Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law. Oxford 1968, 225f.
38 Dieses Merkmal der moralischen Verantwortung lässt sich auch indirekt aufweisen, indem wir die Rede von der Elternverantwortung rechtlich interpretieren. In diesem Fall ist nämlich die Menge der Verpflichtungen von Eltern wesentlich kleiner bzw. genauer bestimmt und auch auf die Zeit bis zur Volljährigkeit der Kinder begrenzt. Auch der Bereich der moralischen Verantwortung von Eltern ändert sich in dem Maße, in dem ihre Kinder selbst zu verantwortungsfähigen Subjekten werden. Andererseits wird jedoch die moralische Verantwortung der Eltern für das Wohlergehen ihrer Kinder durch deren Erwachsenwerden nicht schlichtweg aufgehoben, d.h., Kinder haben auch als Erwachsene bestimmte „erworbene“ moralische Rechte gegenüber ihren Eltern, aufgrund deren die Eltern verpflichtet sind, dieses Wohlergehen zumindest nicht zu gefährden.
39 Aus ähnlichen Gründen ist etwa Sippenhaftung moralisch nicht zu rechtfertigen und ist die Frage nach der Möglichkeit einer moralischen Verantwortung von Kollektiven differenziert zu beantworten. Vgl. dazu Neumaier, Otto, Sind Kollektive moralisch verantwortlich?, in: Ders. (Hrsg.), Angewandte Ethik im Spannungsfeld von Ökologie und Ökonomie. Sankt Augustin 1994, 49–121.
40 Vgl. Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Ders., Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie (Werke. Hrsg. von Wilhelm Weischedel, Bd. 4). Wiesbaden 1956, 303–634, hier 334. Zur Unterscheidung zwischen moralischem Sollen im Sinne einer Pflicht und im Sinne eines Verdienstes bzw. übergebührlichen Handelns vgl. Neumaier, Moralische Verantwortung, 227–240.
41 In diesem Fall wird das moralisch verantwortliche Verhalten zur Eigenschaft einer Person. Auf diesen Aspekt von Verantwortung bezieht sich etwa der lateinische Ausdruck „praestare“, der nicht nur „für etwas einstehen“ bedeutet, sondern auch „sich vorbildlich verhalten“.
42 Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die hier diskutierten Gedanken über Verantwortung als Pflicht auf die theoretische Rechtfertigung moralischer Ansprüche gerichtet sind. Indes ist moralisch richtiges Handeln unter der Voraussetzung der skizzierten Prinzipien einer normativen Moral trotz bzw. eben wegen der einen, scheinbar einfachen moralischen Pflicht ein sehr hoher Anspruch, und es ist denkbar, dass sich jemand angesichts dessen entscheidet, im geschilderten Sinn lieber nicht moralisch zu handeln bzw. zu sein. Die theoretische Begründung moralischer Prinzipien ist jedoch eine Seite, ihre praktische Umsetzung eine andere – selbst wenn die Prinzipien gut begründet sind und die Menschen sich bemühen, sie zu befolgen. Deshalb sind die theoretischen Prinzipien durch praktische „Daumenregeln“ zu ergänzen. So wäre etwa möglich, ein in Zusammenhang mit Tierversuchen oft vorausgesetztes praktisches Prinzip als VVV –Regel auf unseren Kontext zu übertragen: Demnach ist es praktisch gesehen gut, wenn wir moralisch falsches Handeln möglichst vermeiden, es aber, soweit uns das nicht gelingt, möglichst verringern, und unser Verhalten bei den verbleibenden Problemfällen zumindest verfeinern. Solche praktischen Regeln widerlegen keineswegs die theoretische Gültigkeit von Moralprinzipien, denn diese ist nicht dadurch begründet, dass sich Menschen auch daran halten, sondern aufgrund von theoretischen Kriterien. Praktische Regeln wie die erwähnte erleichtern aber vielleicht jemandem das Leben, die sich prinzipiell bemüht, moralisch zu handeln, der dies aber als Mensch eben nur unvollkommen gelingt.
43 Vgl. Spranger, Eduard, Menschenleben und Menschheitsfragen. Gesammelte Rundfunkreden. München 1963, 101f.
44 Vgl. Lenk, Hans, Verantwortung und Gewissen des Forschers, in: Neumaier, Otto (Hrsg.), Wissen und Gewissen. Arbeiten zur Verantwortungsproblematik. Wien 1986, 35–55, hier 44ff
45 Vgl. etwa Kant, Metaphysik der Sitten, 325f.
46 Vgl. ebd., 337.
47 Vgl. ebd., 475.
48 Kant, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft, in: Ders., Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie (Werke. Hrsg. von Wilhelm Weischedel, Bd. 4). Wiesbaden 1956, 103–302, hier 144.
49 Ebd. Eine ähnliche (aber wohl nicht identische) Unterscheidung von Freiheit im positiven und negativen Sinne stammt von Isaiah Berlin; vgl. Berlin, Isaiah, Two Concepts of Liberty, in: Ders., Four Essays on Liberty. London/Oxford/New York 1969, 118–172, bes. 122–134.
50 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 298f.
51 Vgl. Freud, Sigmund, Die „kulturelle“ Sexualmoral und die moderne Nervosität, in: Ders., Werke aus den Jahren 1906–1909 (Gesammelte Werke, Bd. 7). Frankfurt am Main 1999, 143–167, hier 150.
52 Vgl. Brecht, Bertolt, Anmerkungen zu „Leben des Galilei“, in: Ders., Schriften zum Theater 3 (Gesammelte Werke, Bd. 17). Frankfurt am Main 1967, 1103–1112, hier 1109.
53 Hammer, Felix, Selbstzensur für Forscher? Schwerpunkte einer Wissenschaftsethik. Zürich/Osnabrück 1983, 58.
54 Vgl. dazu Neumaier, Otto, Technische Innovation und moralische Reflexion, in: Kornwachs, Klaus (Hrsg.), Technik – System – Verantwortung. Münster 2004, 515–526.
55 Russell, Bertrand, Probleme der Philosophie. Übers. von Eberhard Bubser. Frankfurt am Main 1967, 138.