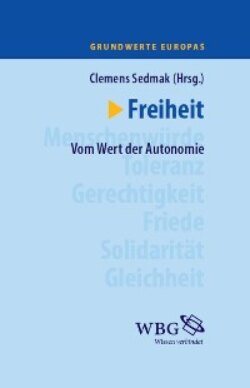Читать книгу Freiheit - Группа авторов - Страница 12
Freiheit von moralischer Verantwortung
ОглавлениеWenn wir menschliches Verhalten beobachten, so erscheint es sinnvoll, Fälle, in denen uns Handlungsfreiheit zu Gebote steht, von solchen zu unterscheiden, in denen wir nicht frei entscheiden können. In den neurobiologischen Überlegungen, die auf evolutionär entstandene Bedürfnisse eines Organismus ausgerichtet sind, kommt nicht nur dieser Unterschied etwas zu kurz, sondern auch jene Wahlmöglichkeit, die für unsere Überlegungen von besonderer Bedeutung ist. Wir stehen nämlich oft vor der Wahl, moralisch richtig im Sinne der Sittlichkeit zu handeln oder nicht. Die Beobachtung von Bereitschaftspotenzialen im Präfrontalbereich des Großhirns scheint uns keine Vorhersagen zu erlauben, wie sich jemand dabei entscheidet. Wenn andererseits Grund zur Annahme besteht, dass eine Person fähig ist, die Situation zu verstehen, und dass es ihr möglich ist, aus verfügbaren Handlungsaltemativen eine zu wählen, die erlaubt, das moralisch Richtige zu tun, dann ist jedoch nicht nur die Bedingung der Handlungsfreiheit erfüllt, sondern dann ist es aufgrund dessen auch gerechtfertigt, ihr moralische Verantwortung für ihr Tun zuzurechnen.
Wenn wir über Handlungsalternativen verfügen, so steht es uns zunächst also frei, ob wir moralisch handeln wollen oder nicht.33 Wer sich entscheidet, moralisch zu handeln, übernimmt damit freilich auch die Verpflichtung, so zu handeln, wie es den moralischen Normen zufolge richtig ist.34 Die mit moralischem Handeln verknüpften Ansprüche können aber anscheinend oder scheinbar so hoch sein, dass uns kein Freiraum mehr bleibt. Darauf deuten zumindest die als Grundlage normativer Überlegungen genannten allgemeinen Moralprinzipien hin, z.B. der kategorische Imperativ, der in der ersten von Kant gegebenen Formulierung lautet: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“35 Auch wer nur (bzw. stets) nach dieser (oder einer anderen) moralischen Maxime handelt, ist damit allerdings nicht in ein lückenloses Netz moralischer Pflichten eingespannt, sondern in manchen Fällen frei von moralischer Verantwortung, und zwar gleich aus mehreren Gründen.
Wie erwähnt, ist es nur dann gerechtfertigt, jemandem überhaupt Verantwortung zuzurechnen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Selbst wenn wir über Handlungsfreiheit verfügen, kann dabei der Fall eintreten, dass ein empirischer Sachverhalt, von dem sich die Frage stellt, ob er uns kausal zuzurechnen ist, de facto nicht durch unser Handeln bewirkt wird oder dass davon niemand (anderer) betroffen ist (zumindest nicht auf eine Weise, dass es gerechtfertigt wäre, Normen an uns zu richten). In solchen Fällen sind wir aus empirischen Gründen frei von Verantwortung. Mit Bezug auf moralische Verantwortung lässt sich dieser Freiheitsspielraum sogar noch etwas genauer bestimmen, und zwar deshalb, weil für die Antwort auf die Frage, was es heißt, einen Sachverhalt zu verursachen, bei der moralischen Verantwortung das Prinzip der persönlichen Kausalität eine entscheidende Rolle spielt.36 Demnach sind wir moralisch nur für etwas verantwortlich, das wir selbst tun bzw. das wir selbst kausal beeinflussen. Die Annahme, dass wir moralisch für etwas verantwortlich sein könnten, das in keiner Weise mit unserem Handeln kausal zusammenhängt, verstößt nach Ansicht von H. L. A. Hart gegen die Vorstellung von Moral.37
Die Frage, warum das so ist, lässt sich folgendermaßen beantworten: Wenn es gerechtfertigt wäre, jemanden moralisch für die Konsequenzen einer Handlung verantwortlich zu machen, die nicht sie selbst, sondern jemand anderer vollzieht (und zwar so, dass die eine Person keinerlei Einfluss darauf nimmt, was die andere tut), so könnte jene Person nicht nur für jede beliebige Handlung verantwortlich gemacht werden, sondern auch ebenso beliebig ihre moralische Verantwortung an andere Personen „delegieren“. Damit wir überhaupt auf sinnvolle Weise von Verantwortung sprechen können, muss es möglich sein, sie von etwas zu unterscheiden, das nicht Verantwortung ist. Und zwar ist es notwendig, Verantwortung nicht nur von Gegebenheiten abzugrenzen, die (wie z.B. die Frage nach der Farbe des Hemdes, das ich trage, während ich dies schreibe) mit keinerlei moralischen, rechtlichen oder anderen Ansprüchen verbunden sind, sondern auch von Formen moralischer, rechtlicher oder anderer Verpflichtungen, bei denen nicht oder nicht unbedingt von Verantwortung zu sprechen ist (wie z.B. der Pflicht, vor Gericht als Zeuge auf die Bibel zu schwören).
Wenn es nicht möglich ist, Verantwortung in diesem Sinne zu „definieren“ sowie Formen von Verantwortung, die mit verschieden hohen moralischen oder rechtlichen Ansprüchen verknüpft sind, voneinander abzugrenzen, so müssen wir wählen, ob wir uns ständig und für alles schuldig fühlen, ob wir die Vorstellung von Verantwortung völlig aus unserem Leben streichen oder ob wir den Ausdruck „Verantwortung“ nur noch metaphorisch verwenden. Aus diesem Grund brauchen wir einen Anhaltspunkt dafür, in welchen Fällen es gerechtfertigt ist, jemandem Verantwortung zuzurechnen, und in welchen dem nicht so ist.
Für eine solche rationale Begrenzung von Verantwortung bieten sich zwei Möglichkeiten an: Entweder wird der Bereich der Verantwortung (d.h. die Menge der Sachverhalte, auf die sich unsere Verantwortung bezieht, und der Handlungen, für die wir in Bezug auf jene Sachverhalte verantwortlich sind) hinreichend genau bestimmt oder aber wir führen Kriterien der Verantwortlichkeit ein (wie das Prinzip der persönlichen Kausalität). Wenn es z.B. heißt, die Firma, die eine Ware herstellt, sei dafür verantwortlich, dass sich diese in einem einwandfreien Zustand befindet, Wissenschaftstreibende seien dafür verantwortlich, dass sie mit den für ihre Arbeit relevanten Informationen auf methodisch einwandfreie Weise umgehen, oder eine Kindergärtnerin sei für die ihr anvertrauten Kinder verantwortlich, so wird dabei nicht nur der Bereich dessen relativ genau angegeben, für den jemand verantwortlich ist, sondern auch eine Funktion oder Rolle, aus der sich ihre Verantwortung jeweils ergibt. Der Bereich der Verantwortung ist in solchen Fällen hinreichend genau bestimmt, so dass wir sagen können, er sei nahezu geschlossen bzw. relativ begrenzt. Aus diesem Grund ist es aber möglich, jemandem innerhalb des durch ihre Rolle bestimmten Zuständigkeitsbereichs durchaus auch Verantwortung für Sachverhalte zuzurechnen, die sie nicht selbst verursacht (aber aufgrund ihrer Zuständigkeit in einem weiteren Sinne kausal beeinflussen kann).
Dies gilt nicht für moralische Verantwortung; deren Bereich ist vielmehr weitgehend offen bzw. umfassend, d.h., wir können nicht davon ausgehen, dass wir moralisch nur für ganz bestimmte Sachverhalte verantwortlich und mit Bezug darauf nur zu ganz bestimmten Handlungen verpflichtet sind, nicht aber zu anderen; vielmehr müssen wir damit rechnen, dass wir moralisch die Verantwortung für einen Bereich tragen, der in Bezug auf die infrage kommenden Sachverhalte oder Betroffenen unbestimmt ist. So sind etwa Eltern als solche moralisch zwar „nur“ für ihre Kinder verantwortlich, doch bezieht sich diese Verantwortung auf alles, was deren Wohlergehen und Entwicklung betrifft, wobei nicht vorhersagbar ist, was alles zum Gegenstand ihrer Verantwortung werden kann.38 So gesehen mag zwar der Bereich der moralischen Verantwortung weniger klar begrenzt sein als bei anderen Formen von Verantwortung, doch hat der Bezug auf persönliche Kausalität zur Folge, dass wir moralisch gesehen ex obligo sind, sofern kein Grund zur Annahme besteht, dass ein bestimmter Sachverhalt kausal von unserem eigenen Handeln abhängt. Im Unterschied dazu haftet z.B. der Hersteller einer Ware rechtlich für ein schadhaftes Produkt, selbst wenn ihm der Schaden kausal nicht zurechenbar ist.39
Eine andere Grenze für das Zurechnen moralischer Verantwortung wird durch die Moralprinzipien gesetzt, die dabei zur Anwendung kommen. So gilt etwa unser Tun dem Unschuldsprinzip zufolge als moralisch richtig, solange nicht erwiesen ist, dass die Summe der vorhersehbaren Konsequenzen einer Handlung schlechter ist als die der verfügbaren Handlungsaltemativen. Die Beweislast liegt mithin nicht bei jenen, denen moralische Verantwortung zugerechnet wird, sondern bei jenen, die sie für moralisch verantwortlich erklären. Solange uns nicht aus guten Gründen eine Schuld oder Schuldigkeit zurechenbar ist, sind wir jedoch frei davon. Wenn wir andererseits im erwähnten Sinne verpflichtet sind, so zu handeln, dass die vorhersehbaren Konsequenzen einer Handlung insgesamt zumindest gleich gut sind wie die der verfügbaren Alternativen, so folgt daraus, dass uns nicht mehr an moralischer Verantwortung zuzurechnen ist, als durch jenes Prinzip verlangt wird.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die erwähnten Moralprinzipien nur auf Verantwortung im Sinne einer moralischen Pflicht beziehen. Wenn wir bestrebt sind, moralisch zu handeln, so haben wir in diesem Sinne vor allem eine Pflicht, nämlich die, moralisch richtig zu handeln. Insofern, als diese Pflicht einschließt, dass alles getan wird, was zum moralisch richtigen Handeln gehört, impliziert sie andere Pflichten, insbesondere die Pflichten, die Interessen der von einer Handlung betroffenen Wesen ebenso sorgfältig abzuwägen wie die als Konsequenzen der Handlung vorhersehbaren Sachverhalte, von denen jene Wesen betroffen sind, sowie überhaupt zu bedenken, welche Alternativen zur Verfügung stehen. Es ist jedoch nicht gerechtfertigt, von uns mehr an Verantwortung zu fordern. So kann eine Handlung z.B. schlechte Konsequenzen haben, die wir selbst bei bestem Wissen nicht vorhersehen können. Sofern Grund zur Annahme besteht, dass wir die vorhersehbaren Konsequenzen der verfügbaren Handlungsalternativen sorgsam abgewogen haben, ist es in einem solchen Fall nicht gerechtfertigt, uns retrospektiv eine moralische Schuld zuzurechnen – denn mehr haben wir nicht tun können, um unserer moralischen Pflicht zu genügen. Von Menschen mehr zu fordern als die Erfüllung der einen moralischen Pflicht, bedeutete eine allzu große moralische Belastung und würde die Sollen-Können-Bedingung verletzen.
Nicht immer, wenn von moralischer Verantwortung die Rede ist, geht es allerdings um eine moralische Pflicht im strengen Sinn. Ein Fall, für den dies nicht gilt, liegt etwa vor, wenn es schlichtweg heißt, die Menschen seien für die Erhaltung der Biosphäre verantwortlich. Der damit verknüpfte moralische Anspruch ist nämlich viel zu hoch, als dass er einem Menschen zur Pflicht gemacht werden könnte, denn er würde seine Pflicht verletzen, wenn er nicht alles tut, was zur Erhaltung der Biosphäre beiträgt. Dennoch ist davon auszugehen, dass jemand zumindest moralisch gut handelt, wenn sie sich dafür einsetzt. Wir müssen also zwei Arten des moralischen Sollens unterscheiden, die Kant als Schuldigkeit und als Verdienst bezeichnet. Von einem Verdienst ist dabei dann zu sprechen, wenn „jemand pflichtmäßig mehr tut, als wozu er nach dem Gesetze gezwungen werden kann“40. Wir verletzen mithin auch keine Pflicht, wenn wir etwas Verdienstliches nicht tun.
Von einer Schuldigkeit ist dabei primär prospektiv zu sprechen, also in Bezug darauf, dass jemandem als Verantwortung zuzurechnen ist, dass sie etwas Bestimmtes tun soll. Hingegen scheint retrospektiv zunächst nur jemandes Schuld Gegenstand moralischer Urteile zu sein, d.h. das Verletzen der moralischen Pflicht. Wenn jemand die moralische Pflicht hat, moralisch richtig zu handeln, so erscheint es nämlich auf den ersten Blick nicht gerechtfertigt zu sagen, sie sei retrospektiv zu loben, sofern sie ihrer Schuldigkeit Genüge getan, also ihre Pflicht erfüllt hat. Schließlich und endlich war es ja ihre Pflicht, das moralisch Richtige zu tun, und sie hätte ihre Pflicht verletzt, wenn sie anders gehandelt hätte. Das retrospektive Zurechnen einer Schuldigkeit im positiven Sinn kommt auf den zweiten Blick indes dennoch zum Tragen, und zwar mit Bezug darauf, dass jemand über längere Zeit und mit großer Konstanz (oder sogar in jeder Lebenssituation) ihre moralische Pflicht erfüllt, sodass mit Recht gesagt werden kann, dass sie pflichtbewusst bzw. moralisch vorbildlich ist.41
Wenn sich jemand sozusagen generisch verantwortungsbewusst verhält, sodass sich die durch ihr Handeln Betroffenen auf sie verlassen können, dann erscheint es gerechtfertigt, ihr Verhalten nicht bloß als moralisch richtig anzusehen, sondern sie als verantwortungsvoll zu würdigen. Allerdings geht ein solches konsequent moralisches Handeln, durch das jemand ein verantwortungsvoller Mensch ist, wohl weit über das hinaus, was ihr als Schuldigkeit zugerechnet werden kann. Ein derartiges Verantwortungsbewusstsein kommt also letztlich einem moralischen Verdienst gleich. Jedem Menschen kann es „zustoßen“, dass er einmal seine Pflicht verletzt, also nicht das tut, was moralisch richtig ist. Auch wenn es gerechtfertigt ist, uns mit Bezug auf eine bestimmte Handlung die Pflicht zuzurechnen, dass diese von den zur Verfügung stehenden Alternativen die moralisch richtige ist, erscheint andererseits der Anspruch allzu hoch, dass wir nie eine moralisch falsche Handlung vollziehen.42
Es steht uns demnach nicht zu, jemanden als verantwortungslos anzusehen, wenn sie zwar im Allgemeinen ihre Schuldigkeit tut, aber einmal dabei versagt. Deshalb kann jemandem das ausnahmslose Erfüllen ihrer Pflichten nicht schlichtweg zur Pflicht gemacht werden. Wer sich darum bemüht, ihrer moralischen Schuldigkeit Genüge zu tun, handelt also „über Gebühr“ moralisch gut. Selbst wenn eine solche Person selbst das Gefühl empfindet, dazu verpflichtet zu sein, ist es nicht gerechtfertigt, ihr eine solche Pflicht zuzurechnen. Objektiv betrachtet handelt es sich vielmehr um eine freie Entscheidung zu moralisch richtigem Handeln.