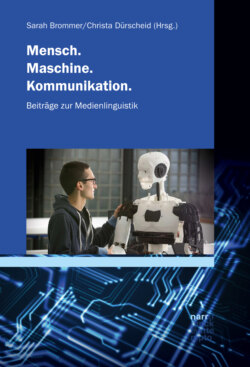Читать книгу Mensch. Maschine. Kommunikation. - Группа авторов - Страница 23
4 Diskussion der Ergebnisse
ОглавлениеEs hat sich gezeigt, dass die Affordanzen in Bezug auf die beiden untersuchten Aspekte sehr wohl relevant sind. Erst dadurch, dass quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone kommuniziert und dass auf semiotisch reichhaltige Ressourcen zurückgegriffen werden kann, erhöht sich erstens die Geschwindigkeit der Kommunikation und verliert zweitens die Schrift ihren Status als alleiniges semiotisches Mittel. Hinsichtlich der SynchronieKommunikationsynchrone lässt sich dies deutlich aufzeigen. Im vorliegenden Korpus laufen WhatsAppWhatsApp-Konversationen ‹am synchronstenKommunikationsynchrone› ab. Dass iMessageiMessage auf dem zweiten, E-MailE-Mail auf dem dritten Platz folgen, ist zunächst einleuchtend. Was aber nicht erklärt werden kann, ist der grosse Abstand zwischen iMessage und WhatsApp, denn WhatsApp ist technischTechnik gesehen nur gering ‹synchronerKommunikationsynchrone› als iMessage. Hier müssen die Gründe für den deutlichen Unterschied auf einer anderen Ebene festgemacht werden.
Wie in Kapitel 3.2 diskutiert, sind die Nachrichten bei iMessageiMessage im Vergleich zu WhatsAppWhatsApp sprachlich deutlich reflektierter, was mit dem Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone zusammenhängen kann. Da der Grund für diese sprachliche Reflektiertheit nicht in den Affordanzen des Dienstes begründet liegt, lässt sich für iMessage folgende Konsequenz ziehen: Hinsichtlich des Grades an SynchronizitätKommunikationsynchrone ist iMessage eher durch situative und soziale als durch technischeTechnik Gegebenheiten determiniert. Eine mögliche Begründung für den formelleren Duktus auf iMessage könnte in der historisch bedingten Wandlung der Bedeutung von SMS zu finden sein: Durch das Aufkommen von WhatsApp wurden SMS überflüssig. Dadurch wandelte sich das Verwendungsspektrum von SMS, sodass sie nun vermehrt für formellere, aber – im Vergleich zu E-MailE-Mails – ‹synchronere› KommunikationKommunikationsynchrone eingesetzt werden. SMS und iMessage hängen insofern zusammen, als iMessage nur zwischen zwei iOS-User*innen verwendbar ist. Schickt ein*e iOS-NutzerNutzer*in*in eine Nachricht an eine*n Androidandroid-Nutzer*in, so wandelt Apple die Nachricht in eine SMS um. Wenn folglich iOS-Nutzende iMessage verwenden, assoziieren sie damit möglicherweise die SMS-Kommunikation.
Beim E-MailE-Mailen scheint es gerade umgekehrt zu sein: Dadurch, dass E-Mails auch mobil bearbeitet werden können und Push-Nachrichten die Geschwindigkeit des Feedbacks in die Höhe treiben, steigert sich auch der Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone. In diesem Fall scheint die Technologie ausschlaggebend dafür gewesen zu sein, dass über dieses klassisch asynchroneKommunikationasynchrone Kommunikationsmittel nun auch quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone (oder zumindest: ‹synchronerKommunikationsynchrone›) kommuniziert wird. Wichtig ist aber im Hinblick auf E-Mails, dass deren Entwicklung in drei Richtungen verläuft: Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, werden E-Mails heute vermehrt unidirektional verwendet, wenn etwa eine grosse Gruppe über etwas informiert werden soll. So stehen Nachrichten in Form von sprachlich (grösstenteils) reflektierten, vielleicht sogar redigierten Texten solchen gegenüber, die spontaner und schneller verfasst werden und eher nähesprachlichenähesprachlich Merkmale (z.B. Ellipsen) beinhalten. Zusätzlich ist relevant, dass diese beiden Entwicklungen die «traditionelle» asynchroneKommunikationasynchrone, dialogischDialog ausgerichtete Kommunikation nicht ablösen – sie sind vielmehr als Ergänzung zu sehen. Für E-Mails lässt sich daher schliessen, dass das Spektrum an Sprachhandlungen durch die neuen Affordanzen erweitert wurde, weswegen sich unterschiedliche Kommunikationspraktiken ergeben. Kurz: Die Kommunikation über E-Mail ist so variantenreich, dass deren Determiniertheit durch die Technologie bzw. anderer Faktoren hinsichtlich der drei untersuchten Kommunikationsformen am wenigsten pauschal beschrieben werden kann.
Damit kommen wir zu den semiotischen Ressourcen: TechnischTechnik gesehen ist iMessageiMessage der semiotisch reichhaltigste Dienst, gefolgt von WhatsAppWhatsApp und E-MailE-Mails. Dadurch, dass sich bei den untersuchten iMessage-Beispielen sämtliche Unterhaltungen auf einer professionellen Ebene abspielen, werden kaum andere semiotische Zeichen als graphische verwendet. Hier scheint die iMessage-Kommunikation allein von situativen und sozialen Gegebenheiten bestimmt.E-MailiMessageWhatsApp1 Ein wichtiger Punkt ist dabei jedoch, welche Rückwirkung die Tatsache hat, dass dieser Dienst nicht betriebssystemübergreifend ist. So nutzen alle User*innen bei den abgebildeten Beispielen iOS, weswegen allen die Möglichkeit zur spezifisch multimodalenMultimodalität Kommunikation zur Verfügung steht. Doch es ist möglich, dass sich viele dieser Möglichkeiten gar nicht bewusst sind, weil sie in der Kommunikation via WhatsApp damit gar nicht in Berührung kommen. Das könnte eine Begründung dafür sein, warum sich Animojis, die Kommentierfunktion oder das Senden mit Effekten (noch) nicht etablieren konnten: User*innen lernen nicht, mit diesen zu hantieren, weil sie nicht Bestandteil der alltäglichen internetbasierten Kommunikation sind. Anders formuliert: WhatsApp-NutzerNutzer*in*innen, die das iOS-Betriebssystem verwenden, vermissen diese Möglichkeiten nicht, weil sie sie kaum kennen, und sie sehen demzufolge keinen Grund, für die alltägliche Kommunikation iMessage statt WhatsApp zu verwenden. So sind die Affordanzen hier indirekt doch ein zentraler Einflussfaktor auf das sprachliche Verhalten.
Bei WhatsAppWhatsApp ist das Versenden nicht-graphischer Zeichen und multimedialer Inhalte hingegen Bestandteil der Kommunikationspraxis. Doch ist dies in erster Linie technischTechnik oder situativ bzw. sozial zu begründen? Eine These könnte lauten, dass WhatsApp der erste, intensiv genutzte Messenger war, der das Verwenden der grossen Bandbreite an Emojis erlaubte. Die neuartigen technischenTechnik Möglichkeiten könnten so stark zu einem nähesprachlichennähesprachlich Kommunikationsverhalten motiviert haben, dass sich die semiotisch variantenreiche Kommunikation als «WhatsApp-typisch» etablierteWhatsApp.2 Dass Emojis, Memojis und andere semiotische Zeichen verwendet werden, wird hier quasi erwartet; WhatsApp wird mit der Verwendung dieser Zeichen assoziiert. Allein schon das Verwenden von Diensten, die nicht WhatsApp sind, entbindet folglich von dieser Konvention, wie die iMessageiMessage-Beispiele aufzeigen.
Was die Kommunikation über E-MailE-Mail betrifft, so scheint die Situation im Falle der «klassischen» asynchronenKommunikationasynchrone, dialogischenDialog wie auch im Falle der quasi-synchronenKommunikationquasi-synchrone, dialogischen Verwendung ebenfalls von den historisch bedingten technischenTechnik Gegebenheiten bestimmt zu sein. MultimodaleMultimodalität Inhalte finden sich hier kaum. Auf Emojis und andere Einheiten ausserhalb des graphischen Bereichs wird aber nicht in erster Linie deshalb verzichtet, weil es technischTechnik nicht möglich wäre, solche einzufügen. E-Mails werden vielmehr klassischerweise dem Bereich der Geschäftskorrespondenz zugeordnet (vgl. Dürscheid/Frick 2016: 32f.). Diese Konnotation hat sich bis heute gehalten, auch wenn E-Mails nicht nur im geschäftlichen Bereich Anwendung finden. Mit dieser Konnotation geht – offensichtlich nach wie vor – (die ErwartungErwartungshaltung an) eine sprachlich reflektierte Ausdrucksweise einher. Eine Ausnahme bilden die unidirektional laufenden E-Mails: die Werbe-E-Mails (Beispiele 7 und 8). Eine These wäre, dass dies sehr bewusst geschieht, um sich von «herkömmlichen» E-Mails abzuheben.
Weiterführend wäre es nun interessant, sprachwissenschaftliche Modelle zur Erklärung des verwendeten sprachlichen Duktus in der internetbasierten Kommunikation auf die drei Fallbeispiele anzuwenden. Hier kommt dem Modell von Peter Koch und Wulf OesterreichernähesprachlichKoch/Oesterreicher-Modell3 immer noch eine Monopolstellung zu (vgl. Albert 2013: 61), obwohl seine Anwendung im Kontext der internetbasierten Kommunikation von verschiedenen Seiten kritisiert wurde. Insbesondere die Annahme, es handle sich bei der internetbasierten Kommunikation um «getippte Gespräche» – wie dies beispielsweise Storrer (2001) formuliert –, wird in Frage gestellt. Damit würde die internetbasierte Kommunikation defizitär betrachtet – die Verwendung von Emojis oder anderen Symbolen wäre dann lediglich eine Kompensationsstrategie und nicht mehr eine spezifische semiotische Form (vgl. ausführlich zu dieser Kritik Albert 2013).
Abschliessend bleibt festzuhalten: Wünschenswert ist, dass die Sprachwissenschaft in den kommenden Jahren neue Modelle entwickeln kann, die der Diversität der Kommunikation im Internet gerecht werden. Wichtig hierfür ist auch, dass Korpora mit authentischen Daten generiert und zeitnah zugänglich gemacht werden. Nur so kann die Medienlinguistik die sich stets wandelnde Kommunikationspraxis adäquat reflektieren und aktuelle technologische Entwicklungen einbeziehen.