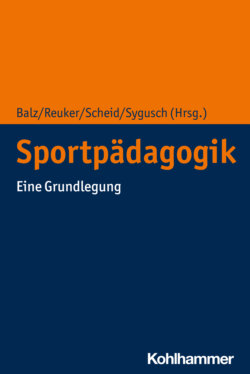Читать книгу Sportpädagogik - Группа авторов - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.2 Lernen
ОглавлениеDas Feld des Lernens ist ein in der Psychologie sehr intensiv erforschtes Gebiet, das auch ganz wesentlich in die Pädagogik Eingang gefunden hat. Im Unterschied zum Entwicklungsbegriff, der sich sowohl auf die Zu- als auch die Abnahme von Merkmalen bezieht, richtet sich Lernen immer auf einen Zuwachs. Lernen betrifft zudem, im Unterschied zu kurzfristigen Verhaltensänderungen etwa durch Ermüdung und Erschöpfung, überdauernde Verhaltensänderungen, die an die Aktivitäten der Person gebunden sind. Grupe und Krüger (2007, S. 104) definieren den Lernbegriff wie folgt:
»Lernen bezeichnet eine dauerhafte und relativ stabile Änderung der Verhaltensmöglichkeiten, des Wissens und Könnens, der Einstellungen und Gewohnheiten aufgrund von Erlebnissen und Erfahrungen oder auch durch Einsicht. Lernen ist ein aktiver Prozess, der von genetisch weitgehend festgelegten Vorgängen wie Reifung oder Altern zu unterscheiden ist.«
Mit Bezug auf den Begriff Entwicklung stellen Hannover, Zander und Wolter (2014, S. 140) fest:
»Auch Lernen ist als eine relativ überdauernde Veränderung des Organismus definiert, diese muss jedoch ausdrücklich auf Erfahrungen zurückgehen. Erfahrungen bezeichnen selbst Erlebtes oder Wahrgenommenes.«
Lernen kann also als ein Teil von Entwicklung betrachtet werden, der zu ihr beiträgt. Wenngleich im Sport das motorische Lernen eine zentrale Rolle spielt, so sind stets auch kognitive, emotionale und soziale Lernprozesse von grundlegender Bedeutung. Etwa bei der Auseinandersetzung mit Regeln und taktischem Verhalten, beim Umgang mit Gefühlen oder der Interaktion in Gruppen.
Wie in der Definition auch zum Ausdruck gebracht, ist Lernen im Sport eng mit Erfahrung, also dem unmittelbaren Wahrnehmen und Erleben von Körper und Bewegung verbunden. Dabei werden vier Typen von Erfahrungen unterschieden: leibliche, materiale, soziale und personale Erfahrungen (Grupe, 2000; Scheid & Prohl, 2017). Mit dem Lernen verbunden und dennoch abzugrenzen sind das Üben und Trainieren: Durch Übung soll bereits Gelerntes gefestigt und verbessert werden, häufig durch Wiederholung unter verschiedenen, auch erschwerten Bedingungen. Der Begriff des Trainierens bezeichnet darüber hinaus einen planmäßigen, längerfristigen Handlungsprozess zur (gezielten und kontrollierten) Einwirkung auf den Leistungszustand.
Aus der Begriffsdefinition geht ebenfalls hervor, dass sich Lernen nicht nur auf Veränderungen tatsächlich gezeigten Verhaltens, sondern stets auch perspektivisch auf Handlungsmöglichkeiten bezieht. In diesem Zusammenhang kann Lernen, verstanden als aktiver Prozess der Veränderung, von der Leistung als Ergebnis der Veränderung unterschieden werden (Eberspächer, 1987). Lernen ist zudem nicht direkt beobachtbar. Dass Lernen stattfindet bzw. stattgefunden hat, kann nur indirekt, d. h. nur über das gezeigte Verhalten bzw. konkreten Leistungen erschlossen werden.
Zur Erklärung von Lernprozessen wurden in der Psychologie eine Vielzahl von Lerntheorien entwickelt, die allerdings jeweils für sich nur einen eingeschränkten Geltungsbereich beanspruchen können. Mit Grupe und Krüger (2007) und Conzelmann, Hänsel und Höner (2013), die auch Anwendungsformen im Sport thematisieren, lassen sich drei Richtungen unterteilen:
• Reiz-Reaktions-Theorien, wobei Lernprozesse auf die Verknüpfung von äußeren Reizgebungen mit bestimmten Reaktionsweisen zurückgeführt werden. Etwa im Sinne des Signallernens (Pawlow) oder als Verstärkungslernen nach Versuch und Irrtum oder als »Lernen am Erfolg« (Thorndike, Skinner).
• Kognitive Lerntheorien, welche Lernprozesse auf komplexe kognitive Leistungen und aktive Informationsverarbeitung zurückführen. Dies betrifft bspw. das Lernen am Modell, das auf Beobachtung und Nachahmung beruht (Bandura) sowie das Lernen durch Einsicht, welches zu Neu-Organisation und Umstrukturierung führt (Köhler, Wertheimer).
• Handlungstheoretische oder interaktionale Lernmodelle (u. a. Reich). Diese Ansätze gehen von einem menschlichen Verhalten aus, das absichtsvoll, zielgerichtet und regelgeleitet erfolgt, sich in Handlungen vollzieht und durch unterschiedliche Einflussgrößen und Rückmeldungen regulierbar ist.
Viele Aspekte dieser grundlegenden Lerntheorien sind auch für das motorische Lernen von Bedeutung. Motorisches Lernen lässt sich nach Hossner, Müller und Voelcker-Rehage (2013, S. 244–254) als ein Prozess relativ überdauernder Veränderungen motorischer Kompetenzen verstehen, die auf Bewegungserfahrungen und Übungsprozessen beruhen. Lernerfolge können dabei aus der Verstärkung gelingender Bewegungsausführungen, der Verarbeitung von Informationen und Rückmeldungen sowie aus einem Transfer bereits bestehender Bewegungserfahrungen hervorgehen.
Im Kontext der Sportpädagogik ist das Lernen als Aufgabe zu verstehen, der sich Lehrende wie Lernende gleichsam stellen. Die menschliche Entwicklung und selbständige Lebensführung sind auf gezieltes Lernen angewiesen. Aufgabe von Erziehung ist es demzufolge, individuelles Lernen im Handlungsfeld Bewegung, Spiel und Sport zu ermöglichen, zum Lernen anzuregen und die Lernumgebungen didaktisch-methodisch angemessen zu gestalten.