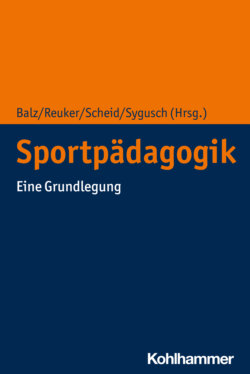Читать книгу Sportpädagogik - Группа авторов - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.3 Sozialisation
ОглавлениеDer auch in der Sportpädagogik grundlegende Begriff Sozialisation bezeichnet übergreifend die sozialen Prozesse, die auf die Entwicklung des Menschen einwirken und ihn zu einer sozial handlungsfähigen Person werden lassen. Hurrelmann (2006) hebt in seinem bekannten Begriffsverständnis das Wechselspiel von gesellschaftlichen Umweltfaktoren und angebotenen Individualfaktoren hervor:
»Sozialisation bezeichnet […] den Prozess, in dessen Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung versehene menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet, die sich über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen weiterentwickelt. Sozialisation ist eine lebenslange Aneignung von und Auseinandersetzung mit den natürlichen Anlagen, insbesondere den körperlichen und psychischen Grundlagen, die für den Menschen die ›innere‹ Realität bilden, und der sozialen und physikalischen Umwelt, die für den Menschen die ›äußere‹ Realität bilden« (ebd., S. 15).
Die lebenslange Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Anforderungen wird als aktiver, produktiver Prozess gesehen, weil die Verarbeitung jeweils als individuelle Anpassung vollzogen wird. In der Sozialisationsforschung wird u. a. zwischen unterschiedlichen Phasen des Sozialisationsprozesses unterschieden (Sozialisation im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter).
In Anlehnung an Hurrelmanns Ansatz der produktiven Realitätsverarbeitung (Hurrelmann, 2006) sieht Heinemann (2007) das Ziel der Sozialisation in der Herstellung einer Balance zwischen vier Dimensionen:
• Normative Konformität: Die Kenntnis und Anerkennung von vorherrschenden Moralauffassungen, Werten, Normen und Symbolen.
• Ich-Identität: Die Fähigkeit, Rollenerwartungen und Anforderungen der sozialen Umwelt und die eigene Persönlichkeit mit ihren Wünschen, Vorstellungen und Erwartungen in Einklang zu bringen.
• Ich-Stärke: Die Entwicklung der Fähigkeit zu autonomem Handeln, zu reflektierter Anwendung sozialer Normen und Bewältigung sozialer Konflikte.
• Solidarität: Die Fähigkeit zur Verbindung und Integration von eigener Identität und Ich-Stärke mit sozialer Verpflichtung gegenüber den Erwartungen und Ansprüchen anderer Personen.
Für die vielschichtigen Zusammenhänge von Sport und Sozialisation lassen sich unterschiedliche Phasen unterscheiden (Heinemann, 2007; Burrmann, 2018):
Unter Vorsozialisation versteht man die positiven sozialen Einflüsse, etwa durch bewegungs- und sportinteressierte Eltern oder Geschwister, die einen Zugang zum Sport begünstigen.
Sozialisation in den Sport betrifft die konkreten sportbezogenen Aktivitäten, also die Umsetzung der in der Vorsozialisation geprägten Handlungspotenziale im Sport. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Impulse und Einflüsse von anderen Personen zum eigenen Sportreiben geführt haben. Neben der Familie sind weitere Sozialisationsinstanzen wie etwa die Peer-Gruppe, der Sportverein und die Schule für die aktive Zuwendung von Bedeutung und nehmen u. a. Einfluss auf die Wahl der sportlichen Aktivtäten und den Grad der Einbindung.
Sozialisation im und durch Sport ist abhängig von den konkreten Bedingungen, unter denen eine soziale Einbindung erfolgt, was wiederum von Aspekten wie der ausgeführten Sportaktivität, der organisatorischen Gestaltung und der Art der Inszenierung abhängt. Sportlichen Aktivitäten wird damit ein Sozialisationspotenzial zugeschrieben, wobei sie als sozial vorstrukturiert gelten. Die vorliegenden empirischen Befunde zu erwarteten Sozialisationseffekten sind nach Baur und Burrmann (2008) widersprüchlich: einige Studien belegen positive Zusammenhänge zwischen Sportbeteiligung und verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen (wie Selbst- und Körperkonzept, Kontrollüberzeugungen), sozialer Integration sowie Gesundheitsstatus und -verhalten, andere Studien hingegen berichten von keinen nennenswerten Sozialisationseffekten.
Zusammenfassend sind die drei grundlegenden Begriffe Entwicklung, Lernen und Sozialisation auf das Verhalten gerichtet und betreffen die Tatsache, dass Menschen während ihres Entwicklungsverlaufs vieles erst erlernen müssen und im gesellschaftlichen Kontext sozialisiert werden:
• Entwicklung bezeichnet sowohl den Prozess als auch das Produkt fortschreitender, lebenslanger Veränderungen, als Zu- oder Abnahme motorischer, kognitiver und psycho-sozialer Merkmale.
• Lernen trägt zur Entwicklung bei und bezeichnet einen aktiven und erfahrungsbasierten Prozess. Lernen selbst ist nicht beobachtbar. Gezeigtes Verhalten (z. B. erbrachte Leistungen) machen das Ergebnis von Lernen sichtbar.
• Sozialisation bezeichnet soziale Prozesse, die lebenslang auf die Entwicklung des Menschen einwirken, Entwicklungs- und Lernprozesse auslösen und damit die soziale Handlungsfähigkeit beeinflussen.