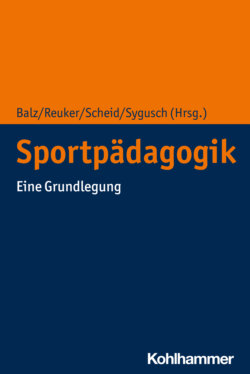Читать книгу Sportpädagogik - Группа авторов - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Genese der Sportpädagogik Michael Krüger 2.1 Einführung
ОглавлениеUnter Sportpädagogik wird »pädagogisches Handeln im Sport und gleichzeitig das Nachdenken über diese sportpädagogische Handlungspraxis, ihre mehr oder weniger systematische wissenschaftliche Erforschung« verstanden (Krüger, 2019, S. 20). Von diesem Verständnis von Sportpädagogik wird im Folgenden ausgegangen. Der Beitrag stützt sich auf Krüger (2019 und 2020). Dort wird im Detail auf die einzelnen hier charakterisierten Etappen (Milestones) der Entwicklung des Fachgebiets eingegangen. Der Begriff Genese bedeutet mehr, als die Geschichte der Sportpädagogik zu erzählen, sondern beinhaltet darüber hinaus das Bemühen, die Entwicklungsbedingungen und Prozesse der Herausbildung dieses Fachgebiets zu beschreiben, zu analysieren und zu erklären. Pädagogisches Handeln beinhaltet Handlungen, die sich auf die Bildung und Erziehung von Menschen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, beziehen, aber auch deren Unterlassung. Bildung und Erziehung ereignen sich in sozialen und kulturellen Kontexten, sei es eher unbewusst und informell, oder aber bewusst und gezielt mit der Absicht, ein bestimmtes Verhalten, Wissen, Wollen und Können zu verfolgen. Mit Sport wiederum ist in diesen pädagogischen Kontexten gemeint, dass Leibesübungen, körperlich-motorische Bewegungen, Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport implizit oder explizit dazu verwendet werden, einen Beitrag zur Bildung und Erziehung zu leisten – sei es von Einzelpersonen oder auch von Institutionen.
Das Wort Sportpädagogik ist erst seit Ende der 1960er Jahre in Deutschland gebräuchlich, aber die Sache, für die dieser Begriff steht, das Verhältnis von Sport – in einem weiten Sinn von Leibesübungen – und Erziehung, ist im Grunde universell. Sport und Erziehung sind grundlegende Elemente menschlichen Lebens und menschlicher Kultur, insofern also anthropologische Kategorien, weil sie überall vorkommen, wo Menschen leben, obwohl sie jedoch stets auf unterschiedliche und spezifische Weise sozial, kulturell und historisch ausgeprägt sind. In verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten gab es unterschiedliche Bezeichnungen für diesen Sachverhalt: Gymnastik, Athletik, Spiel, Leibesübungen, körperliche Erziehung oder Körpererziehung, Leibeserziehung, Bewegungserziehung. Heute ist in vielen Ländern auf der Welt der aus Deutschland und Österreich stammende Begriff der Leibeserziehung – als physical education – verbreitet, auch als Übersetzung in viele Sprachen, aber ebenso – bezogen auf den angelsächsischen Sprachraum – physical recreation and exercise, kinesiology, health education, human movement sciences, movement education. Immer ging und geht es dabei um die Frage, ob und wie Menschen in ihrer Entwicklung durch sportlich-körperliche Betätigungen und Spiele auf mehr oder weniger geplante, aber auch eher unbeabsichtigte, informelle Weise beeinflusst, gefördert oder behindert werden; und zwar sowohl in praktischer als auch theoretischer Hinsicht ( Kap. 1).
Die moderne, wissenschaftlich begründete Sportpädagogik griff zwar auf die Antike und auf andere historische Beispiele zurück, z. B. auf das mittelalterliche Ritter- und Turnierwesen, aber man kann erst seit dem 19. Jahrhundert davon sprechen, dass sich ein eigenes Wissens- und Wissenschaftsgebiet herausbildete, im Rahmen dessen nicht nur eine praktisch-methodische Ausbildung sowie Konzepte des Übens und Trainierens in einzelnen Zweigen der Leibesübungen, der Spiele und des Sports erfolgen konnten, sondern zu dem auch die Entwicklung und Diskussion von Theorien und Modellen der sportlich-körperlichen Bildung und Erziehung im Rahmen der Gesamterziehung gehört.
Der entscheidende Impuls für die Entwicklung der Sportpädagogik in Deutschland als einer wissenschaftlichen Fachdisziplin mit breitem praktischem, gesellschaftlich erwachsenem Hintergrund erfolgte im 19. Jahrhundert, und zwar im Zusammenhang mit der Ausbreitung und Entwicklung des Turnens und der Turnbewegung als einem Element nationaler Körper- und Bewegungskultur (Krüger, 1996). Was im 19. Jahrhundert in Deutschland Turnen genannt wurde, konnte in Ziel, Form und Inhalt auf vieles zurückgreifen, was bereits an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert entstanden war und in der Regel mit dem Begriff Gymnastik bezeichnet wurde – auch in Anlehnung an Formen der körperlichen Bildung und Erziehung, die von der griechischen Antike her bekannt waren und als Vorbild für eine neue, aufgeklärte Form der Erziehung angesehen wurden, in der ebenfalls Körperlichkeit und Bewegung eine wesentliche Rolle spielen sollten. Die Pädagogik der Aufklärung und namentlich die philanthropische Bewegung in Deutschland, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird, stehen am Anfang dieses Prozesses in der modernen Welt.
Inhalte und Strukturen von Theorie und Praxis körperbezogener Bildung und Erziehung änderten sich im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert, als mit dem Aufkommen des Sports und pädagogischer Reformbewegungen, insbesondere seit den 1920er Jahren, die Turnpädagogik und Turntheorie (die Zeitgenossen sagten auch Turnphilologie und Turnwissenschaft) modernisiert und hinsichtlich ihrer Inhalte und Formen transformiert wurden. Ein Paradigmenwechsel hin zur Sportpädagogik und Sportwissenschaft unserer Zeit erfolgte jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ab den späten 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre, als sich der in den 1920er Jahren begonnene Transformationsprozess fortsetzte und sich schließlich Sport als neuer Leitbegriff der Disziplin durchsetzte. Diese Phase des Übergangs von der Theorie der Leibeserziehung und Sportpädagogik zur Sportwissenschaft ist besonders dadurch gekennzeichnet, dass nun Sport als eigenständiges wissenschaftliches Fach an den Universitäten verankert werden konnte. Dieser Prozess ist in eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung der Verwissenschaftlichung und Pädagogisierung eingebunden (Krüger, 2018).